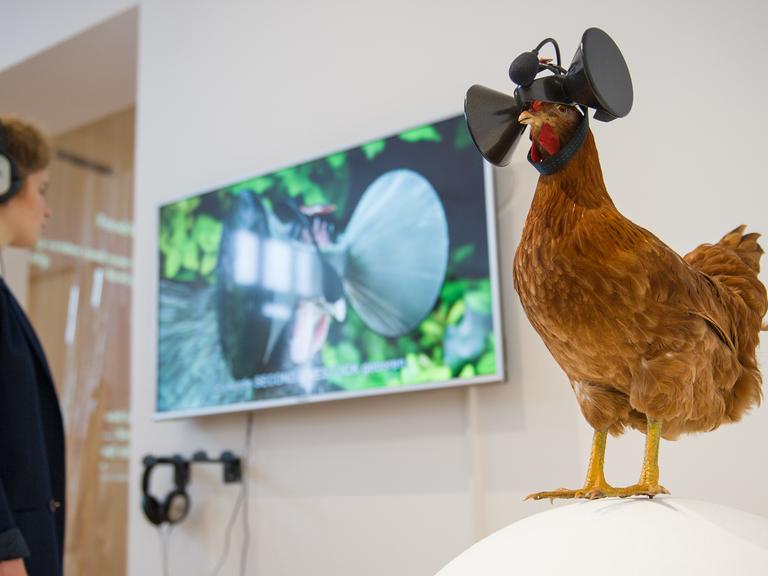Wir Soja-Junkies

Ohne es zu bemerken, sind wir zu Soja-Junkies geworden: Über 300 Millionen Tonnen Soja werden inzwischen jährlich auf der Welt produziert. Doch der exzessive Anbau der "Wunderbohne" hat Risiken und Nebenwirkungen - zum Beispiel solche, die der Einsatz von Gentechnik mit sich bringt.
"Wir haben einen landwirtschaftlichen Familienbetrieb mit Zucht und Mast. Unsere Familie setzt sich zusammen, da sammer zu fünft, also mei Frau Angela, dann der Sohn Christian, der Sohn Johannes und die Tochter Maria und der Lehrling ist auch noch da, der Stefan, also das sein mir im Betrieb, die da bei uns arbeiten."
Ein idyllischer Vierseithof in Niederbayern, Schweinestall und Wirtschaftsgebäude an drei Seiten, an der vierten das Wohnhaus mit geraniengeschmücktem Holzbalkon, dahinter die Bundesstraße, die Landshut mit Rosenheim verbindet. Soweit alles normal. Ungewöhnlich sind die Pflanzen, die Reinhard Bauer mit seinem Familienbetrieb an einem Hang oberhalb des Dorfes anbaut. Statt Weizen, Gerste, Raps oder Mais wächst dort auf 18 Hektar eine tropische Feldfrucht: Soja. Ein staatliches Förderprogramm hat ihn dazu motiviert.
"Als wir eingestiegen sind, war das eigentlich ein Risiko. Da haben wir gesagt, das ist ein Anreiz vom Geld her, muss man sagen, jetzt probieren wir das aus mit dem Soja. Und in unserer Gegend hat eigentlich jeder gesagt: Ja, Soja, das geht doch nicht."
Soja gehört wie die heimische Ackerbohne, Lupine oder Erbse zu den Leguminosen. Sie sind in der Lage, Stickstoff aus der Luft in Eiweiß zu verwandeln. Doch in Deutschland werden Leguminosen kaum noch angebaut. Das Eiweiß im Viehfutter stammt zu großen Teilen aus importierter Soja. Sie ist das Multitalent unter den Leguminosen. Eiweiß, Kohlehydrate, Fett und Mineralstoffe liefert sie in einmalig günstiger Kombination. Und der Weltmarktpreis ist niedrig.
Ein Sojameer zur Futtermittelproduktion
Jedes Jahr erstreckt sich in Brasilien, Argentinien und den USA ein Sojameer zur Produktion von Futtermitteln für das Vieh in deutschen Ställen. In den letzten zehn Jahren ist diese Fläche um 40 Prozent auf 2,7 Millionen Hektar angewachsen – das entspricht der zehnfachen Anbaufläche deutscher Kartoffeln.
Wir sind Soja-Junkies – und haben es gar nicht gemerkt. Auf dem Acker würde kaum jemand die hüfthohe Pflanze mit ihren braunen Schoten erkennen. Und im Laden sind ihre kleinen gelblichen Samen fast nirgendwo zu bekommen, sogenannte Sojasprossen sind gar keine, es handelt sich um Keimlinge der Mungobohne.
Mit dem importierten Sojaberg erzeugt Deutschland immer mehr Fleisch. Zwar stagniert der Konsum im Inland, dafür boomt der Export. Bei Geflügel und Schwein hat sich die Menge in den vergangenen zehn Jahren glatt verdoppelt.
Das hat Folgen und Nebenwirkungen. Auf dem amerikanischen Kontinent bedrohen genveränderte Soja-Monokulturen Bodenfruchtbarkeit und Regenwald, bei uns steigt die Nitratbelastung des Grundwassers. Denn die Gülle der mit Importsoja gemästeten Tiere landet auf deutschen Äckern.

Bauer und Bauer im Sojafeld© Deutschlandradio / Dirk Asendorpf
2.000 Mastschweine stehen in Reinhard Bauers Ställen, dazu 80 Zuchtsauen mit ihren Ferkeln. Damit gehört der Familienbetrieb noch zu den kleineren Mastunternehmen im Landkreis Landshut. Betriebe mit 5.000 Schweinen sind in der traditionell eher kleinbäuerlich geprägten Region inzwischen keine Seltenheit mehr. Üppige Stallbauprämien haben die Landwirte zu immer größeren Investitionen motiviert. Johannes Bauer ist der älteste Sohn. Er studiert Landwirtschaft, bald wird er den Familienbetrieb übernehmen.
"Mein Opa war im Landkreis einer der ersten, der Mastschweine gehalten hat auf Holzspalten. Das waren so die Pioniere damals. Wir sind ständig gewachsen eigentlich. Der letzte Schritt war vor vier Jahren, wir haben erweitert die Mast um 400 Tiere und da hat uns der Stallbauer schon blöd angeschaut: für 400 Tiere, so einen kleinen Stall hat er schon lange nicht mehr gebaut."
Globalisierte Schweineproduktion
Die Schweinemast in Niederbayern ist das Ergebnis zunehmender Spezialisierung in der globalen Agrarwirtschaft: Dänemark und die Niederlande haben die Zucht optimiert und liefern billige Ferkel, in Deutschland werden sie mit billigem Futter aus Süd- und Nordamerika gemästet, von billigen osteuropäischen Arbeitskräften geschlachtet und dann zum Beispiel nach China exportiert.
Reinhard Bauer steckt mit seinem Familienbetrieb mitten drin in dieser Entwicklung – und staunt doch manchmal selber darüber:
"Es reden alle von der Umwelt und das wird alles nur noch transportiert über tausende Kilometer und je mehr wo es transportiert wird, desto billiger wird's. Das ist so ein Spruch in der Landwirtschaft: Je weiter was gefahren wird, desto günstiger wird's. Und das sollte eigentlich nicht das Ziel sein."
Wachstum durch weltweite Arbeitsteilung – in vielen Industriebereichen ist das heutzutage völlig normal, warum nicht auch in der Fleischindustrie? Brasilien kann ihren Rohstoff, die Soja, am günstigsten produzieren. Die tropische Pflanze bringt es dort auf zwei Ernten pro Jahr, im kälteren Mitteleuropa höchstens auf eine. Bei uns dagegen bringt Weizen besonders gute Erträge. Warum also Soja pflanzen? Bananen oder Kaffee bauen wir schließlich auch nicht in Deutschland an.
"Wir können nicht so einfach sagen: So machen wir weiter. Es geht ohne Änderungen nun mal leider nicht aus."
Jörg Michael Greef leitet das Institut für Pflanzenbau und Bodenkunde am Julius-Kühn-Institut in Braunschweig. Jedes Jahr erstellt der Wissenschaftler im Auftrag des Bundeslandwirtschaftsministeriums die sogenannte nationale Stickstoffbilanz.
"Die nationale Stickstoffbilanz betrachtet im großen Maßstab die Stickstoff-Flüsse: was wir in die landwirtschaftliche Fläche reinbekommen und was wir daraus wieder entziehen und was davon auch übrigbleibt. Das ist der Stickstoff, der von den Pflanzen nicht genutzt wird. Und dieser übriggebliebene Stickstoff, der kann Wirkung hervorrufen, zum Beispiel, dass er über das Grundwasser ins Trinkwasser gelangt. Und da soll er ja nicht hin. Oder er kann ausgasen, der Stickstoff, in die Atmosphäre gelangen und dann auch wieder Wirkung hervorruft, die auch nicht gut ist für uns."
Pflanzen brauchen Stickstoff, um Eiweiß zu bilden. In der Luft ist das Gas zwar reichlich vorhanden, doch Luftstickstoff können Pflanzen nicht direkt aufnehmen. Sie benötigen ihn in gebundener Form im Boden. Auf natürliche Weise wird er dort von Bakterien erzeugt.
Eine intensive Landwirtschaft ist jedoch nur mit zusätzlichem Stickstoff aus Mineraldünger möglich. Außerdem werden die Fäkalien aus der Tierhaltung auf den Feldern entsorgt, als sogenannter organischer Dünger. Auch er enthält Stickstoff. Umgekehrt verliert der Boden Stickstoff durch Ausgasung und durch den Abtransport der Ernte, in der Stickstoff in Form von Eiweiß gebunden ist.

Ein Sojafeld bei Gnoien (Mecklenburg-Vorpommern). © picture alliance / dpa / Bernd Wüstneck
Insgesamt liegt der Eintrag jedes Jahr deutlich über dem Austrag, im Durchschnitt beträgt der Stickstoff-Überschuss rund 100 Kilo pro Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche.
"Ist mal 80, mal 120 je nach Jahresverlauf, hängt ganz entscheidend davon ab wie die Ertragssituation ist: Haben wir gute Jahre, ist die Bilanz besser, haben wir schlechtere Jahre, ist die Bilanz nicht ganz so gut."
Und das bedeutet: Mehr Lachgas entweicht, das beschleunigt den Klimawandel. Und immer mehr Stickstoff landet in Form von Nitrat im Grundwasser. Besonders gravierend ist das Problem dort, wo die Massentierhaltung schon lange konzentriert ist. Nach der jüngsten Bewertung der EU sind in Niedersachsen nur noch 41 Prozent des Grundwassers in einem guten Zustand. Auch in Bayern steigen die Nitratwerte, an Messstellen im Landkreis Landshut zum Beispiel um über 20 Prozent in den vergangenen 12 Jahren.
"Wenn da konstante Anreicherungen passieren, die ja auch nachweislich vorhanden sind, dann haben wir natürlich ein Problem. Das Bemühen ist aber, diesen Überschusswert nach und nach zu senken, indem man zum Beispiel weniger Dünger nutzt und natürlich auch durch Leguminosenanbau, das ist eine ganz wichtige Komponente dadrin."
Im Unterschied zu anderen Pflanzenarten sind Leguminosen nicht auf Stickstoff im Boden angewiesen. Im Gegenteil: in ihren Wurzelknöllchen siedeln Bakterien, die den Stickstoff direkt aus der Luft aufnehmen und an die Pflanze weitergeben. Im Fruchtwechsel spielen Leguminosen deshalb eine wichtige Rolle für den Erhalt der Bodenqualität.
Reinhard Bauer konnte den Effekt direkt beobachten. Die zwei Hälften seines Weizenfeldes erbrachten deutlich unterschiedliche Erträge. Auf der einen Hälfte hatte er im Vorjahr Mais angebaut, auf der anderen die Leguminose Soja.
"Die Bestände haben ziemlich gleich ausgeschaut, aber der Ertragsunterschied war bei über zehn Doppelzentnern. Wir haben 91 Doppelzentner gehabt nach Soja und 81 Doppelzentner nach Mais. Das hat mich selber überrascht, das hat man mit dem Auge nicht gesehen, muss man wirklich sagen. Da waren die Körner vom Weizen schöner."
Auch Ackerbohne oder Lupine haben diesen positiven Effekt auf die Bodenfruchtbarkeit. Doch wenn es um Nährwert, Ertrag und Wirtschaftlichkeit geht, ist Soja allen anderen Leguminosen haushoch überlegen. Gerne ist deshalb auch von der Wunderbohne die Rede.
Der Durchbruch kam im Ersten Weltkrieg
Ihre Geschichte begann vor 9000 Jahren im Nordosten Chinas. Als die Sojabohne von dort im 19. Jahrhundert erstmals in die USA gelangte, nutzten Farmer sie zunächst als Zwischenfrucht zur Bodenverbesserung. Das änderte sich erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts, dann aber mit Karacho. Seit 1900 schoss die weltweite Erntemenge um sagenhafte 5000 Prozent in die Höhe, von sechs auf über 300 Millionen Tonnen im Jahr. Kein anderes Agrarprodukt hat jemals ähnlich dramatische Wachstumsraten erreicht.
Für den globalen Siegeszug von Fließband und Automobil erwies sich die Wunderbohne als idealer Begleiter. Die junge Industrie verlangte nach gut und günstig ernährten Arbeitskräften, die Landwirtschaft nach Dünger, die Viehzucht nach Futter, für Chemiefabriken und Verbrennungsmotoren wurde immer mehr billiges Öl gebraucht. All das hatte die Sojabohne zu bieten.
Ein Big Mac für den überdurchschnittlichen Appetit – so propagierte McDonald's 1967 die Einführung des Doppel-Hamburgers für extra-große Münder. Ohne den Sojaboom hätte es die amerikanische Liebe zum Rindfleisch nie gegeben.

Ohne Soja gäbe es keinen Bic Mac.© picture alliance / dpa / Oliver Berg
Der entscheidende Durchbruch kam im Ersten Weltkrieg. Der Historiker Joachim Drews hat den Zusammenhang von Krieg und Soja untersucht:
"In dem Moment, wo die USA mit Japan in den Krieg eingetreten waren, waren sie von ihrem Haupteinfuhrgebiet Asien abgeschnürt, von dem sie bisher die Sojabohnen oder Ölfrüchte importiert hatten. Deshalb gab es von Seiten der US-Regierung ein Programm, die Sojabohnenproduktion massiv zu steigern. Binnen weniger Jahre wurde die um 50 Prozent gesteigert und man war aber damals primär nur an dem Öl interessiert, an dem Öl der Sojabohne.
Und als Abfallprodukt fiel dann das eiweißreiche Futtermittel an. Und weil man nicht wusste, was man damit machen sollte, hat man gesagt: Okay, dann steigern wir die Fleischproduktion. Und es wurde eine Art nationale Kampagne gestartet, dass es eine patriotische Pflicht wäre, Fleisch zu essen – während des Ersten Weltkrieges. Es gab richtig Anzeigenkampagnen, wo die Bevölkerung dazu aufgefordert wurde, mehr Fleisch zu konsumieren. Die Kampagne war sogar so erfolgreich, dass der Fleischkonsum nach zwei Jahren wieder etwas gebremst werden musste. Aber dieses Grundmodell des Fleischkonsums hatte sich durchgesetzt."
Es war die Geburtsstunde der modernen Sojawirtschaft. Schon in den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts überholten die USA Japan und Korea beim Sojaanbau, kurz danach auch die Mandschurei und China.
"Soja für den Blitzkrieg"
Intensiv ließ die deutsche Wehrmacht den militärischen Nutzen von Sojaprodukten zur Deckung der sogenannten Eiweißlücke in den Feldküchen erforschen. Das Ergebnis waren neben Backwaren, Kakaogetränken und Wurstkonserven, die mit Soja gestreckt wurden, vor allem die sogenannten Pemmikan-Landjäger. Sie sollten schnell vorrückenden Truppenteilen alle nötigen Nährstoffe in hochkonzentrierter Form liefern. So würden die Rucksäcke leichter und der Nachschub einfacher.
Nach der schnellen Eroberung Polens kamen die Pemmikan-Landjäger zu internationaler Berühmtheit. "Soja für den Blitzkrieg" hieß es in den Medien, in den USA war sogar von der "Nazi-Bohne" die Rede. Das deutsche Militär übernahm den Begriff und brüstete sich damit. Als die Sojalieferungen aus der Mandschurei nach dem Überfall auf die Sowjetunion ausblieben, sollte die IG Farben, der damals weltgrößte Chemiekonzern, für schnellen Ersatz sorgen.
"In Deutschland hat es mit dem Anbau der Sojabohne nicht so geklappt. Man hat massiv den Anbau gefördert und hat auch in die Wissenschaft investiert, in die Pflanzenzüchtung. Aber man ist an arttypische Grenzen gestoßen, da die Sojabohne eine Pflanze ist, die viel Wärme vor allem in der Frühzeit benötigt. Aber vor allem in Südosteuropa, also in Rumänien und Bulgarien, wurde von deutscher Seite ein großer Anbau aufgezogen. Und dort hat es wirklich eine Anbausteigerung von null Hektar bis auf über 200.000 Hektar innerhalb weniger Jahre gegeben."
Nach dem Krieg war es schnell wieder vorbei mit dem Sojaanbau in Europa. Weltweit waren die Importe aus den USA einfach zu billig. Ein Gesetz zur Förderung von Agrarexporten sorgte dafür. US-Präsident Dwight D. Eisenhower hatte es 1959 auf den Weg gebracht.
Dwight D. Eisenhower: "Anfang des Jahres habe ich ein Programm aufgelegt, um die Agrarüberschüsse reicher Länder für die Sicherung des Friedens und des Wohlergehens freier Menschen überall auf der Welt einzusetzen. Oder, um es kurz zu sagen, Lebensmittel für den Frieden zu nutzen."
Unter dem Namen "farm bill" ist das Gesetz bis heute in Kraft. Es führt zu einer massiven Subvention amerikanischer Sojaerzeugnisse. Menschen in aller Welt verzehren sie vor allem in Form von Margarine und, nach dem Umweg über Kraftfutter und Viehzucht, als Fleisch.
Inzwischen hat Brasilien als Sojaproduzent zu den USA aufgeschlossen, beim Export liegt es sogar mit großem Abstand vorn. Denn in den vergangenen 15 Jahren hat der größte südamerikanische Staat seine Anbaufläche glatt verdoppelt und erzeugt heute fast 90 Millionen Tonnen Soja im Jahr, zwei Drittel davon für den Export. China hingegen, die Wiege der Wunderbohne, ist ihr größter Importeur geworden, 82 Millionen Tonnen führte das Land der Mitte im vergangenen Jahr ein, um damit den Fleischhunger einer neuen kaufkräftigen Mittelschicht zu befriedigen.
Ohne Monsanto gäbe es den Sojaboom nicht
Monsanto, ohne diesen US-amerikanischen Agrar-Konzern wäre der jüngste Sojaboom nicht möglich gewesen. 1997 brachte Monsanto in den USA, Kanada und Argentinien das erste gentechnisch veränderte Soja-Saatgut in den Handel. Es ist gegen das ebenfalls von Monsanto gelieferte Breitband-Herbizid Roundup resistent, das hat zu deutlichen Kosteneinsparungen bei der Unkrautbekämpfung geführt. Hauptbestandteil von Roundup ist das umstrittene Glyphosat. Die Weltgesundheitsorganisation hat es als wahrscheinlich krebserregend eingestuft.
Wirtschaftlich erwies sich die Kombination aus gentechnisch verändertem Saatgut und darauf abgestimmter Unkrautvernichtung als äußerst lukrativ. Heute liegt der Anteil transgener Soja in allen Hauptanbaugebieten über 90 Prozent. Nur in der EU dürfen gentechnisch veränderte Sorten nicht angebaut werden. Als Import-Tierfutter sind sie aber zugelassen und weit verbreitet. In Deutschland beträgt ihr Anteil an der verfütterten Soja über 80 Prozent – und das, obwohl 70 Prozent der Deutschen Gentechnik ablehnen.
Thanninger Freiheit heißt der Geflügelhof, den die Familie Aigner im niederbayrischen Schönau betreibt. 50.000 Hennen legen dort morgens ihr Ei, dann öffnet sich der Stall und die Tiere strömen ins Freie. Hauptabnehmer ist eine große Supermarktkette. Bei Seniorchef Gerhard Aigner hat sie Freilandeier bestellt, die mit gentechnikfreiem Futter erzeugt werden – aus Imagegründen:
"Das ist an uns herangetragen worden vor circa sechs Jahren, dass man gesagt hat: Weil gentechnikveränderter Soja kommt aus Südamerika, man sollte da unten weggehen, weil die ganze Regenwaldproblematik und Pflanzenschutz und Kleinbauern ... – was man alles hört, die ganzen Schlagworte – wir sollen den Soja woanders her nehmen. Und dann haben wir damals versucht, Alternativen zu finden und haben einen Betrieb in Rumänien gegründet, um da den Soja für uns anzubauen. Das machen wir jetzt seit fünf Jahren und in der Zwischenzeit funktioniert es schon ganz schön."

Auf dem Hühnerhof von Gerhard Aigner© Deutschlandradio / Dirk Asendorpf
2000 Tonnen Soja verfüttert der Landwirt im Jahr – angebaut auf seinen eigenen Feldern rund um Sibiu, dem früheren Hermannstadt im rumänischen Siebenbürgen, 1.200 Kilometer von seinen Geflügelställen entfernt. Fast jede Woche pendelt Gerhard Aigner zwischen Bayern und Rumänien, meist per Flugzeug. Der Aufwand ist groß, aber er lohnt sich.
"Das ist der große Vorteil beim eigenen Anbau: Ich kann mein Saatgut selber bestimmen, ich kann meine Spritzmittel bestimmen. Das ist ein Riesen-Thema. Ich kann auf Glyphosat verzichten. Wenn ich zukauf, ist das immer... ich muss mich verlassen, dass das wirklich so gemacht wird."
Gentechnikfrei? Das ist eine Frage der Definition
"Ohne Gentechnik" heißt das Label für tierische Lebensmittel, die ohne transgenes Futter erzeugt wurden. Über 4000 zertifizierte Produkte stehen bereits in den Regalen des Lebensmittel-Einzelhandels. Mit Verbraucherschutz hat das allerdings kaum etwas zu tun. Das Verbot gentechnisch veränderter Futterpflanzen bezieht sich nämlich nur auf einen bestimmten Zeitraum vor der Verwertung. Bei Schweinen sind das die letzten vier Monate vor der Schlachtung, bei Eiern die letzten sechs Wochen vor dem Legen und bei Milch die letzten drei Monate vor dem Melken. In der Reklame wird das nicht erwähnt:
Frau: "Aus gesunder Kuhmilch vom grünen Dach Europas..."
Mann: "...und ohne Gentechnik!"
Kind: "Bin ich auch ohne Gentechnik?"
(Alle lachen): "Na klar."
Frau: "Aus gesunder Kuhmilch vom grünen Dach Europas..."
Mann: "...und ohne Gentechnik!"
Kind: "Bin ich auch ohne Gentechnik?"
(Alle lachen): "Na klar."
Vor allem Milch- und Molkereierzeugnisse werden zunehmend unter dem "Ohne-Gentechnik"-Label vermarktet. Nicht ökologische Überzeugung, sondern eine weitere Kuriosität der globalen Agrarwirtschaft hat dazu geführt: die Beimischungspflicht für Pflanzenöl im Dieselkraftstoff.
Der Biodiesel hat den Rapsanbau in Deutschland beflügelt, über 1,3 Millionen Hektar standen 2016 knallgelb auf den Feldern, gentechnisch unverändert. Ihr ausgepresstes Öl landet im Diesel, übrig bleibt der sogenannte Rapskuchen, ein eiweißhaltiges Futtermittel. Es ist so billig, dass es das Sojaschrot in der Rinder- und Milchkuhhaltung inzwischen fast vollständig verdrängt hat. Bei Schweinen und Geflügel geht das aber so einfach nicht. Anders als Wiederkäuer sind sie in der Mast auf das hochwertige Eiweiß aus der Soja angewiesen.
Doch gentechnikfreie Soja ist auf dem Weltmarkt knapp. Zwar wird sie in Brasilien wieder etwas häufiger angebaut, doch die saubere Trennung über die gesamte Transportkette ist schwierig und teuer. Einzige Alternative ist deshalb Soja aus Europa, dem letzten gentechnikfreien Kontinent. Und das ist derzeit der wichtigste Grund für die Experimente mit dem Sojaanbau in Deutschland.
"Dann würden wir zu Sultana gehen, wir marschieren jetzt hier am Feld lang. Im Ertrag mal ganz hoch und auch mal ganz niedrig. Das ist eben der Nachteil der Sorte, trotzdem ist sie für den Anbau in Mitteldeutschland noch zu empfehlen. Lissabon, die nächste..."
Sabine Wölfel leitet die Soja-Anbauversuche der Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft in Großenstein, ganz im Osten des Bundeslandes. Ein gutes Dutzend sauber getrennter Streifen sind auf einem Feld markiert, auf jedem wächst eine andere Sorte Soja. In Höhe, Farbe und Reife unterscheiden sich die Pflanzen deutlich.
"Obelix: hier nicht ganz so stark ausgeprägt, dieses Hülsenbüschel an der Spitze, guter Besatz, aber letztes Jahr eben auch ein mittlerer Ertrag, also kein Überflieger, aber auch nicht schlecht, Reife auch erst am 6.10. voriges Jahr, das ist schon deutlich spät, die müssen wir weiter beobachten."
Auch die DDR versuchte sich am Sojaanbau
Als ursprünglich tropische Pflanze braucht Soja viel Wärme und lange Nächte für das Auslösen der Blühphase, beides hat Deutschland mit seinem wechselhaften Wetter und kurzen Sommernächten eigentlich nicht zu bieten. Doch mit gezielter Züchtung, cleverer Anbautechnik und etwas Unterstützung durch den Klimawandel könnte Soja sich auch hierzulande durchsetzen – so wie es der Mais – eine ursprünglich ebenfalls tropische Pflanze – nach dem Zweiten Weltkrieg vorgemacht hat.
Sabine Wölfel ist davon überzeugt. Schon vor über 30 Jahren war sie an Zuchtversuchen beteiligt.
"Wir haben damals zu DDR-Zeiten chinesische Sorten mit als Eltern gehabt, aber da ist die Wirkung des Kurztages ganz extrem, die haben wir also hier zusätzlich abgedeckt, damit die wirklich zwölf Stunden Licht und zwölf Stunden Dunkelheit hatten, damit die überhaupt in die generative Phase kommen."
Großen Erfolg hatten die Bemühungen damals nicht, zum wirtschaftlichen Erfolg wurde der Sojaanbau in der DDR nie. Danach gab es über Jahrzehnte gar keine Soja-Zuchtversuche mehr in Deutschland, erst in den letzten Jahren haben sie im ganz kleinen Stil wieder begonnen.
"Selbst züchten ist halt sehr mühsam, weil die Blütchen so klein sind, das kann man also mit bloßem Auge gar nicht machen. Das Problem bei Sojabohne ist, dass die Züchtung stattfindet in Österreich, Schweiz, Kanada, Rumänien, Ukraine. Und wir haben zwar den Vorteil, dass wir aus diesem Sortenpool schöpfen können, aber die Sorten wachsen bei uns hier doch ein bisschen anders. Jeder Landwirt, der Sojabohnen anbauen möchte, soll sich in seinem Territorium orientieren, informieren, welche Sorten bei ihm gehen und von welchen er eben lieber die Finger lassen sollte."
Mit Misserfolgen muss dabei immer gerechnet werden. Mindestens fünf Jahre, so Sabine Wölfels Rat, sollte sich ein Bauer für die Experimente mit dem Sojaanbau Zeit lassen. Erst dann bekomme er anhand der guten und weniger guten Ernten eine klare Einschätzung der Wirtschaftlichkeit.
Sojapflanzen sind "Mimöschen"
Trial and Error – das ist auch das Motto von Thomas Schubert. Er ist Betriebsleiter auf Gut Döllnitz, einem großen Demeter-Biounternehmen in Sachsen-Anhalt. Mit über 70 Hektar Anbaufläche gehört er zu den größten Sojaproduzenten in Deutschland. Sein Saatgut vermehrt er selber.
"Wir haben da sehr viel Spaß dran am Sojaanbau, ist auch ein bisschen mein Steckenpferd die letzten Jahre, weil für mich ist das eine Herausforderung. Es ist nicht einfach, das muss man lieben lernen, also es ist keine einfache Frucht, es ist ein Mimöschen."
Es gab schon Jahre, da konnte Thomas Schubert nicht mehr Soja ernten, als er zuvor gesät hatte.
Deutschlandweit schwanken die Erträge zwischen einer und vier Tonnen Soja pro Hektar. Ein Großbetrieb kann so etwas verkraften, für einen kleinen ist das wirtschaftliche Risiko sehr groß. Trotzdem hat sich die deutsche Sojaernte in den vergangenen fünf Jahren verdreifacht. Mit gut 30.000 Tonnen ist sie gegenüber den 4,2 Millionen Tonnen importierter Soja allerdings weiterhin winzig.

Sojafeld in Sachsen© Deutschlandradio / Dirk Asendorpf
Reinhard Bauer stapft durch sein fast erntereifes Sojafeld bei Landshut in Niederbayern:
"Da brauchen wir drei Wochen noch. Der Bestand schaut eigentlich gut aus, es sind viele Schoten mit drei Körnern drinnen. Ich glaube, dass wir mit dem Ertrag nicht schlecht liegen. Nicht super, aber auch nicht schlecht."
Den Einstieg in die Sojaproduktion hat der Landwirt bisher nicht bereut. Vor allem deshalb nicht, weil er die Ernte gar nicht erst verkaufen muss. Die Körner lässt er rösten und verfüttert sie dann direkt an seine Zuchtsauen. Reinhard Bauer ist kein Öko, das Unkraut auf dem Sojafeld hat er vor der Aussaat weggespritzt – mit Glyphosat. Trotzdem sieht er seine Entscheidung für die tropische Leguminose auch als kleinen Beitrag für eine regionale Produktion.
"Weil das so schon ein bisschen ein Kreislauf ist in der Landwirtschaft - und warum sollte man das gute Futter verkaufen und das andere zukaufen, wo man nicht weiß, wo's herkommt. Wir können sicher nicht den ganzen Soja ersetzen. Das wird jetzt von allen Seiten propagiert, ich glaube, wir werden weiterhin Soja brauchen von Amerika, aber man soll probieren, dass man wirklich einen Teil bei den Ferkeln, Zuchtsauen oder Hennen selber verwendet. Ich glaube, dass wir bei 25 Prozent maximal sind beim eigenen Bedarf, 75 Prozent kommen fremd."
"Wir brauchen eine Agrarwende"
Es ist dieses Bild, das Reinhard Bauer und seine niederbayrischen Kollegen gerne vermitteln möchten: eine moderne Landwirtschaft, die gleichzeitig möglichst viel Rücksicht nimmt auf regionale Erzeugung und hohe Qualität. Heimatlandwirte heißt der Verein, den die Bauern rund um Landshut gegründet haben – und für den sie mit kurzen Spots im Radio werben.
Werbespot: "Also der richtige Bayer an sich, der moant allerweil, er kann alles besser. Er wohnt besser, macht die besseren Festl und er genießt besser, zum Beispiel beim Fleisch. Sorgfältiger Umgang und gesunde Ernährung beim Tier und unsere bayrischen Bauern achten immer auf höchste Qualität. Und wisst's was: Recht hat er, der Bayer. Schaut's vorbei auf www-Heimatlandwirte-de. Das beste voa Dahoam."
Mit der Wirklichkeit industrieller Landwirtschaft hat dieses idyllische Bild nichts mehr zu tun. Ihr Ruf leidet unter Massentierhaltung, Gülleschwemme und globalem Handel transgener Soja. Längst kommt die Forderung nach einem grundsätzlichen Wandel nicht mehr nur von Bioverbänden und Öko-Aktivisten.
"Wir brauchen eigentlich im Grundsatz eine Agrarwende. Das heißt, wir brauchen ein völlig neues Wirtschaften und Miteinander mit den Tieren, den Pflanzen und dem Boden. Und das bedeutet ökologische Landwirtschaft."
Sagt Martin Weyand, Hauptgeschäftsführer des einflussreichen Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft, BDEW. Die Versorgung mit sauberem Trinkwasser sei in Gefahr, wenn die Landwirtschaft ihr Nitratproblem nicht in den Griff bekomme.
In die gleiche Kerbe schlägt ausgerechnet die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft DLG. Die Agrarlobbyvereinigung hat Thesen zur Zukunft der Landwirtschaft aufgestellt, Carl-Albrecht Bartmer, ihr Präsident, bewirbt sie im Internet:
"Landwirtschaft muss ihre negativen Umweltwirkungen reduzieren. Sie trägt mehr Verantwortung für das Tier und für die Agrarlandschaften. Das sind selbstkritische Forderungen, die die DLG thesenartig formuliert hat."
Unsere Sucht nach Soja verläuft wie bei anderen Drogen auch: Am Anfang schmecken sie süß, machen high und abhängig. Diese Phase liegt bereits hinter dem globalen Boom der Wunderbohne. Dann kommt das böse Erwachen und die Suche nach Ersatzdrogen. Die gibt es zwar mit dem Soja-Anbau in Deutschland, aber längst nicht in ausreichender Menge. So bleibt nur der kalte Entzug. Am Ende würde davon sogar die Gesundheit profitieren. Weniger Soja, weniger Fleisch, mehr Vielfalt auf dem Teller und dem Acker – es wäre eine Win-Win-Situation für Umwelt und Verbraucher.