Michael Köhlmeier: Der Mann, der Verlorenes wiederfindet
Hanser, München 2017
158 Seiten, 20 Euro
Antonius und die Frage, warum Gott den Teufel erschaffen hat
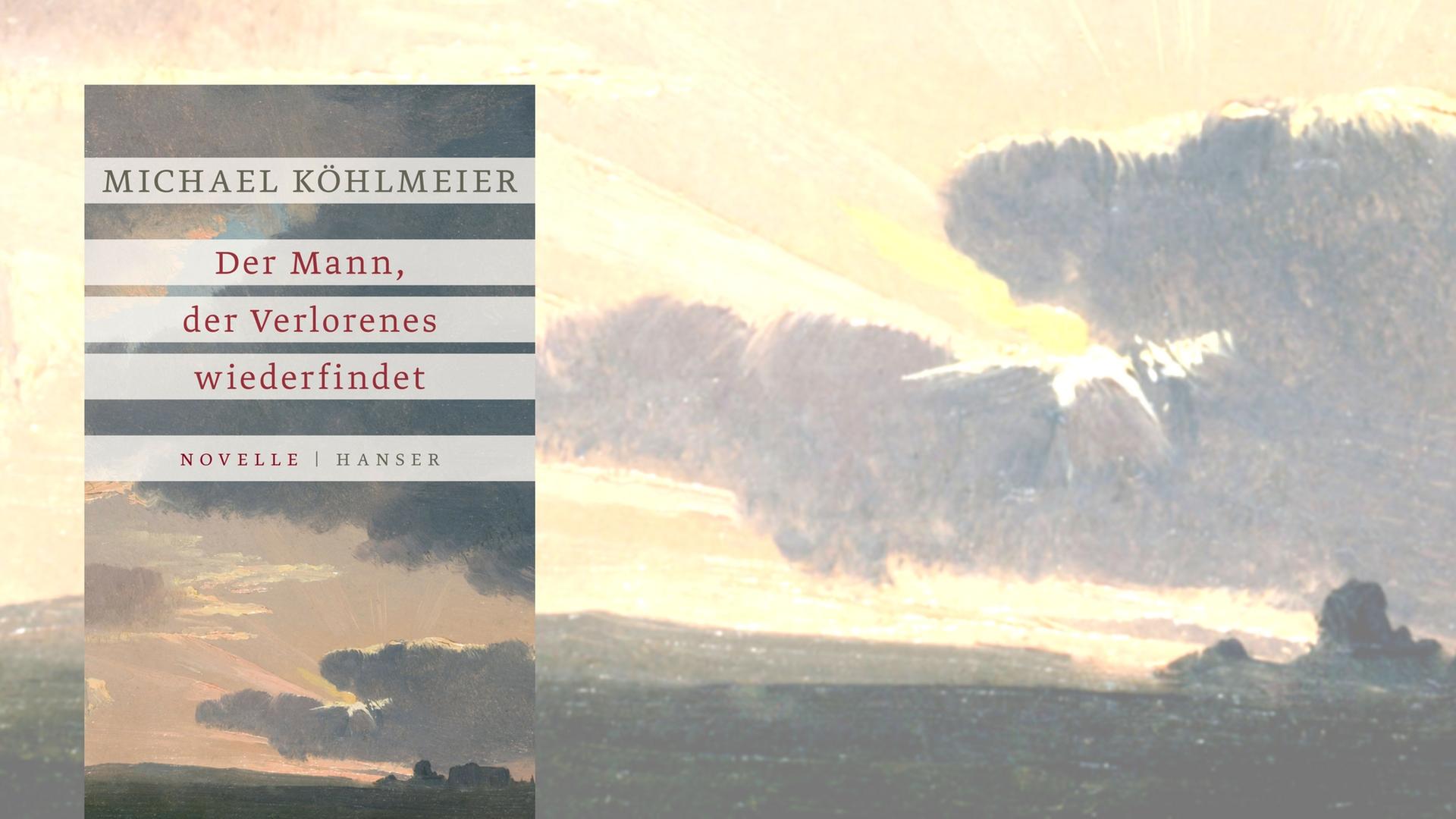
Der Autor Michael Köhlmeier hat sich auf das Nacherzählen märchenhafter, mythischer Stoffe spezialisiert, diesmal ist es die Person des heiligen Antonius von Padua. "Der Mann, der Verlorenes wiederfindet" hat bei Köhlmeier eine Mission: die Ursache alles Bösen zu finden.
"Der heilige Antonius von Padua / saß oftmals ganz alleinig da / und las bei seinem Heiligenschein / meistens bis tief in die Nacht hinein."
Glückliche Leser, die ihre eigene Leselampe haben, könnte man bei diesen Versen von Wilhelm Busch sagen und freundlich darüber hinwegsehen, dass Busch sich im Heiligen geirrt hat. Antonius von Padua führte ein vergleichsweise langweiliges Heiligenleben, wurde weder geröstet noch gevierteilt, und auch die berühmte Versuchung, die Busch lustvoll ins Bild setzte, betraf einen anderen, den "großen" Antonius.
Dennoch hat der österreichische Schriftsteller Michael Köhlmeier nun ausgerechnet den heiligen Antonius von Padua ausgesucht, um dessen Geschichte als knappe Novelle zu erzählen. Köhlmeier hat sich schon seit längerem auf das Nacherzählen mythischer und märchenhafter Stoffe spezialisiert, das kann er wie kein Zweiter. Tatsächlich stellt sich für jeden Erzähler die Frage, wozu man eigentlich immer neue Geschichten erfinden soll, wenn sie doch nur Variationen der altbekannten sind und wenn die Mythen und Legenden schon lange alle Muster für die Grundbefindlichkeiten und Urkonflikte des Menschen bereitstellen.
Als Heiliger ist Antonius zuständig für verlorene Dinge. Darüber sagt Köhlmeier wenig, doch "Der Mann, der Verlorenes wiederfindet" ist bei ihm in anderer Mission unterwegs: In einem Traum, den ein Abt ihm erzählt, geht es um das Nichts als finstere schwarze Macht und Ursache alles Bösen. Seelen, die darin verlorengehen, sind nicht mehr wiederzufinden. Antonius aber, so die Hoffnung, ist der Mann, dem das gelingen könnte.
Warum Gott das Böse zulässt
Berühmt wurde Antonius vor allem wegen seiner Eloquenz und seiner publikumswirksamen Reden. Die Überlieferung besagt, dass er den Fischen predigte, die seine Worte mit ihren Lippen nachformten – ganz ähnlich wie Franz von Assisi, dem Antonius nacheiferte, den Vögeln gepredigt haben soll. Köhlmeier spart diese Legenden nicht aus, zeigt aber auch, wie sie aus dem Gerede, hysterischer Frömmigkeit und dem Hörensagen heraus entstehen. Das gelingt ihm, obwohl er einen "Chronisten" installiert, indem er die letzte Rede des Antonius in Arcela bei Padua, von verschiedenen Ohren- und Augenzeugen wiedergeben lässt, die alle etwas völlig anderes gehört haben. Einig sind sie sich nur darüber, dass Antonius erst schwankte und schließlich zusammenbrach und vor den Augen der 3000 Gläubigen um ihn herum starb – sofern nicht auch das zu den Legenden gehört.
In Rückblenden entfaltet Köhlmeier nach und nach die Lebensgeschichte des Heiligen, doch nicht das Biografische - das sich überall nachlesen lässt - interessiert ihn, sondern die theologischen Zweifel: Antonius' Kampf gegen die - eigene - Eitelkeit vor allem und die unlösbare Frage, warum Gott das Böse zulässt und auch den Teufel geschaffen hat. Was ist das für ein Gott, der sich auf eine Wette mit Luzifer um die Seele des getreuen Hiob einließ und ihm erlaubte, dessen Frau, Kinder, Vieh und Haus und schließlich auch Hiobs Gesundheit zu vernichten, nur um dessen Treue zu erproben? Dagegen setzt Köhlmeier auf die Freundlichkeit seines Heiligen, auf die demütige Bescheidenheit, zu der er findet und auf seine verständige Klugheit, die auch Gerüchten und Massenerregungen zu misstrauen weiß. Er ist als Prototyp eines aufgeklärten Vernunftmenschen das Gegenbild eines jeden Hasspredigers und insofern eine Gestalt, an die sich heute gut anknüpfen ließe. Wenn "das Nichts dort ist, wohin Gott nicht schaut", dann gilt es in einer säkularen Welt, zumindest die Erzählung aus Zeiten, in denen mit dem Glauben gerungen wurde, wach zu halten.




