Alles wieder gut?

Spanien rutschte vor zehn Jahren in eine Rezession, Bankkunden verloren ihre Ersparnisse, standen vor dem Ruin. Das Vertrauen in die Wirtschaft und in die Politik wurde damals tief erschüttert. Jetzt wächst die Wirtschaft wieder. Aber ist damit auch die Krise überwunden?
Ein Kopfnicken Richtung Tür, dann dreht Jacinto den Siebträger in die Espressomaschine. Carlos' Besuch hat er schon erwartet. Jeden Tag, pünktlich um halb elf, kommt der Nachbar von gegenüber in die kleine Bar, zum Lagebericht. Jacinto schiebt seinem Stammgast ein Glas mit dampfendem Milchkaffee über den Tresen.
Letzte Nacht habe er den Rettungsdienst angerufen, erzählt Carlos. Auf dem Müllcontainer vor seinem Haus lag ein lebloser Körper, 20 Minuten hätten die Notärzte gebraucht, um ihn wiederzubeleben. Danach sei der Mann aufgestanden und habe nach dem nächsten Schuss gefragt. Jacinto lacht trocken auf. Solche Drogengeschichten kennt er zur Genüge. In einem Lokal in der Nachbarschaft fertigt ein Dealer seine Kunden im Minutentakt ab.
Drogen und Kriminalität - für die Menschen im Altstadtviertel Raval gehören sie längst zum Alltag. Vor einem Jahr titelten die Zeitungen: "Das Heroin ist zurück in Barcelona". Dabei ist der Konsum seit Jahren gleich. Aber statt in den Außenbezirken auf der Straße oder am Hafen werden die Drogen jetzt mitten in der Altstadt verkauft, in den Wohnungen, die seit der Krise leer stehen. "Narco-Pisos", "Narco-Wohnungen" nennt man in Spanien die illegalen Fixerstuben und Verkaufsstellen. Jacinto lässt ein paar schmutzige Teller ins Spülbecken gleiten.
Seit der Bankenkrise stehen drei Millionen Wohnungen leer
"Das Problem ist doch, dass während des Booms alle wie verrückt gekauft haben. Dann kam die Krise, die Leute konnten ihre Hypothek nicht mehr bedienen, die Wohnungen fielen zurück an die Bank und standen leer. Früher gab es hier 20 Geschäfte, kleine Läden, Schreinereien, einen Videoclub. Jetzt gibt es nur noch uns: diese Bar. Das einzige Geschäft, was wirklich gut läuft, ist das Bordell nebenan und die Drogen."
Als 2008 die Immobilienpreise fielen, zog das die gesamte spanische Wirtschaft mit sich – und auch unser Viertel ging den Bach runter, seufzt Jacinto. Carlos hat allein in den Straßenzügen des Ravals 40 "Narco-Pisos" ausfindig gemacht. Seit seine kleine Tochter beim Spielen eine Spritze gefunden hat, hat sich der arbeitslose Webdesigner ganz dem Kampf gegen die Drogenkriminalität verschrieben, Nachbarn zusammengetrommelt und eine Bürgerinitiative gegründet.

Leerstand in Barcelonas Stadtviertel Raval© Julia Macher
Die leeren Wohnungen – drei Millionen sind es in ganz Spanien – sind nicht das einzige Erbe der Krise. Carlos deutet mit dem Kinn auf eine Bankfiliale an der Ecke. "Ladrones", "Diebe" hat jemand mit roter Farbe auf das Schaufenster gesprüht. Das Vertrauen in das spanische Finanzsystem ist tief erschüttert. Immer noch. Auch im Zentrum der Macht. In Madrid.
Drogendealer nutzen Wohnungen als Fixerstuben
Die Plaza de las Cortes. Vor dem spanischen Kongressgebäude richtet ein Ü-Wagen des spanischen Fernsehens seine Satelliten-Schüssel aus. In den Straßencafés gegenüber machen Angestellte aus den umliegenden Banken und Verwaltungen Frühstückspause: Patricia Suárez residiert in ihrem Büro in bester Lage.
Die selbstbewusste Frau mit dem kurzen, weißblonden Haar und den knallroten Lippen ist Präsidentin von Asufin. Die Gründerin der Verbraucherorganisation berät seit 2009 Menschen, die eine Hypothek aufnehmen, einen Fonds, eine Versicherung kaufen wollen. Oder sich bereits Geld geliehen haben – und sich betrogen fühlen. In den hellen, freundlichen Räumen sitzt ein halbes Dutzend Mitarbeiterinnen. Das Headset auf dem Kopf, die Finger auf der Tastatur beantworten sie Finanzfragen der fast 15.000 Mitglieder, nehmen Beschwerden auf. Patricia Suárez lässt sich auf einen Drehstuhl fallen und fährt den Computer hoch.
Kopfschüttelnd klickt sie sich durch die Nachrichten von damals: Der Börsencrash im Oktober 2008. Die insgesamt 120 Milliarden Euro teure Umstrukturierung des spanischen Finanzwesens. Die Gründung der Großbank Bankia und die Skandale um die von ihr herausgegebenen Vorzugsaktien, die mindestens 300.000 Rentner um ihre Ersparnisse gebracht haben. Für sie ist klar: Das spanische Bankwesen hat die Krise verursacht.
300.000 Rentner wurden um ihre Ersparnisse gebracht
"Wenn ich in einen Klamottenladen gehe, will man mir dort natürlich etwas verkaufen. Aber sie werden mir das Kleid verkaufen, das ich möchte – im schlimmsten Fall komme ich mit einem Kleid und einer Jacke aus dem Geschäft. Aber das Problem bei den Banken war – und das ist es immer noch - dass sie den Kunden etwas ganz anderes verkauft haben – oder die gewünschten Produkte mit anderen verknüpfen, mit Kreditkarten, Lebensversicherungen oder Kreditkarten."
Patricia weiß, wovon sie spricht. Auch ihre Bank hat ihr etwas angedreht, was sie gar nicht haben wollte: einen Swap. Das spekulative Tauschgeschäft sollte sie gegen die steigenden Zinsen ihrer Hypothek absichern.
"Das wurde verkauft wie eine Art Versicherung. Im September 2008, Lehmann Brothers hatte bereits pleite gemacht, sind wir zur Bank und sagten: Die Zinsen sinken, wir wollen diese Versicherung auflösen. Da hieß es: Warte doch noch einen Moment, du bekommst doch noch ein bisschen Geld. Als ich dann im Dezember endgültig kündigen wollte, weil die Zinsen tatsächlich weiter fielen, erwartete ich eine Kommission von 100, 200 Euro. Die Frau am Telefon meinte, es seien 8000 Euro. Da brach eine Welt für mich zusammen."
Verbraucherorganisation Asufin setzt Klagewelle in Gang
Patricia Suárez arbeitete damals als freiberufliche Webdesignerin und hatte gerade ihr zweites Kind bekommen. 8000 Euro war viel Geld für die Familie. Doch schwerer als die Summe erschütterte sie die Erkenntnis, dass die Bank sie hintergangen hatte: Niemand hatte sie dort ordnungsgemäß über die Risiken aufgeklärt. Nachgehakt hatte sie allerdings auch nicht. Suárez recherchierte im Internet, stieß auf Dutzende ähnlicher Fälle. Gemeinsam mit ihrem Mann, einem Anwalt, studierte sie Gesetze zum Aktienmarkt und Währungshandel und setzte so eine Klagewelle in Gang.
"Ich sitze hier nicht, weil man mir auf der Straße die Handtasche geklaut hat – so etwas passiert -. Ich sitze hier, weil ein tragender Pfeiler des Systems, meine Bank, mich bestohlen hat! Die Bank hat das System lange beherrscht, niemand hat sich gegen sie aufgelehnt. Und die Verbraucher haben sich nicht getraut, etwas zu unternehmen."
"Wonder Woman" haben Spaniens Medien Patricia Suárez wegen ihres erfolgreichen Kampfes getauft. "Sie war schon als Kind meine liebste Superheldin", lacht Suárez, schlüpft in eine schwarze Lederjacke und braust auf ihrer Vespa durch den Madrider Vormittagsverkehr.

Patricia Suarez während der Liveshow in einem privaten Radiosender© Julia Macher
Jeden Mittag beantwortet Suárez in einem privaten Radiosender Hörerfragen zu Finanzen. Ein kurzes Schäkern mit dem Moderator, dann setzt sie sich den Kopfhörer auf und hält ein energisches Plädoyer: Klagen, klagen, klagen – und steten öffentlichen Druck ausüben. Nur dann werde sich in diesem Land irgendwann etwas ändern.
"In den USA sind alle Verantwortlichen für die Lehmann-Brothers-Pleite und für den Madoff-Skandal kalt gestellt. Keiner von ihnen wird jemals wieder in der Finanzbranche arbeiten können. Hier hat Bankia pleite gemacht und der verantwortliche Manager Rodrigo Rato hat vor seinem Gang ins Gefängnis noch bei der Bank Santander Asyl bekommen. Das System ist einfach wahnsinnig träge."
Die Krise löste in vielen Städten Massenproteste aus
Während Patricia Suárez spricht, läuft auf dem Bildschirm in der Senderegie ein Bericht von einer Großdemo der Rentner. Pensionäre, Beamte, Lehrer. Ärzte und Krankenpfleger, Studierende. Kaum ein Kollektiv, das seit Ausbruch der Krise nicht auf die Straße gegangen ist.
Einer dieser Proteste machte als "Spanische Revolution" weltweit Schlagzeilen: Am 15. Mai 2011 besetzten Tausende öffentliche Plätze. Auf der Puerta del Sol schlugen junge Leute Zelte auf, organisierten Suppenküchen und Workshops, in denen über Demokratie Wirtschafts- und Sozialreform diskutiert wurde. "System Error" oder "Wir wollen keine Ware in den Händen der Banker sein" stand auf den selbstgemachten Schildern.
Wenn Gemma Candela an die Bilder von damals denkt, beginnen ihre braunen Augen zu funkeln. Für die 32-jährige mit der halblangen Lockenmähne ist der "15 M", der 15. Mai, ein Schlüsseldatum. Die Journalistin sitzt in einem Restaurant im Norden Madrids, macht Mittagspause. Sie arbeitet in einem Büro in der Nähe, das Newsletter für große Firmen erstellt.
"Seit dem 15. Mai, dem 15 M, wird in Spanien viel mehr über Politik diskutiert. Das sehe ich an meinem Bruder, der hat früher nie über Politik gesprochen, nur über Fußball. Aber mich hat der 15 M im Ausland erwischt. Als ich die Nachrichten von den Protesten gesehen habe, wäre ich am liebsten gestorben!"
So lange hatte sie sich nach einem politischem Aufbruch gesehnt, und dann erwischte sie die "Spanish Revolution" elf Flugstunden entfernt, in Bolivien. Dorthin war Gemma 2011 mit Sack und Pack gezogen, um als Redakteurin bei einer Tageszeitung zu arbeiten. In Spanien einen solchen Job zu finden, war damals unmöglich.
300 Euro im Monat für einen Praktikantenjob
"Damals kam man bei den Medien höchstens als Praktikantin unter. Selbst wenn man wie ich mit dem Studium fertig war, hieß es: 'Studier doch noch mal was', 'mach einen Master': Einfach irgendwas, nur um wieder als Praktikantin irgendwo acht Stunden lang für 300 Euro im Monat zu arbeiten. 300 Euro! Das reicht zum Leben nicht einmal in einem Dorf, geschweige denn in Madrid. Das ist einfach lächerlich."
Die Arbeitslosenquote erreichte damals 27 Prozent, bei jungen Menschen lag sie sogar über 50 Prozent. Kein Wunder, dass rund 823.000 junge Menschen das Land verließen. Viele von ihnen sind inzwischen zurückgekehrt.
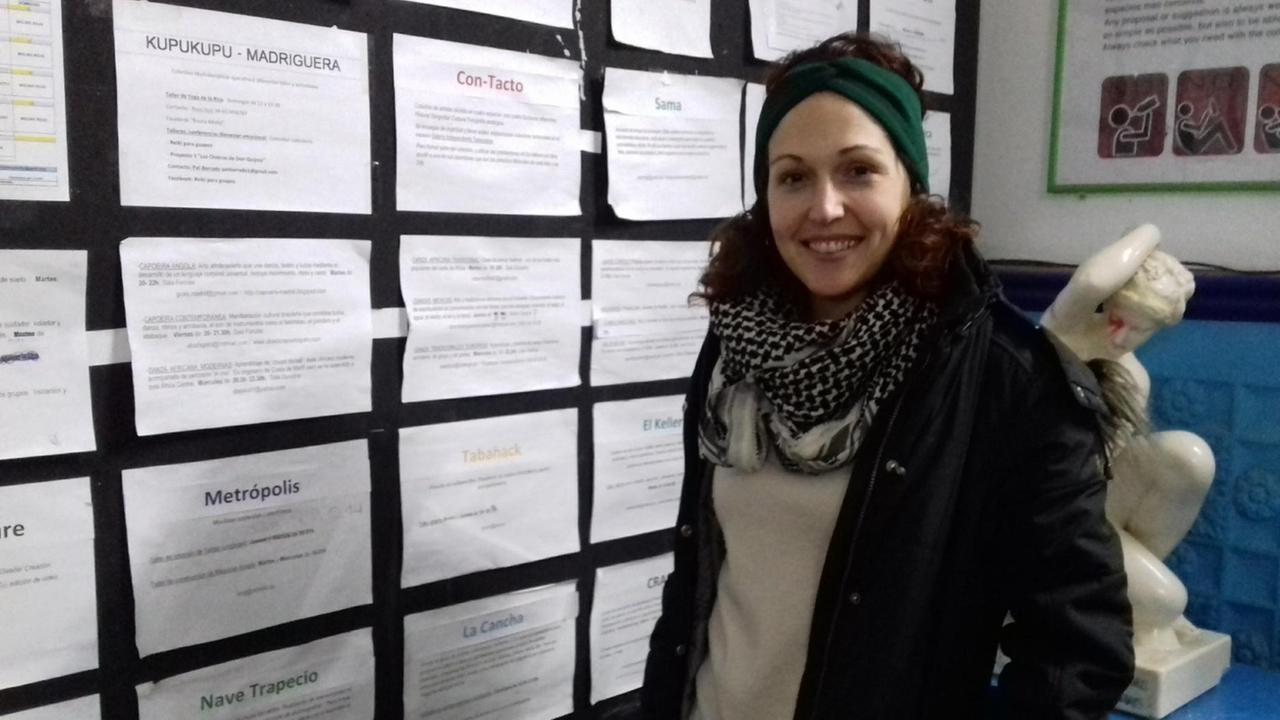
Rückkehrerin Gemma Candela vor dem Flipchart© Julia Macher
Am Abend steht Gemma Candela vor den bunt bemalten Toren einer ehemaligen Tabakfabrik und dreht sich eine Zigarette. Alle zwei Wochen trifft sie sich im alternativen Kultur-und Sozialzentrum "Tabacalera" mit anderen Rückkehrern. Eine halbe Stunde fährt Gemma dafür durch die Stadt. Der Austausch mit den anderen ist ihr wichtig.
In der kleinen Bibliothek sitzen fünf Frauen auf Flohmarktmöbeln, alle Akademikerinnen, alle um die 30. Sara, die Psychologin der Selbsthilfegruppe, schlägt vor, eine Art Diagramm zu erstellen. Um sich noch einmal gemeinsam über die Gründe des Weggangs und denen der Rückkehr klar zu werden.
Hunderttausende junge Menschen verließen das Land
Nach und nach kleben immer mehr Notizzettel auf dem zum Flipchart umfunktionierten Bücherschrank. Bei der Auswertung muss Sara schmunzeln. Bei den "Gründen, warum wir gegangen sind", steht unter der Rubrik Arbeit gleich zwei Mal: Frust.
"Ich hab noch 'Enttäuschung' dazu geschrieben. Man hat uns allen doch immer gesagt: Lernt, studiert, dann könnt ihr machen, was ihr wollt, aber das war nicht so. Die ersten Enttäuschten waren meine Eltern, aber ich auch. Wenn ich hier geblieben wäre, hätte ich wahrscheinlich bis an mein Lebensende Praktika gemacht."
Richtig wütend auf ihr Land sei sie gewesen, ergänzt Sara.
"Ich hab mich einfach nicht wertgeschätzt fühlt. Und in Argentinien fühlte ich mich wertgeschätzt - weil ich in einen Beruf hatte und dafür sogar bezahlt wurde. Dann habe ich entschlossen: Wenn mein Land mich nicht will, will ich es eben auch nicht mehr."
Bei der Auswertung der Gründe für die Rückkehr springt Gemma Sara bei.
"Zukunft, an der Seite von den meinen. Das habe ich geschrieben. Als ich damals nach Bolivien ging, war der Hauptgrund der Job. Bei der Rückkehr war mir der Job egal. Ich bin ein sehr familiärer Mensch und wollte wegen meiner Freunde und meiner Familie zurück."
Wieder zustimmendes Nicken. Heimweh, die Liebe, ein Todesfall in der Familie - das waren Gründe, zurückzukehren. Nicht das Ende der Krise. Seit 2014 wächst die Wirtschaft wieder. Doch wenn das Gespräch darauf oder auf die sinkende Arbeitslosenrate kommt, winken die Frauen müde ab: Was nutzt es, wenn es kaum Stellen gibt, von denen man leben kann? Die Arbeitsmarktreform der konservativen Regierung lässt den Unternehmen viel Spielraum für Teilzeit und Kurzarbeit. Löhne können nach Auftragslage gesenkt und Arbeitnehmer blitzschnell entlassen werden.
Die Wirtschaft wächst - trotzdem gibt es kaum rentable Jobs
Sie hätte nie erwartet, dass die Jobsuche so schwer sein würde, sagt Rocío. Nach fünf Jahren als Kulturmanagerin in Brasilien arbeitet sie jetzt für ihre ehemaligen brasilianischen Kunden als freiberufliche Übersetzerin und bereitet sich auf die Prüfungen im öffentlichen Dienst vor. Auch Sara klagt über ihre Jobaussichten:
"In Argentinien war ich Psychologin. Und hier habe ich eine Halbtagsstelle als Mediatorin – keine Ahnung, was das eigentlich ist. Ich fühle mich auf der Arbeit sehr eingeengt, kann nichts selbst entscheiden. Das ist frustrierend. Eigentlich dachte ich, dass ich – wenn ich einmal ein Niveau erreicht habe – da auch bleibe, aber stattdessen bin ich mehrere Stufen runtergerutscht."
Bei den Kommunalwahlen im Frühsommer 2015 wählten viele Bürger in Madrid, Barcelona und anderen Großstädten linksalternative Listen. "Von den Plätzen in die Rathäuser" war das Motto. Eine von denen, die heute Regierungsverantwortung tragen ist Gala Pin, Bezirksbürgermeisterin von Barcelonas Altstadt.
Die 37-jährige Frau mit den kurzen schwarzen Haaren und dem Piraten-Halstuch wirkt immer noch etwas fremd zwischen den Sicherheitsbeamten und den geschäftigen Sekretärinnen. Gemeinsam mit Barcelonas Bürgermeisterin Ada Colau hat Pin während der Krisenjahre Zwangsräumungen verhindert und das Recht auf soziale Hausbesetzungen verteidigt. Als Stadträtin muss sie sich heute mit ganz anderen Besetzern beschäftigen: der Drogen-Mafia, die die leeren Wohnungen in Narco-Pisos verwandelt, in Heroin-Verkaufsstellen und illegale Fixerstuben.
Gala Pin setzt sich an die Ecke des großen, ausladenden Tischs im Empfangszimmer. Dort saß sie auch mit den Anwohnern der Carrer Roig, mit Vertretern von der Polizei und vom Gesundheitsamt – um gemeinsam einen Notfallplan zu entwickeln. Die Stadt hat die Öffnungszeiten der städtischen Fixerstube verlängert, mehr Polizisten und Gesundheitserzieher auf Streife geschickt. Das Problem mit den Narco-Pisos besteht weiter.
"Der Richter braucht eben erst eine Reihe von Beweisen, bevor die Polizei in eine Wohnung darf – so ist das Gesetz – und dafür braucht die Polizei Zeit. Natürlich verändern die Händler ihre Methoden, das ist dynamisch. Aber immerhin bekommen wir richterliche Anweisungen jetzt schon viel schneller."
60 Prozent der leeren Wohnungen gehören Immobilienfonds
Hinzu kommt, dass die Eigentümer meist schwer zu kontaktieren sind. Gala Pin blättert in ihren Unterlagen. 60 Prozent der leerstehenden Wohnungen gehören Banken oder Immobilienfonds, mit Sitz in Steuerparadiesen. Für die ist der Wohnraum in erster Linie Spekulationsobjekt.
"Es ist doch ein Unding, dass es elf Jahre nach der Immobilienkrise die Gesetze immer noch nicht verändert wurden. Man muss doch verhindern können, dass jemand eine Wohnung kauft und dann jahrelang leer stehen lässt, noch dazu, wo so viele aus Zwangsräumungen stammen."
Sanktionieren kann die Verwaltung nur, wenn die Häuser verfallen und somit zum Sicherheitsrisiko werden.

Carlos, ein arbeitsloser Webdesigner, lädt Medien zur Narcotour© Julia Macher
Den Anwohnern des Stadtviertels Raval reicht das nicht. Sie haben die Presse zur "Narco-Tour" geladen. Vor einem schmalen grauen Haus drängeln sich etwa 60 Fernsehjournalisten, Fotografen, Reporter. Carlos, der Wortführer der kämpferischen Anwohner-Initiative, verschafft sich mit einem Megaphon Gehör.
Dieses Haus sei ein Symbol für den Kampf gegen die Narco-Pisos, sagt Carlos. Nach wochenlangem Protest und den Hinweisen der Anwohner konnte die Polizei zwei Drogenwohnungen räumen. Die soll die Presse jetzt sehen.
Im Licht der Kameras tastet sich die Menge durch das schmale Treppenhaus. Die Wände sind bekritzelt. Eine Tonne Müll haben städtische Angestellte aus beiden Wohnungen getragen. Ein Anwohner klopft stolz auf ein Stahlblech vor einer Eingangstür. Als die Dealer zwei Tage nach der Räumung zurückkehrten, haben die Nachbarn in Eigenregie Fenster zugemauert, Türen verschlossen. Die TV-Kameras schwenken auf die andere Straßenseite, filmen ein älteres Ehepaar, das mit Plastiktaschen bepackt vor der Tür wartet. Ein Sozialarbeiter beobachtet die Szene.
"Wie sie die Armut kriminalisieren", schimpft er. Zehn Jahre sind seit Beginn der spanischen Krise vergangen. Ein Rezept gegen ihre Folgen hat man immer noch nicht gefunden.






