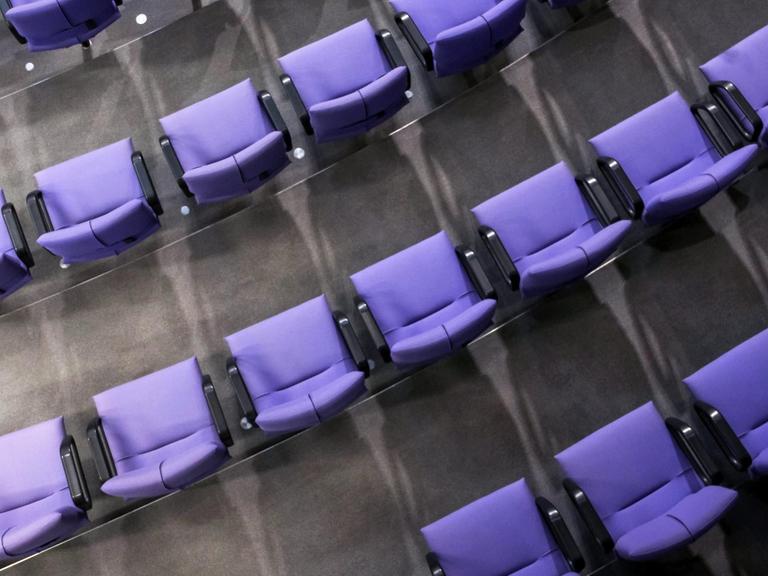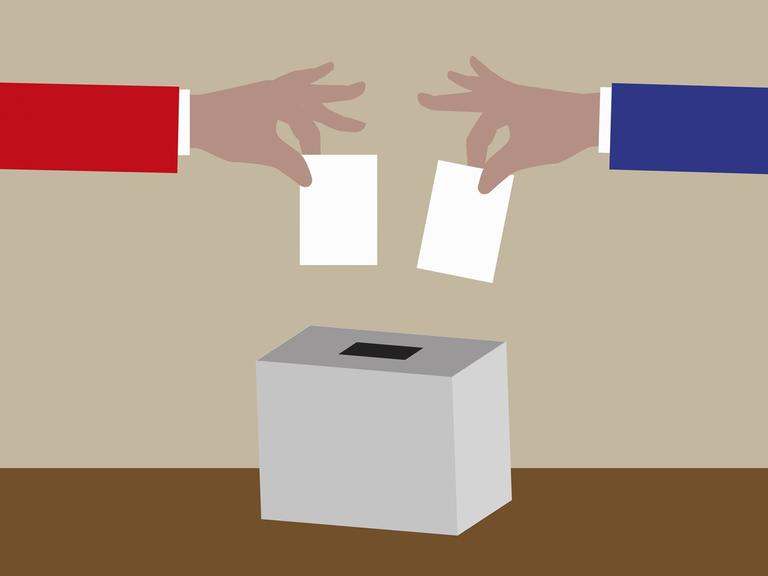Kein getreues Abbild der Bevölkerung
08:02 Minuten

Die Bundestagsabgeordneten repräsentieren in Bezug auf Bildung, Herkunft und Geschlecht keineswegs das Volk. Das hat Folgen für ihre Entscheidungen. Eine Lösung ist jedoch nicht einfach, sagt der Politikwissenschaftler Armin Schäfer.
Dieter Kassel: In Artikel 38 des Grundgesetzes steht: Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages sind Vertreter des Deutschen Volkes. Tatsache bleibt, dass viele gesellschaftliche Gruppen im Deutschen Bundestag unterrepräsentiert sind. Frauen zum Beispiel, darum ging es gestern bei einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, aber auch noch viele andere.
2013 hat der damalige Bundestagspräsident Norbert Lammert in einer Rede gesagt, die Abgeordneten seien keine Versammlung von Helden und Heiligen, sondern ein getreues Abbild der Bevölkerung. Ich würde sagen, wir ignorieren den ersten Teil, aber der zweite Teil des Satzes war falsch, oder?
Armin Schäfer: Wenn damit gemeint ist, dass das Parlament die Bevölkerung insgesamt widerspiegelt in ihrer Zusammensetzung, dann stimmt das nicht. Die Abgeordneten unterscheiden sich sehr deutlich von der Bevölkerung insgesamt.
Kassel: Wenn man sieht, dass laut der "Süddeutschen Zeitung" neben Frauen auch Behinderte, Homosexuelle, Nicht-Akademiker, Alleinstehende, Dorfbewohner, Muslime und viele andere unterrepräsentiert sind, was bedeutet das Ihrer Meinung nach für die Politik?
Nicht alle Gruppen werden gleich gut repräsentiert
Schäfer: Es gibt eine große Debatte darüber, ob man das überhaupt wünscht, dass der Bundestag oder irgendein Parlament ein Eins-zu-eins-Abbild der Bevölkerung ist. Dagegen spricht, dass es erst mal um die Idee geht, dass bestimmte Ideen, Interessen repräsentiert werden, und das erfolgt nicht automatisch dadurch, dass jemand einer Gruppe angehört.
Man kann auch Interessen einer Gruppe vertreten, der man nicht selbst angehört. Aber wir stellen schon fest, dass es eben eine Verzerrung gibt, wer im Bundestag ist, dass die Entscheidungen, die getroffen werden, auch nicht alle Gruppen gleich gut repräsentieren. Und dann kann man schon die Frage stellen, wie der Zusammenhang zwischen den Personen, die dort vertreten sind, und den Entscheidungen ist.
Kassel: Haben Sie dafür Beispiele? Sie haben gerade gesagt, dass Entscheidungen gewisse Gruppen nicht richtig repräsentieren.
Schäfer: Ein Beispiel, das in die Augen sticht, ist, dass schon lange ein großer Anteil der Bevölkerung dafür ist, dass die Vermögenssteuer wieder eingeführt wird. Und dann kann man sehen: Es gibt ganz große Unterschiede, wer dafür und wer dagegen ist.
Ärmere sind sehr stark dafür, reichere Menschen eher dagegen. Das ist ein sehr plakatives Beispiel, wo man sehen kann, es gibt Interessenunterschiede in der Bevölkerung. Und eine Entscheidung wird entweder getroffen oder nicht getroffen.
Wir haben versucht, uns das systematisch anzugucken. Wir haben über 30 Jahre, 35 Jahre Hunderte von Fragen analysiert, und da entsteht ein allgemeines Muster, dass diejenigen, denen es besser geht in der Gesellschaft, tendenziell ihre Präferenzen sehr viel besser widergespiegelt finden in den Entscheidungen des Bundestages als diejenigen, denen es schlecht geht.
Kassel: Es gab auch mal, als in den Nullerjahren sehr viel über Reformen im Gesundheitswesen diskutiert wurde, den Vorwurf, die große Mehrheit der Abgeordneten sei privat versichert. Und da haben die natürlich gesagt, wir wissen aber trotzdem, wie es in der gesetzlichen Krankenkasse zugeht. Aber ist das nicht auch ein Unterschied, ob man es weiß oder ob man persönlich damit Erfahrungen hat?
Bestimmte Berufe tauchen nicht mehr im Bundestag auf
Schäfer: Ich würde nicht sagen, man kann sich auf keinen Fall hineinversetzen, was wichtig für andere Personen ist, natürlich ist das möglich. Aber man kann sich vorstellen, wenn die Gruppe der Abgeordneten insgesamt sehr homogen und die Vielfalt nicht so groß ist, dass das dann über viele Entscheidungen hinweg eine bestimmte Schieflage erzeugt, weil man Sachverhalte bestenfalls aus zweiter Hand kennt, man muss es sich von jemandem erklären lassen – das ist bei der Krankenversicherung vielleicht noch einigermaßen naheliegend.
Bestimmte Berufe tauchen gar nicht mehr auf im Bundestag, das heißt, bestimmte Erfahrungen, die man in seinem Alltag macht, die kennen die Abgeordneten tatsächlich sehr viel weniger, so wie ich bestimmte Berufe auch nicht kenne, weil ich sie nie ausgeübt habe. Und dann kann man fragen: Was passiert mit Debatten, wenn bestimmte Perspektiven gar nicht eingebracht werden können?
Nicht alles mit einer Quote regelbar
Kassel: Aber was wäre denn das Gegenmittel? Brauchen wir eine Nicht-Akademiker-Quote, eine Alleinstehenden-Quote, eine Landbewohner-Quote, wäre das die Lösung?
Schäfer: Die Frage zeigt schon, dass das sehr schnell schwierig würde. Welche Gruppen sind das, wie viele Gruppen, wie möchte man dann überhaupt vorgehen? Ich denke, da würde man schnell an rechtliche Grenzen stoßen, wenn man das sehr kleinteilig aufteilt und sagt, für all die genannten Gruppen bräuchte man eine Quote.
Ich bin mir nicht sicher, wie weit man dabei kommt, über gesetzliche Vorschriften. Aber natürlich sehen wir, wenn wir noch einmal das Beispiel der Repräsentation von Frauen nehmen, dass es sehr große Unterschiede zwischen den Parteien gibt. Manche Parteien haben sich selbst auferlegt, eine paritätische Besetzung der Listen hinzubekommen, andere machen das nicht. Und man könnte sich natürlich schon vorstellen, dass eine breitere Debatte über Repräsentation dazu führen könnte, dass Parteien gezielter suchen, die Vielfalt gezielt erhöhen.
Kassel: Aber das funktioniert doch schon bei ganz einfachen Dingen nicht. Generell ist die Akademikerinnen-Quote sehr hoch in den Parlamenten und auch im Bundestag. Und selbst eine Arbeiterpartei wie die SPD - das diskutieren wir jetzt nicht, ob sie noch eine ist, aber sie nennt sich ja selber gern noch so - hat auch lauter Akademiker. Woher kommt das, dass man offenbar, um in Deutschland Politik zu machen, unbedingt einen Hochschulabschluss braucht?
Selektionsmechanismen in den Parteien
Schäfer: Vielleicht noch einen Satz vorab über die Wirkung: Es gibt eine Studie zu Großbritannien, die zeigt, dass, wenn keine Arbeiter mehr im Parlament sind, Arbeiter auch sehr viel seltener die dortige Labour-Partei, also das Äquivalent zur SPD, wählen.
Es gibt Selektionsmechanismen in den Parteien, wie Leute überhaupt zu einer Kandidatur kommen. Und das erfordert einiges an Ressourcen, sich im innerparteilichen Wettbewerb durchzusetzen. Die haben manche Gruppen mehr als andere.
Wenn man im Ortsverein bei bestimmten Terminen immer anwesend sein muss, dann wird das schwieriger sein für diejenigen, die sich um kranke Eltern oder ihre Kinder kümmern müssen. Aber auch die, die bestimmte Berufe haben, können das nicht so ohne Weiteres. Das ist eine Hürde.
Das andere ist, dass diejenigen, die die Auswahl treffen, häufig nach Menschen suchen, die ihnen selbst ähneln. Wenn der jetzt schon berühmte alte, weiße Mann jemanden sucht, der kandidieren soll, dann sucht er möglicherweise eben jemanden, der ihm ähnlich ist, der vielleicht studiert hat und so weiter. Diese Selektionsmechanismen sorgen für eine Schieflage bei der Frage, wer gute Chancen hat, nominiert zu werden – und damit auch in den Parlamenten zu landen.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandfunk Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.