Abschied von einem Mythos
In "Der freundliche Feind" zeigt Ebba Drolshagen, dass nicht jeder Wehrmachtssoldat ein Massenmörder oder glühender Antisemit gewesen ist. Der Autorin versucht zu ergründen, wie der ganz normale Soldat mit der ambivalenten Realität des Kriegs umgegangen ist.
"Das Kriegsende war keine Stunde null, weder in Deutschland noch in einem der befreiten Länder. Aber es setzte überall alchemistische Vorgänge in Gang, die Menschen, Handlungen und Absichten zu etwas machten, was sie vorher nicht gewesen waren. Verliebte Frauen wurden zu Landesverräterinnen, Soldaten zu Gefangenen, Gefangene zu freien Menschen. ‚Deutsche Mitläufer und Mittäter oder ausländische Kollaborateure verwandelten sich in Angehörige des Widerstands.’ Die Stunde null, die keine war, hat in den Nachkriegsmythen aller Nationen ihren Platz."
Doch der Abschied von nationalen Mythen tut weh – und manchmal passiert es, insbesondere den nach dem Krieg geborenen Deutschen, dass einem auch der Abschied von den Mythen anderer weh tut. Diente nicht die Vorstellung von den tapferen Norwegern, stoischen Kanalinselbewohnern, mutigen Holländern jahrzehntelang der Beruhigung, dass es in den damaligen Zeiten auch etwas unstrittig Gutes angesichts des unbezweifelbar Bösen gegeben hat?
Die Welt schwarzweiß zu sehen ist gewiss einfacher als ihr Grau, ihre Ambivalenzen zu ertragen. Ebba Drolshagen aber gehört hierzulande zu den Unbestechlichen, die sich in ihren Gewissheiten erschüttern lassen.
Schon ihr Buch "Wehrmachtskinder" verletzte in der Sicht vieler ein Tabu: dass diese Kinder Ergebnis einer Liebes- und keiner Gewaltbeziehung waren, dass ihre Mütter keine Huren und ihre Väter keine Kanaillen waren, schien so unendlich schwer nachzuvollziehen – denn mit dem Feind kollaborierte man nicht und erst recht ging man nicht mit ihm ins Bett.
Auch Drolshagens jüngstes Buch wird jenen nicht schmecken, die in jedem Deutschen (mit Daniel Goldhagen) einen eliminatorischen Antisemiten sehen wollen und in jedem Wehrmachtssoldaten einen Massenmörder, wie die Wehrmachtsausstellung (angeblich) gezeigt hat.
Während in diesen Debatten der Verbrecher im deutschen Soldaten dingfest gemacht wurde, geht Drolshagen den umgekehrten Weg: Sie versucht, den ganz normalen Menschen im Soldaten zu ergründen und zu beschreiben. Ihr Buch schildert die vielfältige, die schillernde, die ungemein ambivalente Realität des Krieges in seinem Alltag.
"Ich frage mich (…), ob es nicht in allen Kriegen Kontakte zwischen der besiegten Bevölkerung und den siegreichen Soldaten gegeben hat. Die Historiker und Schriftsteller haben sie vernachlässigt, weil sie ihre Berichte erbaulich und sittsam haben wollten, weil diese armseligen Details ihre allgemeine Linie stören, ihr grobes Bild verändern","
konstatierte der französische Schriftsteller Leon Werth. Das aber wollten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht nur Historiker und Politiker nicht, das, die "armseligen Details", ertrugen auch die Menschen nicht, die als Zivilisten die deutsche Besatzung – etwa in Norwegen, auf den Kanalinseln oder in Frankreich – erlebt hatten. Denn was hatten sie erlebt? Stets singende, gut aussehende junge Männer – jedenfalls zu Kriegsbeginn:
""’Die Deutschen in ihren Uniformen, mein Gott, waren das schöne Männer, wir haben unseren Augen nicht getraut’","
– eine Norwegerin.
""Sie ‚waren ungeheuer attraktiv. Einige sahen unglaublich gut aus … Die Offiziere in ihren Uniformen sahen blendend aus’"
– eine Frau von den britischen Kanalinseln. Sogar Simone de Beauvoir fand die Deutschen jung und nett – und in Paris lud man sich in besseren Kreisen junge SS- und Wehrmachtsoffiziere zum Essen ein, denn die deutsche Dynamik tue dem verstaubten Frankreich gut.
Sicher – die Soldaten verhielten sich in Frankreich und Norwegen nicht nur der eigenen Einschätzung nach überwiegend korrekt und freundlich. Sie nahmen die Wehrmacht als bessere Reiseagentur und freuten sich, wie Heinrich Böll, dass es nach Paris ging, billigen Schnaps gab und Seidenstrümpfe für die daheimgebliebenen Frauen.
Doch waren es keineswegs allein die Frauen in den besetzten Ländern, die in ihnen nicht nur den brutalen Feind wahrnahmen. Drolshagen nimmt die Frauen in Schutz, die insbesondere männlichen Beobachtern einfallen, wenn es um sie als sexuelle "Landesverräterinnen" geht. Denn es waren vor allem männliche Zivilisten, die kooperierten, wenn und weil es nützlich war:
"Ein Norweger gab 1940 seine Bäckerei auf, weil er ‚verflucht sein wollte, wenn er für die Deutschen backt’. Diese führten die Bäckerei unter eigener Regie und zur Selbstversorgung weiter. Im Mai 1945 bekam der Bäcker seinen Laden zurück – und fluchte wieder: Nicht für die Deutschen zu backen sei die dümmste Entscheidung seines Lebens gewesen. Sein schärfster Konkurrent sei durch den Krieg steinreich geworden und habe ihm außerdem die Kunden abspenstig gemacht."
Edel sein lohnt sich selten. Herrschte deshalb bei den Besetzten der schiere Opportunismus? Oder war das berechtigte Überlebenskunst?
"Weltgeschichte und Alltagstrott schließen einander nicht so kategorisch aus, wie man meinen möchte", "
konstatiert Drolshagen. Der Alltag unter der Besatzungsmacht war nicht nur Elend und Trübsal – oder gar permanenter Widerstand, Und sogar in Nachhinein konnte sich die Besetzung durch die Deutschen als Vorteil erweisen. Am Ende hinterließen die Besatzer, etwa in Norwegen, nicht nur verwüstete und ausgebeutete Landstriche, sondern ebenso Straßen, Brücken, Eisenbahnlinien, Hafenanlagen und Flugplätze.
Vor allem aber wussten Besetzte wie Besatzer zu unterscheiden, was wir heute zu unterscheiden verlernt haben: zwischen dem System und dem Individuum, oder, wie Drolshagen analysiert, zwischen den zwei Körpern der Soldaten:
""dem uniformierten Herrenmenschen und dem ‚Schützen Arsch’, dem Mitwirkenden und Mitschuldigen an den nationalsozialistischen Verbrechen einerseits, dem geschundenen Wehrpflichtigen andererseits."
Die Einblicke, die Ebba Drolshagens Buch erlaubt – gewonnen aus unzähligen Gesprächen zwischen damaligen Besetzten und damaligen Besatzern – führen in die tiefen Schichten des Kriegsgeschehens, dessen geringster Teil das Fronterlebnis ist. Drolshagen differenziert, wo andere eine schneidige These durchs Dickicht der Wirklichkeit schlagen.
Vor allem aber zeigt dieses Buch, was man gewinnt, wenn man die Ambivalenzen des gelebten Lebens dem Schwarzweiß des Mythos vorzieht – keine Revision der Geschichte, mitnichten; ebenso wenig die erneute Reinwaschung der Wehrmacht zu blütenreiner Pracht. Wie sollte das auch möglich sein? Nein, Drolshagen gibt ihren Lesern die Menschen hinter den Rollen wieder – insbesondere jene, die sich nach 1945 nicht auf der "richtigen" Seite wiederfanden, sondern bis heute im Zwielicht verharren – die Kollaborateure und Landesverräter, die "gefallenen Mädchen", die Opportunisten, die Hilflosen – und die Opfer der Selbstgerechten aller Nationen, die hinterher die Wahrheit schon immer gepachtet haben wollen. Drolshagens Buch zeugt von einem abgeklärten Mitleid mit der menschlichen Natur – und das, scheint mir, ist über 60 Jahre nach Kriegsende fürwahr befreiend.
Ebba Drolshagen: Der freundliche Feind. Wehrmachtssoldaten im besetzten Europa
Verlag Droemer/Knaur, München, 2009
Doch der Abschied von nationalen Mythen tut weh – und manchmal passiert es, insbesondere den nach dem Krieg geborenen Deutschen, dass einem auch der Abschied von den Mythen anderer weh tut. Diente nicht die Vorstellung von den tapferen Norwegern, stoischen Kanalinselbewohnern, mutigen Holländern jahrzehntelang der Beruhigung, dass es in den damaligen Zeiten auch etwas unstrittig Gutes angesichts des unbezweifelbar Bösen gegeben hat?
Die Welt schwarzweiß zu sehen ist gewiss einfacher als ihr Grau, ihre Ambivalenzen zu ertragen. Ebba Drolshagen aber gehört hierzulande zu den Unbestechlichen, die sich in ihren Gewissheiten erschüttern lassen.
Schon ihr Buch "Wehrmachtskinder" verletzte in der Sicht vieler ein Tabu: dass diese Kinder Ergebnis einer Liebes- und keiner Gewaltbeziehung waren, dass ihre Mütter keine Huren und ihre Väter keine Kanaillen waren, schien so unendlich schwer nachzuvollziehen – denn mit dem Feind kollaborierte man nicht und erst recht ging man nicht mit ihm ins Bett.
Auch Drolshagens jüngstes Buch wird jenen nicht schmecken, die in jedem Deutschen (mit Daniel Goldhagen) einen eliminatorischen Antisemiten sehen wollen und in jedem Wehrmachtssoldaten einen Massenmörder, wie die Wehrmachtsausstellung (angeblich) gezeigt hat.
Während in diesen Debatten der Verbrecher im deutschen Soldaten dingfest gemacht wurde, geht Drolshagen den umgekehrten Weg: Sie versucht, den ganz normalen Menschen im Soldaten zu ergründen und zu beschreiben. Ihr Buch schildert die vielfältige, die schillernde, die ungemein ambivalente Realität des Krieges in seinem Alltag.
"Ich frage mich (…), ob es nicht in allen Kriegen Kontakte zwischen der besiegten Bevölkerung und den siegreichen Soldaten gegeben hat. Die Historiker und Schriftsteller haben sie vernachlässigt, weil sie ihre Berichte erbaulich und sittsam haben wollten, weil diese armseligen Details ihre allgemeine Linie stören, ihr grobes Bild verändern","
konstatierte der französische Schriftsteller Leon Werth. Das aber wollten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht nur Historiker und Politiker nicht, das, die "armseligen Details", ertrugen auch die Menschen nicht, die als Zivilisten die deutsche Besatzung – etwa in Norwegen, auf den Kanalinseln oder in Frankreich – erlebt hatten. Denn was hatten sie erlebt? Stets singende, gut aussehende junge Männer – jedenfalls zu Kriegsbeginn:
""’Die Deutschen in ihren Uniformen, mein Gott, waren das schöne Männer, wir haben unseren Augen nicht getraut’","
– eine Norwegerin.
""Sie ‚waren ungeheuer attraktiv. Einige sahen unglaublich gut aus … Die Offiziere in ihren Uniformen sahen blendend aus’"
– eine Frau von den britischen Kanalinseln. Sogar Simone de Beauvoir fand die Deutschen jung und nett – und in Paris lud man sich in besseren Kreisen junge SS- und Wehrmachtsoffiziere zum Essen ein, denn die deutsche Dynamik tue dem verstaubten Frankreich gut.
Sicher – die Soldaten verhielten sich in Frankreich und Norwegen nicht nur der eigenen Einschätzung nach überwiegend korrekt und freundlich. Sie nahmen die Wehrmacht als bessere Reiseagentur und freuten sich, wie Heinrich Böll, dass es nach Paris ging, billigen Schnaps gab und Seidenstrümpfe für die daheimgebliebenen Frauen.
Doch waren es keineswegs allein die Frauen in den besetzten Ländern, die in ihnen nicht nur den brutalen Feind wahrnahmen. Drolshagen nimmt die Frauen in Schutz, die insbesondere männlichen Beobachtern einfallen, wenn es um sie als sexuelle "Landesverräterinnen" geht. Denn es waren vor allem männliche Zivilisten, die kooperierten, wenn und weil es nützlich war:
"Ein Norweger gab 1940 seine Bäckerei auf, weil er ‚verflucht sein wollte, wenn er für die Deutschen backt’. Diese führten die Bäckerei unter eigener Regie und zur Selbstversorgung weiter. Im Mai 1945 bekam der Bäcker seinen Laden zurück – und fluchte wieder: Nicht für die Deutschen zu backen sei die dümmste Entscheidung seines Lebens gewesen. Sein schärfster Konkurrent sei durch den Krieg steinreich geworden und habe ihm außerdem die Kunden abspenstig gemacht."
Edel sein lohnt sich selten. Herrschte deshalb bei den Besetzten der schiere Opportunismus? Oder war das berechtigte Überlebenskunst?
"Weltgeschichte und Alltagstrott schließen einander nicht so kategorisch aus, wie man meinen möchte", "
konstatiert Drolshagen. Der Alltag unter der Besatzungsmacht war nicht nur Elend und Trübsal – oder gar permanenter Widerstand, Und sogar in Nachhinein konnte sich die Besetzung durch die Deutschen als Vorteil erweisen. Am Ende hinterließen die Besatzer, etwa in Norwegen, nicht nur verwüstete und ausgebeutete Landstriche, sondern ebenso Straßen, Brücken, Eisenbahnlinien, Hafenanlagen und Flugplätze.
Vor allem aber wussten Besetzte wie Besatzer zu unterscheiden, was wir heute zu unterscheiden verlernt haben: zwischen dem System und dem Individuum, oder, wie Drolshagen analysiert, zwischen den zwei Körpern der Soldaten:
""dem uniformierten Herrenmenschen und dem ‚Schützen Arsch’, dem Mitwirkenden und Mitschuldigen an den nationalsozialistischen Verbrechen einerseits, dem geschundenen Wehrpflichtigen andererseits."
Die Einblicke, die Ebba Drolshagens Buch erlaubt – gewonnen aus unzähligen Gesprächen zwischen damaligen Besetzten und damaligen Besatzern – führen in die tiefen Schichten des Kriegsgeschehens, dessen geringster Teil das Fronterlebnis ist. Drolshagen differenziert, wo andere eine schneidige These durchs Dickicht der Wirklichkeit schlagen.
Vor allem aber zeigt dieses Buch, was man gewinnt, wenn man die Ambivalenzen des gelebten Lebens dem Schwarzweiß des Mythos vorzieht – keine Revision der Geschichte, mitnichten; ebenso wenig die erneute Reinwaschung der Wehrmacht zu blütenreiner Pracht. Wie sollte das auch möglich sein? Nein, Drolshagen gibt ihren Lesern die Menschen hinter den Rollen wieder – insbesondere jene, die sich nach 1945 nicht auf der "richtigen" Seite wiederfanden, sondern bis heute im Zwielicht verharren – die Kollaborateure und Landesverräter, die "gefallenen Mädchen", die Opportunisten, die Hilflosen – und die Opfer der Selbstgerechten aller Nationen, die hinterher die Wahrheit schon immer gepachtet haben wollen. Drolshagens Buch zeugt von einem abgeklärten Mitleid mit der menschlichen Natur – und das, scheint mir, ist über 60 Jahre nach Kriegsende fürwahr befreiend.
Ebba Drolshagen: Der freundliche Feind. Wehrmachtssoldaten im besetzten Europa
Verlag Droemer/Knaur, München, 2009
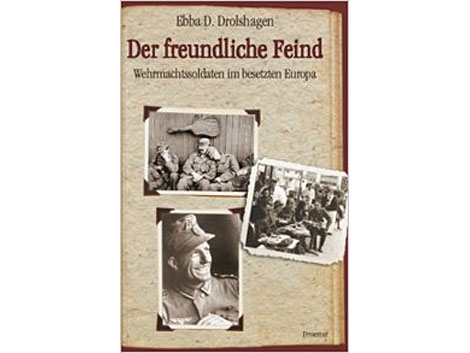
Ebba Drolshagen: Der freundliche Feind© Verlag Droemer/Knaur
