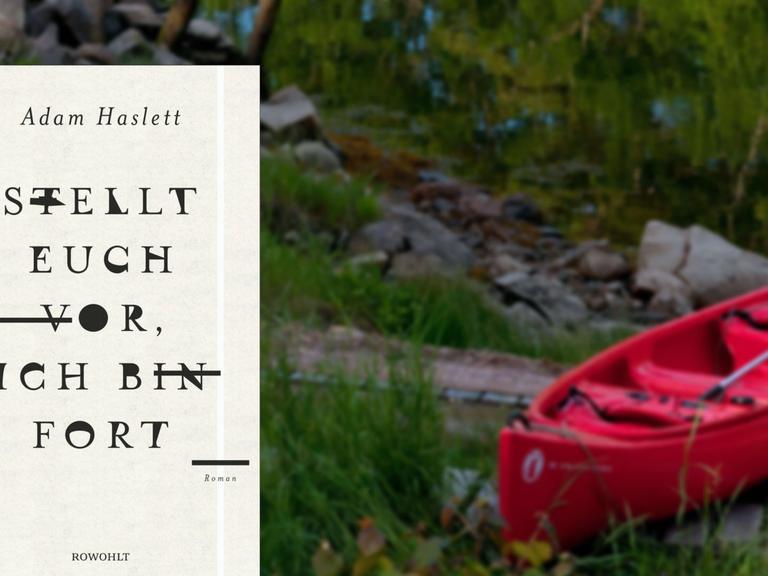Adam Haslett: "Stellt euch vor ich bin fort"
Roman
Aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren
Rowohlt, Reinbek 2018
460 Seiten, 23,00 Euro
Der Familienroman, das persönlichste Buch

Eine fünfstimmige Familienaufstellung und ein lichtsaugendes Rüsselmonster: Adam Haslett spricht im Interview darüber, wie er mit seinem dritten Roman den Freitod seines Vaters und dessen Auswirkungen auf den Rest der Familie verarbeitet hat.
Frank Meyer: Soweit ich weiß, ist das das dritte Buch, das Sie veröffentlicht haben, und Sie haben dazu gesagt, es sei ganz sicher Ihr persönlichstes Buch. Inwiefern ist es denn Ihr persönlichstes Buch?
Adam Haslett: Ja, es ist definitiv mein persönlichstes Buch. Ich habe mir bei meinem dritten Roman die Freiheit genommen, meine eigene Familiengeschichte mehr einzubeziehen. Der Hintergrund ist, dass sich mein Vater umgebracht hat, als ich 14 Jahre alt war. Ich musste mir erst mal die Erlaubnis erteilen, auf diese eigene Familiengeschichte zurückzugreifen, mir ebenso die Erlaubnis erteilen, Dinge zu verändern, umzuschichten, fiktionale Elemente mit hineinzubringen, damit es ein Roman ist und vielmehr als nur eine autobiografische Geschichte.
Das lichtsaugende Rüssel-Monster
Meyer: Sie haben Ihr Buch in Berlin zu schreiben begonnen. Sie waren hier zu Gast in der American Academy. Mit welcher Szene oder mit welcher Stimme hat denn das Buch für Sie begonnen?"
Haslett: Die erste Szene, die ich im Kopf hatte, die ist heute am Ende des Buches. Das ist das Treffen dieser beiden Brüder in einer Hütte. Da hatte ich aber noch gar nichts geschrieben. Ich wusste nur, diesen Weg musste ich gehen, um zu dieser Szene zu kommen, und dann hatte ich auch schon die Szene, die jetzt der Anfang ist, mit der Mutter, die die Kinder zu dem Vater bringt. Das waren die ersten Sachen, die ich im Kopf hatte. Hier in Berlin habe ich aber was anderes geschrieben, nämlich die Szene mit dem Vater, was, wie sich dann später herausstellt, der letzte Tag seines Lebens werden wird, wo er sich von der Familie verabschiedet, ohne, dass klar wird, dass es sich hier schon um einen definitiven Abschied handelt.
Meyer: Dieser Familienvater in Ihrem Roman, John, der hat drei Kinder, der hat seine Frau, eine Familie, eigentlich ein Netz, das ihn im Leben halten könnte, aber offenbar… Ist das Netz nicht stark genug für ihn oder ist die Krankheit zu stark in ihm? Warum geht er fort?
Haslett: Diese Metapher, die ich da benutze, mit diesem Biest oder diesem Monster, das ist der innere Kampf, den er austrägt. Ich habe versucht, das zu dramatisieren, als würden hier zwei ganz unterschiedliche Charaktere gegeneinander kämpfen. Einmal zieht das Monster ihn total runter, und er versucht, sich von diesem Monster zu befreien, und die absolute Freiheit, die besteht einfach nur darin, dass er sein eigenes Leben beendet. Das Problem mit Depressionen ist, wenn man sie von außen betrachtet, ganz rational, dann kann man immer Gründe finden, für dieses oder jenes, was doch funktioniert und dass doch alles hätte viel schlimmer kommen können. Wenn man aber die Welt durch die Augen eines Betroffenen sieht, dann können diese rationalen Argumente nichts bewirken, weil sie einfach ein ganz anderes Gewicht haben.
Meyer: Sie beschreiben dieses Ungeheuer einmal, wenn ich das richtig erinnere, als Ungeheuer, das seinen Rüssel in den Kopf des Kranken hineinsenkt und alles Licht heraussaugt, das auf irgendeinem Weg in diesen Kopf hineinkommt oder dort ist. Wie haben Sie so ein Bild gefunden, um das Monster zu beschreiben?

Adam Hasletts dritter Roman "Stellt euch vor, ich bin fort" war in den USA für den Pulitzer-Preis und den National Book Award nominiert.© Rowohlt; Imago/McPHOTO
Haslett: Das ist schwer zu sagen. Ich versuche herauszufinden, wie lebt man in dem Kopf eines anderen. Mit Sprache, mit den Sätzen, mit der Konstruktion von Sprache. Bei jeder Figur – und in diesem Fall war es John –, versuche ich einen gewissen Rhythmus beizubehalten. Ich suche dafür eine gewisse Melodie, eine gewisse Musik, die sich natürlich bei allen Figuren unterscheidet. Bei diesem Bild, da war es die Gewalt, diese ungeheure Gewalt, die davon ausgeht, wenn man sich das vorstellt, dass einem aus dem Hinterkopf sozusagen alles Licht herausgesaugt wird.
Kampf mit Depressionen
Meyer: Der Tod des Vaters, der Selbstmord des Vaters, das ist eine Art Ausgangspunkt für Ihren Roman. Vor allem erzählt Ihr Buch ja davon, wie die drei Kinder von John und Margaret nach dem Tod des Vaters weiterleben, aber mit der immer noch anwesenden Krankheit. Einer der Söhne, Michael, hat, ganz ähnlich wie der Vater, mit Depressionen zu kämpfen. Die anderen beiden Kinder aber nicht. Ist das jetzt reiner Zufall der Biologie oder gibt es andere Gründe dafür, dass die Kinder so verschieden betroffen sind von der Krankheit des Vaters?
Haslett: Das ist eine sehr gute und auch gleichzeitig eine sehr schwierige Frage. Einerseits gibt es die Lebensumstände, in denen man steckt, andererseits gibt es auch ein gewisses Glück, vielleicht der Biologie… Michael hatte wahrscheinlich die schwierigste Beziehung zu seinem Vater. Er hat den Verlust als das älteste Kind wahrscheinlich am stärksten empfunden und fühlt sich in einer gewissen Weise verantwortlich für die Familie, ohne zu wissen, wie er das machen soll. Ich versuche mit diesem Buch oder generell eigentlich nicht so eine Draufsicht zu haben, wie ein Verleger. Wenn es um psychische Krankheiten geht, die auch soziale Ursachen haben können, versuche ich, dem Leser eine Art Innenansicht zu vermitteln, dass er sich selber damit befasst.
Meyer: Was Sie dieser Figur, Michael, mitgegeben haben, und die Erfahrung, die man auch als Leser mit ihm macht: er vertieft sich geradezu exzessiv in die Geschichte der Sklaverei, der Afroamerikaner, und manchmal scheint es, als wolle er sich selbst dieses ganze Leid aller Opfer von Kolonialismus, von Rassismus auf seine eigenen Schultern laden. Hängt das zusammen mit seiner Krankheit, ist das eines seiner Symptome?
Haslett: Auch hier sind die Dinge wieder relativ kompliziert. Man kann da keine sehr leichte Rechnung aufstellen. Michael ist sehr sensibel, und er ist sensibel für sehr viele Leiden in der Welt. Er nimmt das durch die Musik auf, er selber schreibt Musik, er ist auch jemand, der spürt, dass in der Musik dieses Trauma der Sklaverei fortgeführt wird, aber, wie Sie es selber schon gesagt haben, er identifiziert sich eben auch. Am Ende des Buches redet er auch davon, dass es ja eigentlich eine verbotene Identifikation ist, weil er sein persönliches Leid in gewisser Weise auf das Leid der Welt überträgt. Diese Komplexität, die war mir schon sehr, sehr wichtig. Er sieht die Geschichte und Geschichte sieht auf ihn. Das hat aber auch viel damit zu tun – und das war mir auch wichtig auszudrücken –, wie weiße Amerikaner mit diesen Ideen der weißen Vorherrschaft umgehen.
Verstehen, wie eine Familie funktioniert
Meyer: Dieses Kranksein von Michael, in meiner Wahrnehmung, schildern Sie das auch als etwas Dominierendes, Raumgreifendes, vielleicht Aggressives, was die anderen in seiner Familie angeht, weil sie ständig damit beschäftigt sind, sich zu fragen, wie geht es Michael? ist er in Gefahr? Braucht er Zuspruch? Braucht er Geld? Das ist ein großes Thema. Würden Sie denn sagen, dass in seinem Fall die Depression, auch so etwas Aggressives hat?
Haslett: Ja, in gewisser Weise ist das schon ansteckend. Aber deswegen versuche ich auch, diese Geschichte aus fünf verschiedenen Blickwinkeln zu erzählen, mit diesen fünf verschiedenen Stimmen. Was ich damit möchte ist, dass der Leser versteht, wie eine Familie funktioniert. Auf der einen Seite will die Familie, die Michael ja wirklich liebt, ihm wirklich helfen. Aber wenn man gerne helfen möchte, ist es oft so, dass man die Person, der man helfen will, so sieht, wie man sie gerne hätte oder wie sie idealerweise sein sollte. Einerseits, will die Familie Michael helfen, andererseits wird er zum Objekt dieser Hilfe. Das verzerrt diese Hilfe, obwohl sie gut gemeint ist. Ich glaube, das kann ich durch fünf verschiedene Blickwinkel ganz gut, ausdrücken.
Meyer: Dieses Geflecht aus fünf Stimmen, das ist etwas ganz Besonderes an der Form Ihres Familienromans, gerade auch, wenn man auf andere Romane dieser Art schaut, wo es dann oft einen Erzähler gibt, der auf das ganze Geflecht draufschaut, der von oben von verschiedenen Menschen erzählt. Bei Ihnen sprechen die fünf tatsächlich selbst zu einem, auch in ihren eigenen Stimmen, in ganz verschiedenen interessanten Formen, manchmal Briefe, Protokolle, Erzählungen von sich. Warum war das, dieses Erzählen von innen heraus, warum war das für Sie die beste Form für das, was Sie erzählen wollten?
Für einen Standpunkt braucht man Erfahrung
Haslett: Wenn man einen Standpunkt haben will, braucht es ja eine gewisse Erfahrung. Diese Erfahrung kann man aber nur haben, wenn man so tief in die Person eindringt, dass man sich als Leser diese Erfahrung aneignen kann. Das hätte mit einer dritten Person oder mit einer Art allwissendem Erzähler eben nicht funktioniert, weil wir einen Schritt herausgemacht hätten aus dieser Erfahrung. Familien funktionieren ja auf ganz vielschichtige Art und Weise. Es ist ja nicht immer so, dass nur das zählt, was diese Person gesagt hat oder ob jene Person anwesend ist. Es geht ja auch um Personen, die gar nicht mehr anwesend sind oder die vielleicht gar nicht mehr leben. Und dann passiert so etwas, dass man sich gewisse Familiengeschichten imaginiert, dass man sie ausbaut, man sie in der Geschichte gerne hätte. Diese imaginierte Familiengeschichte, die hat mich interessiert.
Meyer: Diese fünf Stimmen zeigen, wie verschieden die Leute auch sind, von denen Sie erzählen, diese fünf Familienmitglieder. Es heißt aber an einer Stelle des Romans, `wir sind keine Individuen´. Die Lebenden suchen uns ebenso heim wie die Toten. Sehen Sie das denn so? Sind wir in dem Sinne keine Individuen, dass wir unseren Familien einfach nicht entkommen können?
Haslett: Ich glaube ja. Das habe ich ja gerade schon versucht, ein bisschen zu erläutern. Mit dieser imaginierten Familien, die einfach in uns lebt, wie wir über Familie nachdenken, wenn diese Familienmitglieder gar nicht da sind oder sogar schon gar nicht mehr leben. Das, finde ich, ist eine gewisse Heimsuchung. Was ich mit `wir sind nicht mehr Individuen´ meine, hängt einfach damit zusammen, dass ja auch unser soziales Umfeld letztendlich eine Rolle spielt und wir eine Beziehung zu Menschen haben, die nicht nur aus dem Zusammenleben erwächst. Dann kommt es zu dieser Illusion, dass wir meinen, es gäbe keine Abhängigkeiten, aber diese Abhängigkeiten gibt es.
Der Familienroman in der US-amerikanischen Nachkriegsliteratur
Meyer: Jetzt haben Sie einen Familienroman geschrieben in einer sehr besonderen, interessanten Form. Familienroman, das ist ja ein ganz starkes Genre in der US-amerikanischen Literatur. Da kann man an Jonathan Franzen denken oder an Jonathan Safran Foer. Können Sie uns eigentlich erklären, warum in den USA so viele starke Familienromane geschrieben werden?
Haslett: Vielleicht hat das alles mit Thomas Manns "Buddenbrooks" angefangen oder mit Dostojewskis "Die Brüder Karamasow". Im Nachkriegsamerika sind viele in die Vororte gezogen. Da hat man sich dann eben auf die Kernfamilie konzentriert, weil man nicht mehr in so großen Gemeinschaften gelebt hat. So wurde diese Kernfamilie, bestehend dann aus zwei Generationen, sehr, sehr wichtig. Das ist eine Erklärung, die ich jetzt finden könnte, warum der Familienroman in der Nachkriegsliteratur in den USA ein so starkes Genre ist. Aber ich hatte ja eingangs erwähnt, das dies mein persönlichstes Buch war. Diese Geschichte musste aus mir heraus, und dieser Impuls war viel stärker, als die Überlebung, in welchem Genre ich das verorte.