Adam Przeworski: "Krisen der Demokratie"
Aus dem Englischen von Stephan Gebauer
Suhrkamp Verlag, Berlin 2020
256 Seiten, 18 Euro
Ein moderat pessimistischer Blick auf die Gegenwart
06:07 Minuten
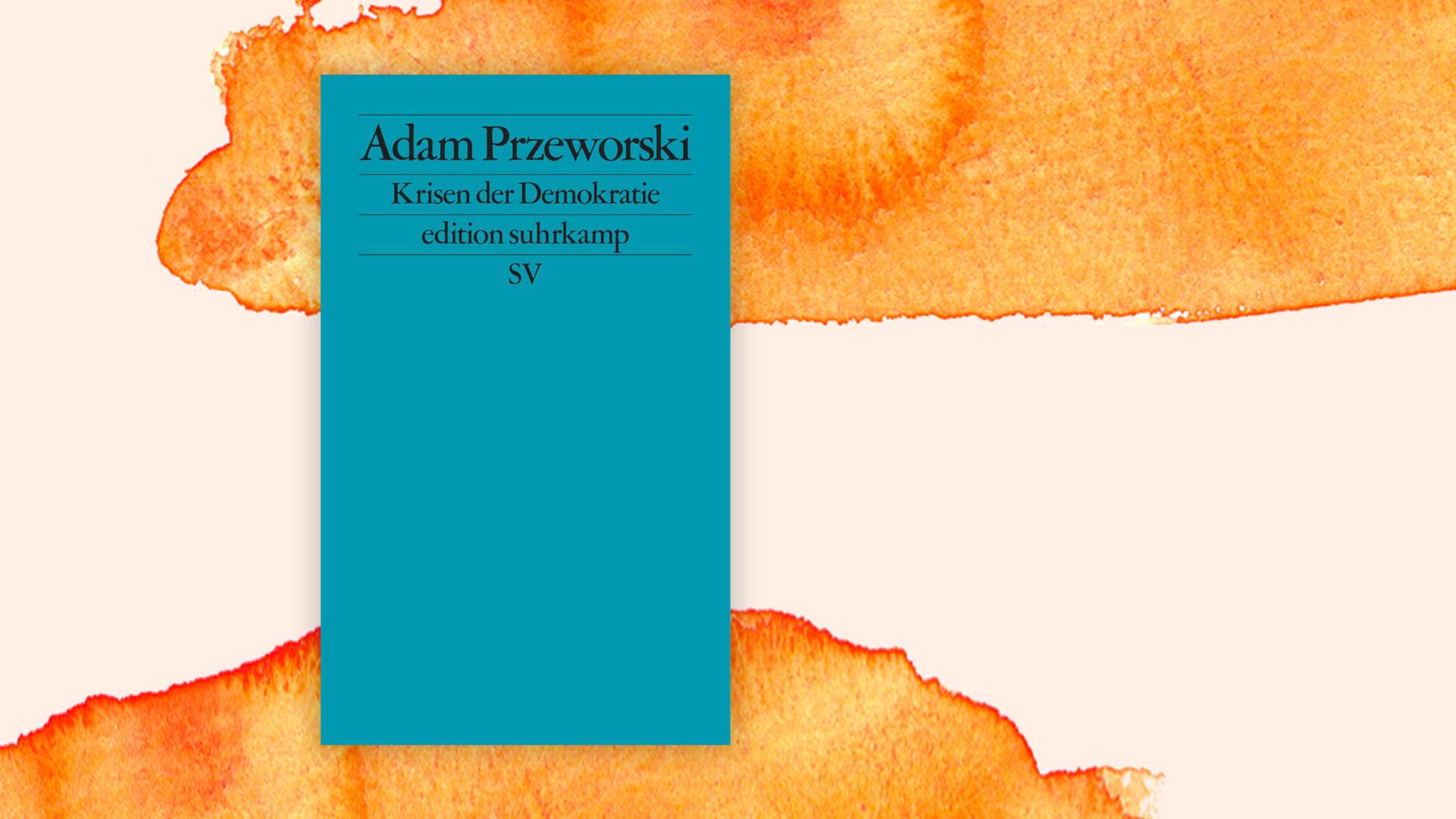
In seinem Sachbuch „Krisen der Demokratie“ schaut sich der Politologe Adam Przeworski historische Zusammenbrüche von Demokratien an und stellt die alte Frage: Was können wir überhaupt aus der Geschichte lernen?
Die Demokratie befindet sich in der Krise: Das ist eine weitverbreitete Gegenwartsdiagnose. Viele Menschen fühlen sich von demokratisch gewählten Parlamenten nicht mehr vertreten; rechtspopulistische Parteien gewinnen an Zulauf; es wächst die Sehnsucht nach starken Führerfiguren. Politiker wie Trump, Orbán und Erdoğan höhlen die Institutionen aus – die Gewaltenteilung, das Wahlsystem, die freie Presse –, um die eigene Macht zu sichern und zu vergrößern.
Befinden wir uns in einem Epochenwandel, am Ende des demokratischen Zeitalters? Oder handelt es sich bloß um eine vorübergehende Irritation in der Jahrhunderte währenden Erfolgsgeschichte der Demokratisierung der Welt?
Ein System organisierter Unsicherheit
Das sind die Fragen, die der in New York lehrende Politologe Adam Przeworski in seinem neuen Buch "Krisen der Demokratie" stellt. Er findet darauf keine abschließenden Antworten. Aber er sortiert in überaus erhellender Weise die Probleme, von denen wir reden.
Erst einmal müsse man die Begriffe klären: "Was ist eine Demokratie? Was ist eine Krise?" Für Przeworski sind die einfachsten Definitionen die besten: Eine Demokratie ist eine Regierungsform, in der man die Macht gewinnen und wieder verlieren kann; und in der die Verlierer von Wahlen sich mit ihrem Schicksal abfinden, weil sie die Perspektive haben, beim nächsten Mal wieder zu den Gewinnern zu gehören.
Es handelt sich also um ein "System organisierter Unsicherheit". Doch je länger dieses etabliert ist – das zeigt sich beim Blick in die Geschichte –, desto größeres Gefallen gewinnen die Menschen an dieser Unsicherheit; desto größer ist die Chance einer Demokratie auf dauerhaftes Überleben.
Was muss also geschehen, damit die Krise dieser Staatsform so existenziell wird, dass sie zusammenbricht? Das untersucht Przeworski an historischen Beispielen, insbesondere dem Ende der Weimarer Republik und dem Militärputsch in Chile 1973.
In beiden Fällen endete die Demokratie, weil die Institutionen nicht stark genug waren, um die gesellschaftlichen Risse zu kitten. In Deutschland war der Machtwechsel aber gerade nicht das Resultat eines Putsches, sondern vollzog sich entlang formal korrekt eingehaltener demokratischer Prozeduren.
Darin findet sich eine Entsprechung zur Gegenwart: Wo immer sich derzeit demokratische in autoritäre Staaten verwandeln – etwa in Polen, Ungarn und der Türkei –, geschieht dies nicht mit Putschen und mit Gewalt. Vielmehr wird die Verwandlung schleichend vollzogen, mit einer Kette von Maßnahmen, die jede für sich nicht bedrohlich wirken, im Endeffekt jedoch auf die Abschaffung der Demokratie zielen.
Schleichender Zerfall
Diese Diagnose gleicht jener, die zuletzt David Runciman in seinem Buch "So endet Demokratie" aufstellte. Runciman zog daraus einen gewissen Optimismus: Wenn selbst autoritäre Politiker sich auf die Spielregeln der Demokratie einlassen, statt sie gewaltsam zu beseitigen, zeige dies doch die langfristige Überlegenheit dieser Staatsform.
Adam Przeworski kann diesen Optimismus nicht teilen: Denn die schleichende Abschaffung der Demokratie mache es für deren Verteidiger nur umso schwerer, Gegenwehr zu organisieren.
Dass heute eben nicht mehr klar zu bestimmen sei, an welcher Stelle eine Demokratie in eine Diktatur umschlage, trage wesentlich zu ihrer Krise bei. Schließlich sei auch der wirtschaftliche Fortschrittsoptimismus erschöpft, der lange Zeit dazu half, das "System organisierter Unsicherheit" für die Mehrheit der Menschen attraktiv zu machen: Wer sich um den Verlust des eigenen ökonomischen und sozialen Status sorge, der sei eher dazu bereit, demokratische Freiheit gegen autoritäre Sicherheitsversprechen zu tauschen.
Przeworski ist, wie er selber schreibt, "moderat pessimistisch". Doch vor allem ist er ein nüchterner und analytischer Denker, der seine Argumente mit großen Mengen empirischer und statistischer Daten belegt und gleichwohl immer wieder betont, dass sich aus der Geschichte keine eindeutigen Lehren für die Gegenwart und die Zukunft ziehen lassen.
So skeptisch und so transparent argumentiert Przeworski, dass man ihm beim Lesen gleichsam beim Nachdenken und Abwägen zuhört und sich dazu ermuntert fühlt, das historische Material selber zu überprüfen und zu interpretieren. "Krisen der Demokratie" ist der Idealfall eines politischen Essays, nach dem man die Gegenwart klarer sieht als zuvor – oder zumindest auf andere Weise verwirrend findet.




