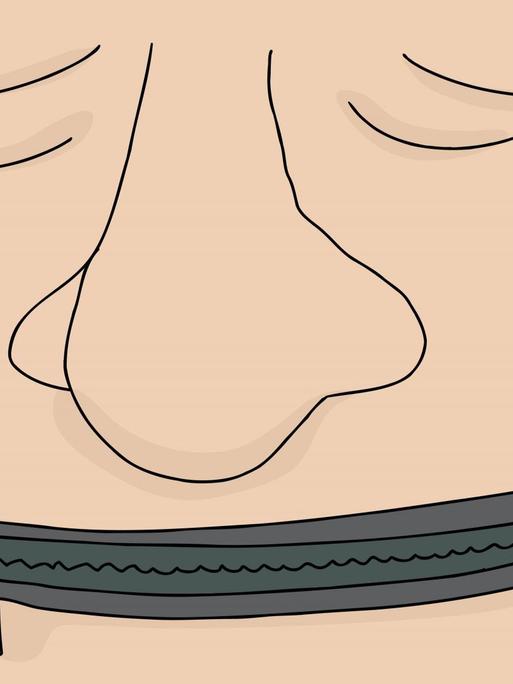Nils Markwardt ist leitender Redakteur des "Philosophie Magazins". Als Autor schreibt er daneben unter anderen auch für "Zeit Online", "FAZ" und das Schweizer Online-Magazin "Republik".
Zurück zur Sache, Schätzchen
04:35 Minuten

Wir sollten endlich darüber reden! Diese Forderung hört man derzeit häufig, nicht nur in der viel kritisierten #allesdichtmachen-Kampagne. Verlieren wir da nicht den Blick für die Sachen selbst? Das fragt Nils Markwardt in seinem Kommentar.
Vor etwa drei Jahren bemerkte der Philosoph Peter Sloterdijk in einem Interview mit der "Neuen Zürcher Zeitung", die Debatten der Gegenwart kämen ihm "wie ein aus dem Ruder gelaufenes Luhmann-Seminar" vor. Schließlich hätten wir es überall nur noch mit "Beobachtungen zweiter Ordnung zu tun, Beobachtungen von Beobachtungen von Beobachtungen".
Oder kurz gesagt: "Die Zeit der schlichten Meinungsäußerungen ist vorüber." Die #allesdichtmachen-Debatte hat jüngst verdeutlicht, wie Recht Sloterdijk damit hatte.
Reden übers Reden
Führt man sich den Verlauf der von Jan Josef Liefers und Co. losgetretenen Kontroverse vor Augen, fällt nämlich auf: Ähnlich wie viele andere Debatten unserer Zeit bewegte sich diese sehr schnell von ihrem eigentlichen Kern, der Pandemiepolitik, hin zu einem anderen, auf zweiter Ebene befindlichen Thema, dem Reden über Pandemiepolitik.
Oder in der Terminologie des Soziologen Niklas Luhmann gesprochen: Es ging nicht mehr um Beobachtungen erster Ordnung, also um Was-Fragen, sondern um Beobachtungen zweiter Ordnung, also um Wie-Fragen.
Nimmt man stellvertretend das Video von Liefers, so enthält schon dieses eine Beobachtung zweiter Ordnung. In seinem Beitrag geht es nicht darum, was er konkret an der Pandemiepolitik falsch findet, sondern er polemisiert vielmehr, dass die vermeintlich einmütigen und regierungstreuen Medien diese Politik zu unkritisch beobachten würden.

Lasst uns reden, sagt Nils Markwardt - aber bitte nicht nur über das Reden der anderen.© Johanna Ruebel
Dass er von Anfang an diese zweite Ebene wählte, mag auch damit zu tun haben, dass seine konkreten Kritikpunkte an der Politik in den Folgeinterviews ziemlich vage blieben: Irgendwie mehr abwägen, mehr Modellprojekte, mehr Transparenz. Vornehmlich drehten sich all die Anschlussdiskussionen dann jedoch um den erfolgten Shitstorm, also um die Twitter-Beobachtung von Liefers Beobachtung von journalistischen Beobachtern.
Nun ist an Beobachtungen zweiter Ordnung an sich natürlich überhaupt nichts falsch. Im Gegenteil: Fast jede Form wissenschaftlicher oder journalistischer Analyse arbeitet mit ihnen. Nur werden Beobachtungen höherer Ordnung dann zum Problem, wenn sie in selbstreferenziellen Dauerschleifen festhängen und der politische Diskurs dementsprechend zu einer Art Möbiusband aus Meta-Einlassungen mutiert.
Der permanente Appell
Das zeigt sich etwa dann, wenn der wiederkehrende Talking Point von dauerpräsenten Medienmenschen darin besteht, dass man doch mal über ein Thema sprechen müsse, über das eigentlich schon die ganze Zeit gesprochen wird. Oder genauer: Anstatt im Sinne einer konkreteren Gesprächsgrundlage einmal auszuführen, wie sich die Infektionszahlen besser in Schach halten ließen oder welche "Kollateralschäden" man für Öffnungen bereit wäre, in Kauf zu nehmen, hört man oft Appelle, eben diese Fragen doch mal zu diskutieren.
Sicher: Diesen Beobachtungsschleifen zu entkommen, ist nicht leicht. Das zeigt schon dieser Kommentar, der auch eine Meta-Beobachtung von Meta-Beobachtungen ist. Ein Grund dafür liegt im Wesen der Kommunikation selbst. Denn Kommunikation erzeugt immer Anschlusskommunikation. Oder aufmerksamkeitökonomisch formuliert: Die Debatte must go on! Dennoch gibt es vielleicht Möglichkeiten der Rückbesinnung auf das eigentliche Thema, auf die erste Ordnung der Beobachtung.
Sex: immer freitags
Niklas Luhmann gab in einem Interview einmal ein Beispiel für die Fallstricke von Beobachtungen zweiter Ordnung. Ein Ehepaar konnte sich nicht darüber verständigen, wann es Sex haben wollte. Denn jeder beobachtete zu sehr den anderen. Nach dem Motto: Ich will ja, aber nur wenn du willst, worauf die Antwort folgte, dass man auch wolle, aber nur, wenn der andere wirklich wolle, sodass am Ende keiner mehr wusste, wer was will.
Die Lösung dieses Problems, so Luhmann, bestand dann in der Maßgabe "immer freitags". Deshalb ein Vorschlag zur Güte: Vielleicht könnte man auch bei politischen Debatten an einem Tag der Woche mal wieder zum Kern zurückkommen. Über den genauen Tag ließe sich freilich debattieren.