Amira Ben Saoud: "Schweben"
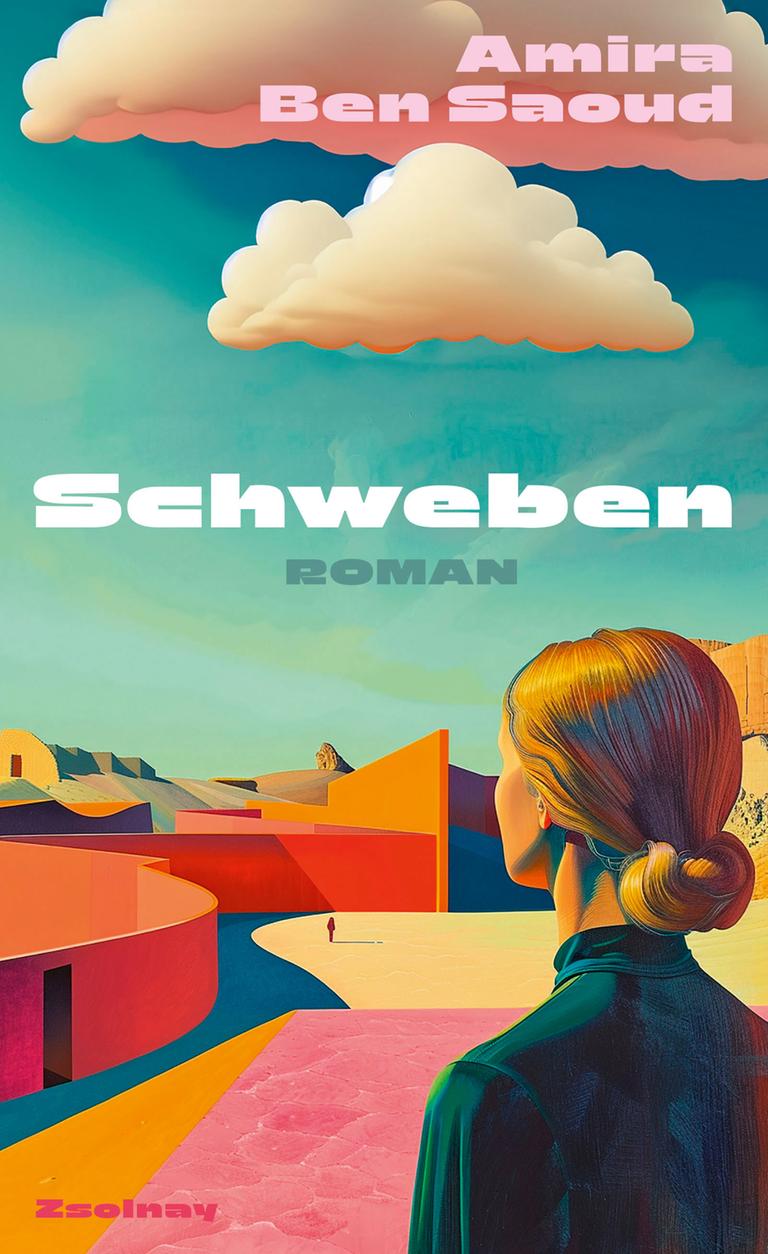
© Hanser
Die neuen Siedler
05:02 Minuten
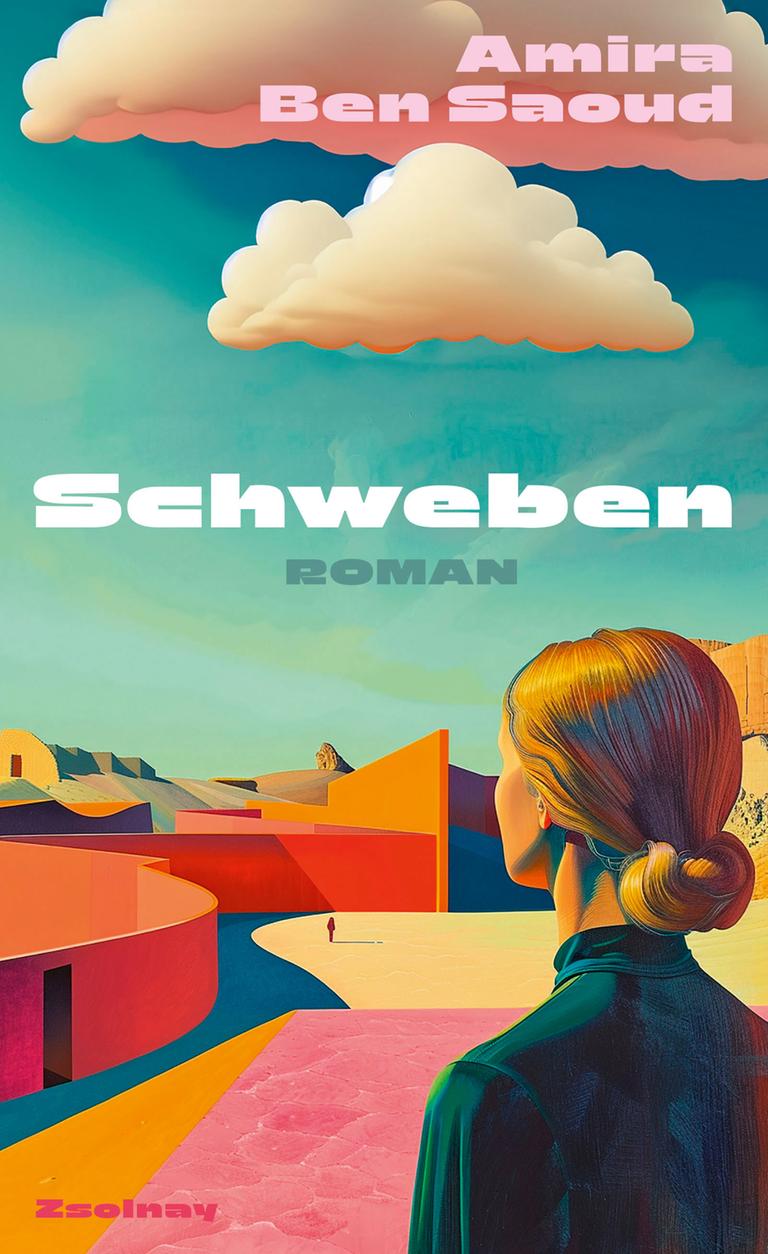
Amira Ben Saoud
SchwebenHanser, Berlin 2025192 Seiten
23,00 Euro
In ihrem Debüt wagt die österreichische Autorin Amira Ben Saoud einen Blick nach vorne - in eine Zukunft nach den Katastrophen. In autarken Siedlungen leben kleinere Gesellschaften nach archaischen Regeln. Aber eine junge Frau begehrt dagegen auf.
Gewalt war mal. Das ist die Vorgabe des sogenannten Systems. Dieses herrscht in einer Zukunft nach der ökologischen Katastrophe über eine Siedlung, die größtenteils autark ist. Eine Frau in ihren Dreißigern lebt dort. Zu Beginn von Amira Ben Saouds Debütroman „Schweben“ heißt sie Ona, dann wird sie zu Emma. Erst spät erfährt man ihren wahren Namen.
Ihr Metier besteht darin, andere Frauen zu mimen, um den Auftraggebern eine vergangene familiäre oder eheliche Beziehung vorzugaukeln. Es ist ein existenzielles Schauspiel, das eine für die Figur tiefe, für den Leser wenig überraschende Wahrheit birgt: Die Protagonistin weiß weder, wer sie ist, noch, wer sie sein möchte.
Revolte in der Siedlung
Gewalt war mal: Das bleibt der fromme Wunsch des autoritären Systems. Jugendbanden prügeln sich, Leichen werden entlang der Siedlungsgrenze verscharrt, Vergewaltigungen verleugnet und Abtreibungen, die es nicht geben darf, heimlich vorgenommen. Währenddessen bringt ein Auftrag die Ich-Erzählerin an ihre Grenzen. Zugleich bahnt sich eine Liebesbeziehung an, die ihr Leben auf den Kopf stellen könnte.
Schließlich kommt es zu Unruhen. Etwas Unmögliches geht vonstatten: Menschen beginnen zu schweben. So lassen sie den tristen Boden der Tatsachen hinter sich, auf das Risiko hin, abzustürzen und zu sterben.
Getragen von einem neuen Wind
In „Schweben“ folgt auf die Dystopie also die Allegorie – eine Flucht, eine Rettung ins Bild und dessen vage interpretatorische Weiten: „Zwar würde ich immer weiter aufsteigen“, heißt es zum Schluss, „aber ich würde nicht erfrieren und dann vom Himmel fallen wie ein Hagelkorn. Nein, der Wind würde mich langsam in die Richtung einer anderen Siedlung tragen.“
Wieso aber sollte es in der angesteuerten Siedlung besser sein? Diese ist wahrscheinlich wie die alte, nur mit anderen archaischen Regeln und anderen Menschen, die von derselben Katastrophe gezeichnet sind. Saoud bindet ihr Erzählen nämlich so eng an ihre Hauptfigur, um diese aus patriarchalen Zwängen zu befreien, dass ihr wenig Raum bleibt, um über das System zu schreiben, ja um ihre Romanwelt ästhetisch zu beleben und zu differenzieren.
Nichts Neues aus der Zukunft
So zieht man am Ende von „Schweben“ eine ernüchternde Bilanz: Auch in dieser Zukunft bleibt es schleierhaft, wie man sich aus politischen und sozialen Zwängen befreit. Dieser Ideenlosigkeit begegnet „Schweben“ mit einem suggestiven Bild, das abrupt mit der vorherigen konventionellen Erzählweise bricht.
Während eine Person in höchste Höhen davonschwebt, bleiben die anderen ratlos zurück. Aus der Liebschaft wurde keine Liebe, die die Menschen aus ihren Einsamkeiten holt, aus der Randale keine Revolution, die tragfähig wäre. Jeder und jede bleibt für sich – und alles irgendwie beim Alten. Eine Zukunftsvision kann nicht trostloser sein.




