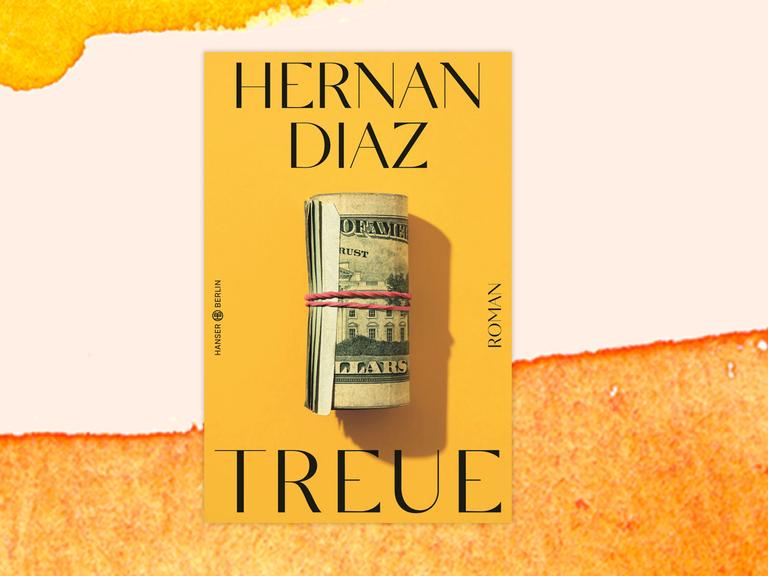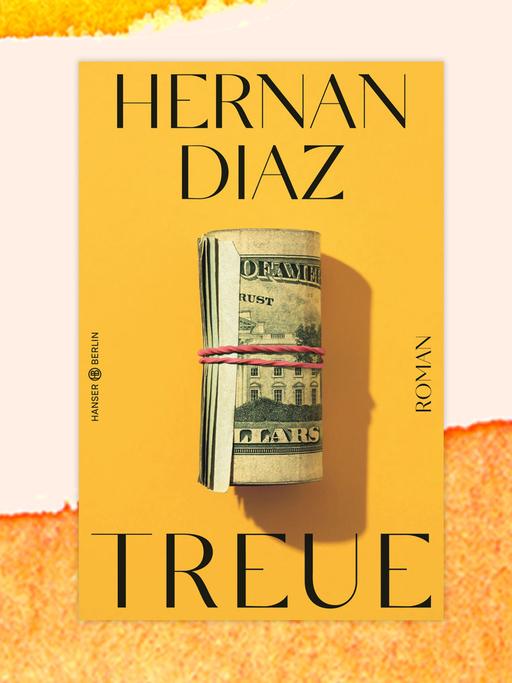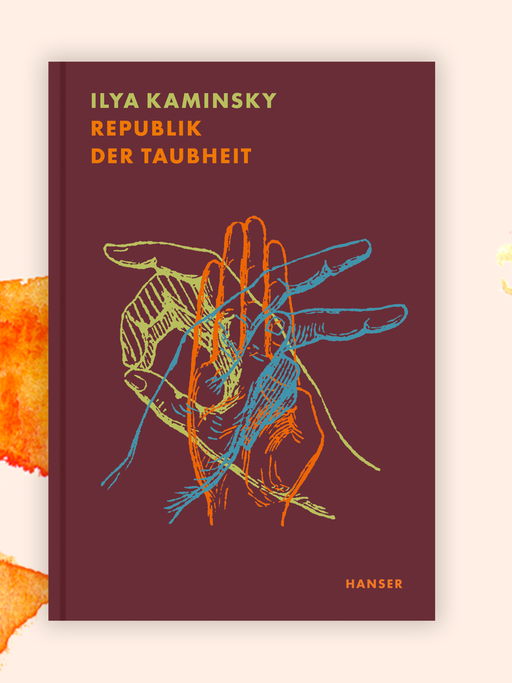Amor Towles: "Lincoln Highway"
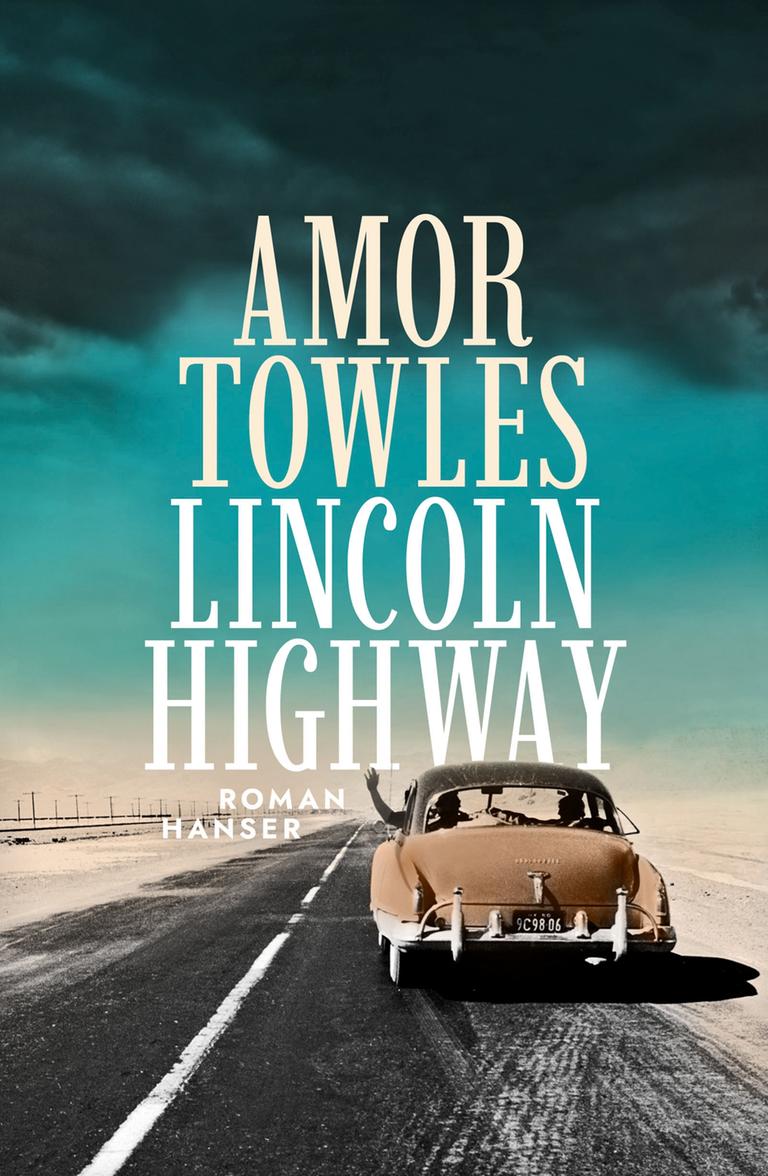
© Hanser
Freundlicher Americana-Realismus statt Faulkner-Imitat
05:39 Minuten
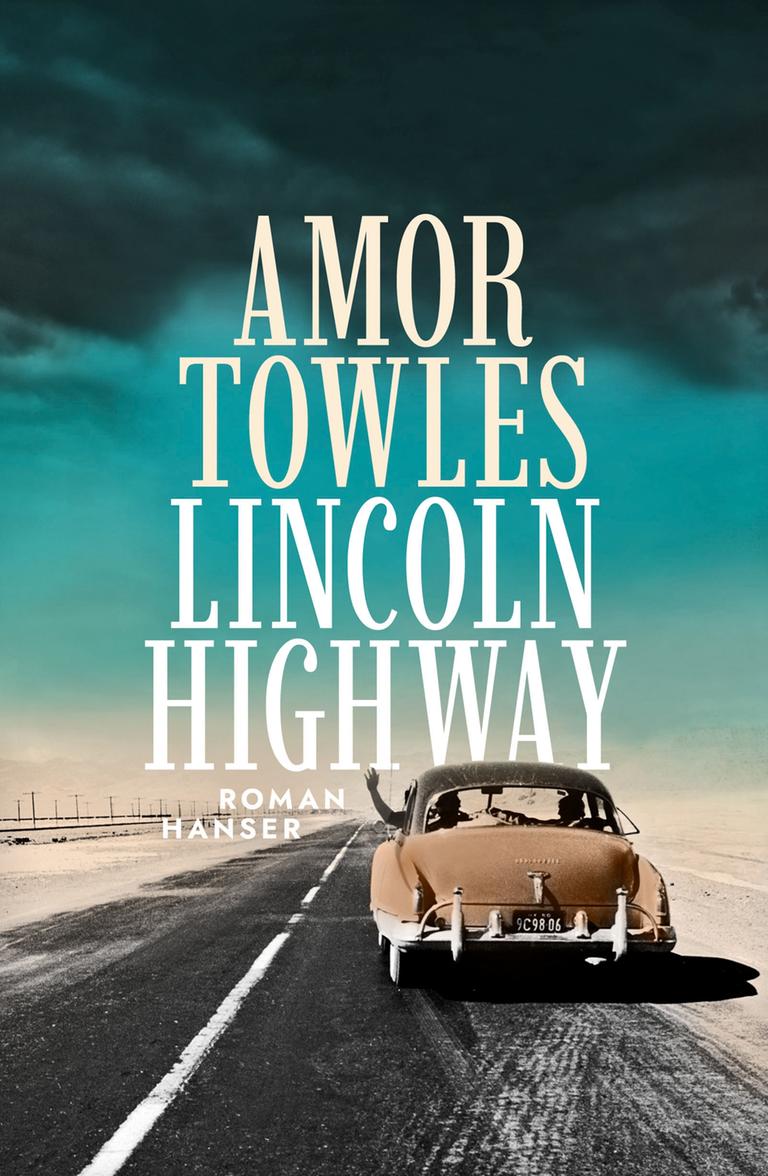
Amor Towles
Susanne Höbel
Lincoln HighwayHanser, München 2022576 Seiten
26,00 Euro
Eben aus der Jugendstrafanstalt entlassen, folgt Emmett dem Traum vom besseren Leben. Bestseller-Autor Amor Towles setzt zum großen USA-Roman über die 1950er-Jahre an. Doch vieles bleibt oberflächlich, und auch die Übersetzung stolpert.
“Im Vaudeville kommt es vor allem auf das Setup an”, weiß einer der Erzähler in dem Roman “Lincoln Highway”, und meint damit shakespearetreu nicht nur Bühnenunterhaltung, sondern das ganze Leben: nur die Erwartungen wecken, die man auch erfüllen kann, und dabei niemanden enttäuschen.
Amor Towles nun hat viele Erwartungen zu erfüllen: nicht nur, weil sein letzter Roman “Ein Gentleman in Moskau” einer der größten Erfolge des letzten Jahrzehnts in jenem unsteten Genre war, das sich mit “ernsthafte Unterhaltungsliteratur mit künstlerischem Anspruch ohne Eso-Kram” umschreiben lässt. Sondern auch, weil “Lincoln Highway” das Publikum schon früh wissen lässt, eine Great American Novel über die 1950er sein zu wollen.
Ein Sohn kommt nach Hause
Der 18jährige Emmett Williams hat für Totschlag etwas über ein Jahr in einer Besserungsanstalt verbracht und kehrt zum Familienhaus in Nebraska zurück. Die Mutter ist lange verschwunden, der gerade verstorbene Vater hat die Familie in den Ruin getrieben, das Haus gehört jetzt der Bank. Emmett will mit seinem kleinen Bruder Billy ein neues Leben beginnen, vielleicht in Kalifornien, von wo aus ihre Mutter vor acht Jahren zum letzten Mal eine Postkarte geschickt hat.
Die Faulkner-Tradition scheint klar, und gerade in Übersetzungen haben immer wieder Romane großen Erfolg, die von ihm das rau-ländliche Setting, die unterschiedlichen Erzählstimmen und eine grobe Gewalttat im Kern der Geschichte übernehmen. Aber – vielleicht von Anfang an geplant, vielleicht, weil der eher sanftmütige Autor Towles nicht anders kann: Schnell wird deutlich, dass statt Faulkner-Imitat eher freundlicher Americana-Realismus auf dem Fahrplan steht.
Aufbruch ins schöne neue Leben
Die jungen Brüder werden von Duchess und Woolly überrascht, zwei Mitgefangenen, die Emmetts Abfahrt aus der Besserungsanstalt genutzt haben, im Kofferraum zu fliehen. Zusammen hecken die Jungen einen unklaren Plan aus, der sie nicht nur mit Zug und Auto nach New York bringen, sondern auch reich machen soll.
Viel oder gar wendigen Plot gibt es trotz der Countdown-Struktur der Kapitel nicht, auch in den Weg geworfene Handlungshindernisse oder gelegentlich aufblitzende Gewalt stellen letztlich keine große Bedrohung da. Was an Trauma zu Beginn in der Luft hängt, verweht bald, übrig bleibt charmante, redselige Melancholie. Keine der Figuren sagt etwas mit einem Wort, wenn es sich auch mit fünf sagen lässt (für eine von ihnen ist ein Thesaurus sogar ein emotional stark aufgeladenes Übergangsobjekt aus der Kindheit), in den Registern zwischen Groschenroman, Theaterschwulst und Nummernrevue, mit gerade genug Augenzwinkern.
Teile der Übersetzung straucheln
Es ist ein Roman des Sprechens und der Sprache, und somit eine besondere übersetzerische Herausforderung. Susanne Höbel ist für die definitive deutsche Übertragung von Faulkners “Licht im August” verantwortlich. Entsprechend gelungen sind die Kapitel aus Sicht des bibeltreuen Nachbarmädchens Sally oder eines sinistren Predigers. Aber beim Herzstück des Romans, den vom explosiven und sich anbiedernden Duchess erzählten Kapiteln, einem Holden Caulfield mit Gewaltproblem, strauchelt die Übersetzung etwas zu oft, im Tonfall, aber auch in den umgangssprachlichen Details.
Die Klinge eines Theaterdolchs wird als “eine echte McCoy” beschrieben, als ob “the real McCoy” eine Messerfirma sei und keine Redewendung, die hier einfach nur bedeutet, dass man mit dem Dolch auch wirklich zustechen kann. Und aus der eingangs zitierten Vaudeville-Weisheit wird das beinah unverständliche “im Varieté kommt es ganz auf das Arrangement an”.
Der Roman traut sich wenig
Das ist schade, denn natürlich lebt ein Roman wie “Lincoln Highway” von solchen Details und Bezügen, von Filmzitaten oder auch Markennamen. Wenn eine dieser Marken inzwischen nicht mehr existiert, lässt das kurz an amerikanischen Abstieg denken, aber dann geht die verrückte Reise schon weiter. Rassismus, Armut, Imperialismus: Der Roman streift diese Themen nur wie ein Finger den Namen einer unbeliebten Stadt auf der Landkarte.
Am Ende geht es dann doch in die Tiefe, buchstäblich. Amerika, so Towles, ist kein Highway, keine Zugstrecke, auch kein Fluss, wie ihn Huckleberry Finn, der spirituelle Ahne der Figuren, entlang gepaddelt ist. Amerika ist ein wildes Meer. Trotzdem, oder deswegen, traut sich das Buch nur in Sichtweite der Küstenwache zu schwimmen.