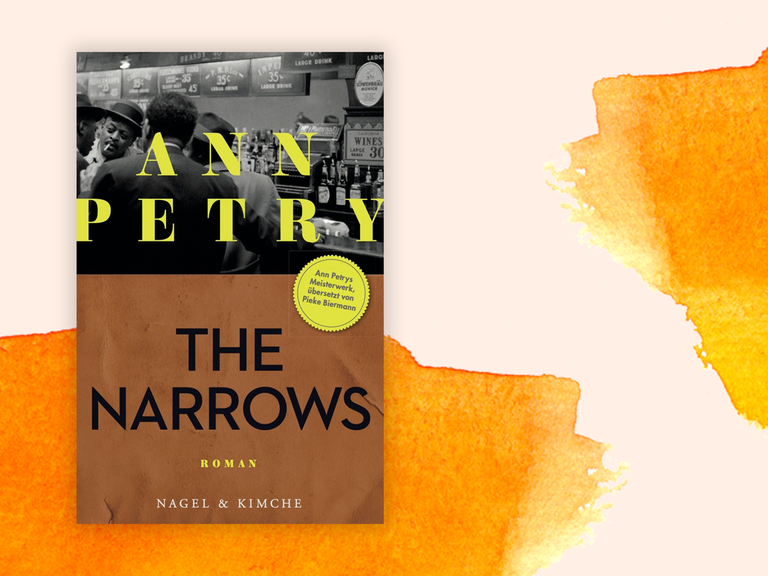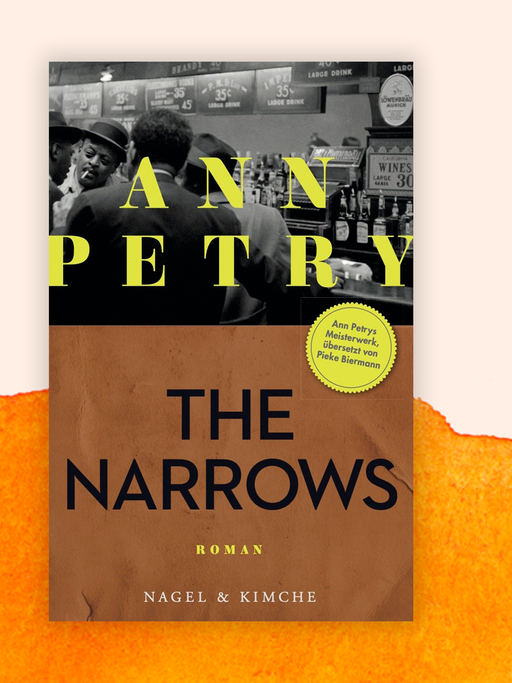Anna Kim: „Geschichte eines Kindes“
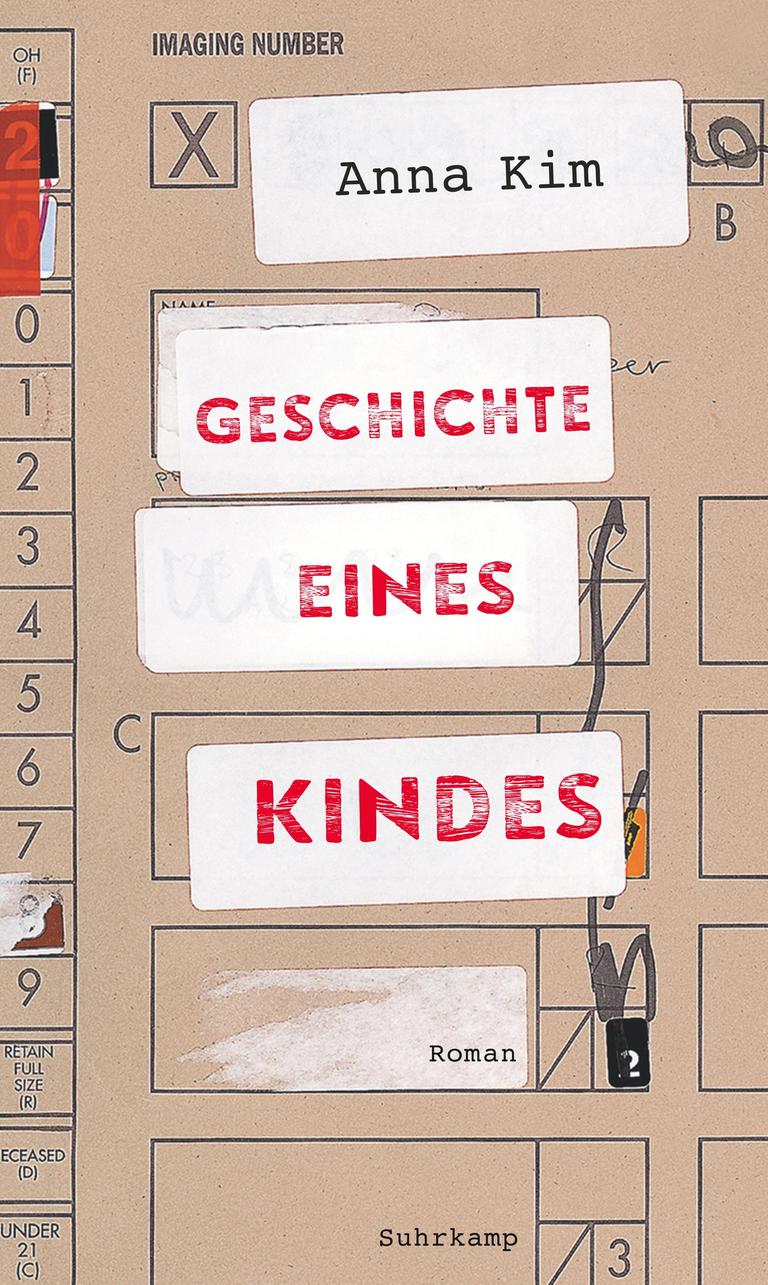
© Suhrkamp Verlag
Ein Leben lang fremd
06:51 Minuten
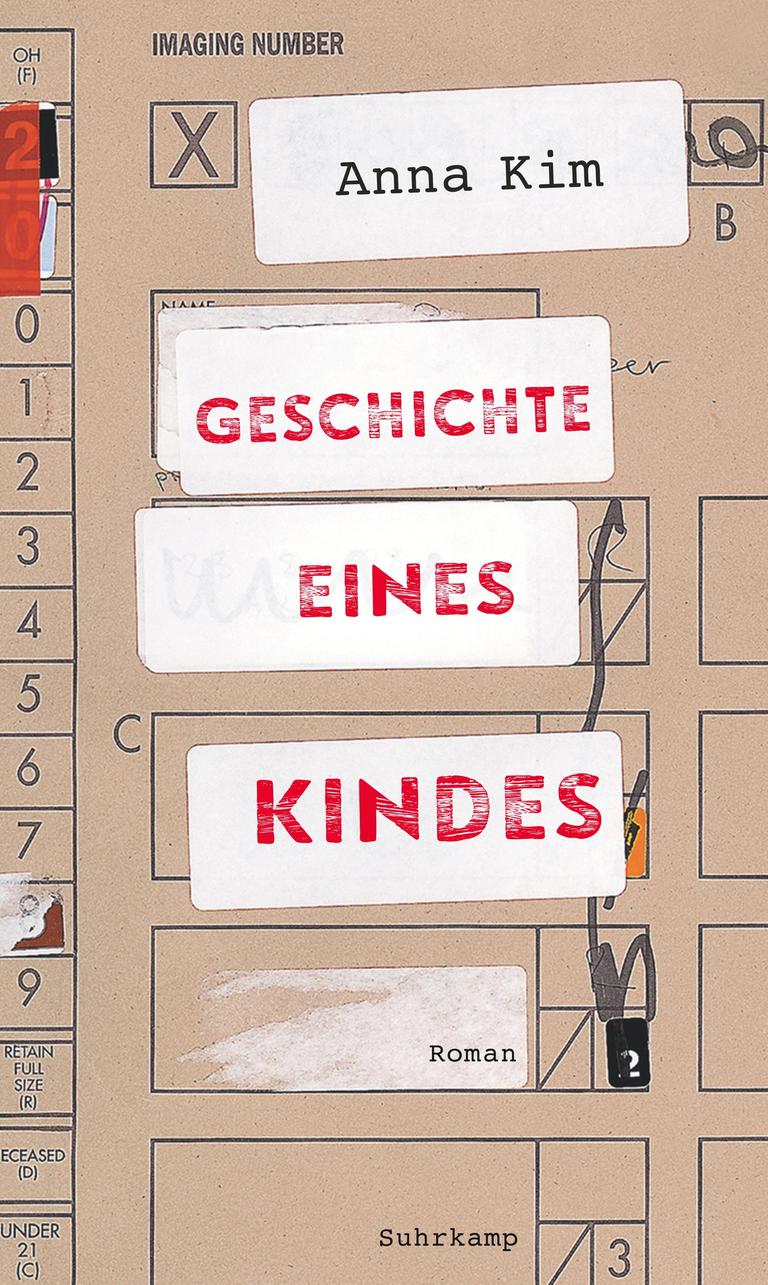
Anna Kim
Geschichte eines KindesSuhrkamp, Berlin 2022220 Seiten
23,00 Euro
Rassismus und Fremdzuschreibungen können ein Leben so beschädigen, dass es nicht mehr als das eigene wahrgenommen wird. Anna Kim schreibt einen Roman über Menschen als Objekte und über fehlende Mutterliebe - philosophisch und abwechslungsreich.
Die Autorin Anna Kim kennt aus eigener Erfahrung das Gefühl, von einer Mehrheitsgesellschaft, vom Blick der anderen definiert zu werden. 1977 in Südkorea geboren, kam sie mit ihrer Familie nach Deutschland, dann nach Österreich.
Sie galt als Exotin unter den Ausländern, dann als Person mit Migrationshintergrund, heute als Autorin of colour. „Racial Profiling“ kennt sie aus ihrem Alltag. Und genau das ist Thema ihres neuen Romans.
Zwei Geschichten
Zwei Haupterzählstränge verknüpft sie miteinander. Da ist zum einen Franziska, Autorin aus Österreich, Tochter eines deutschen Vaters und einer südkoreanischen Mutter.
Franziska erhält ein Stipendium in den USA. Sie verbringt die Wintermonate während Obamas zweiter Amtszeit als Präsident in Green Bay, Wisconsin. Zur Untermiete wohnt sie bei Joan Truttman, einer älteren Dame, deren Ehemann nach einem Schlaganfall im Pflegeheim ist. Nun wohnen die beiden Frauen gemeinsam in einem Haus, dessen „Gestaltungsprinzip die Stille war“.
Zuerst genießt Franziska diese Stille, doch immer häufiger verwickelt ihre Vermieterin sie in Gespräche. Denn ihr Mann Daniel ist Sohn einer weißen Mutter und eines afroamerikanischen Vaters. Und Joan erkennt sofort auch in Franziska die „Asiatin“: „Sie musterte mich misstrauisch. Den Wurzeln entkomme man nicht – ich sei doch gemischt, oder?“
Rassistische Verwaltungssprache
Franziska ist Anna Kims Icherzählerin, die Geschichte von Daniel Truttman lässt sie vor allem anhand von Akten Form annehmen. 1953 geboren, gab ihn seine Mutter sofort zur Adoption frei. Die Erzdiözese Green Bay kümmerte sich um das Kind.
Die verantwortliche Sozialarbeiterin stammte aus Österreich, sie war geprägt von der Wiener Schule der Anthropologie, die in den 1930er-Jahren Menschen „vermaß“, die „Schädelkapazität“ mithilfe von Senfkörnern berechnete und versuchte, die „Rassenseele“ zu bestimmen.
Besessen versucht sie, den Vater des kleinen Daniel zu finden. Dessen Namen will die Mutter nicht preisgeben. Sie behauptet steif und fest, es sei kein Schwarzer – gleichwohl die „Untersuchungen“, von der Sozialarbeiterin detailliert protokolliert, genau das nahelegen.
Anna Kim begibt sich mit der Geschichte des Kindes Daniel tief in die rassistische Geschichte der USA, deren Wurzeln weit zurückreichen und heute noch aktuell sind. Es entsteht das Bild eines überaus begabten Kindes, das aufgrund der herrschenden Gesellschaftsstruktur von Beginn an kategorisiert wird und kaum eine Möglichkeit hat, zu sich zu kommen, das sich als Erwachsener im Spiegel ansieht und einen Fremden darin erblickt.
Abwesende Mütter
Dass Anna Kim diese Geschichte parallel zu der ihrer Icherzählerin erzählt, ist ein geschickter, gleichwohl nicht gänzlich geglückter Zug. Über Daniel wird gesprochen, er selbst kommt kaum zu Wort, seine Geschichte schreiben andere.
Franziska hingegen reflektiert ihre Situation, sie definiert sich selbst. Und ist doch auch immer wieder mit Fremdzuschreibungen konfrontiert. Hin und wieder gibt es in den Biografien dieser beiden unterschiedlichen Menschen Berührungspunkte. Am stärksten bei den Schilderungen des Verhältnisses zu ihren Müttern, die sich ihrem Kind verweigern.
Anna Kim versucht auf sprachlich unterschiedlichen Ebenen, mehrere Themen zu umkreisen. Das ist oft scharfsinnig und berührend. Umso stärker spürbar sind dadurch aber manche Leerstellen in den Biografien der Figuren und auch der Gesamtkonstruktion des Romans.