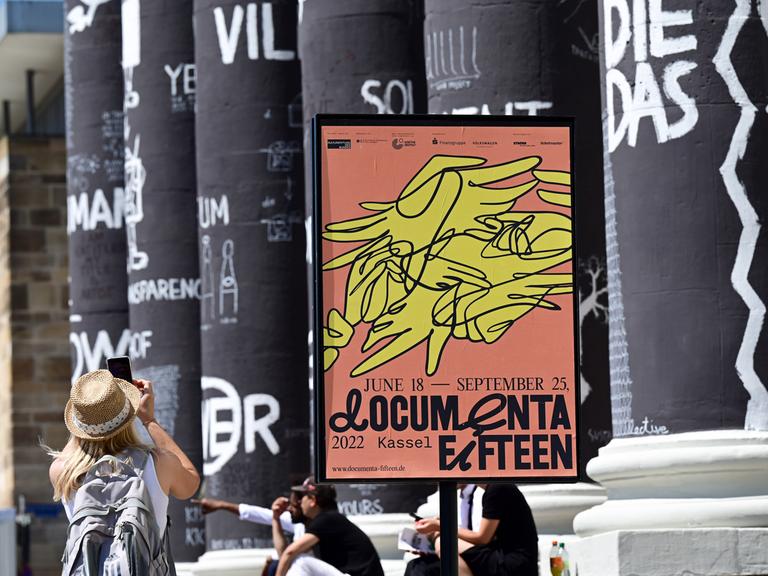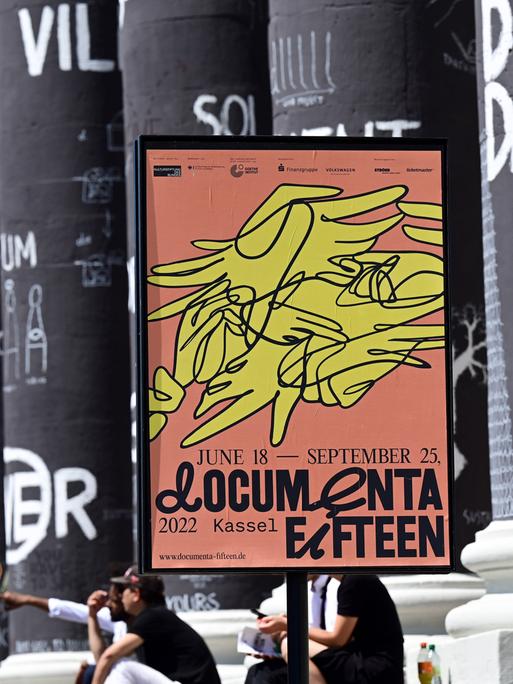Aus meiner Sicht muss nicht nur dieses Kunstwerk entfernt werden, und zwar komplett, sondern es muss auch diskutiert werden, inwiefern andere Arbeiten dieses Kollektivs überhaupt noch auf der Documenta ausgestellt werden sollen.
Antisemitismus-Skandal auf der Documenta

Wimmelbild mit antisemitischem Einschlag: das umstrittene Großgemälde des indonesischen Künstlerkollektivs "Taring Padi" auf dem Friedrichsplatz in Kassel. © dpa / Uwe Zucchi
"Dieses Kunstwerk muss komplett entfernt werden"
08:23 Minuten

Das wegen antisemitischer Motive kritisierte Bild der Gruppe "Taring Padi" muss von der Documenta entfernt werden: Das fordert der Historiker Meron Mendel. Auf dem Werk ist unter anderem ein Soldat mit Schweinsgesicht und Davidstern zu sehen.
Das indonesische Künstlerkollektiv "Taring Padi" arbeitet mit einer plakativen Agitprop-Ästhetik. Das etwa zehn mal zehn Meter große Bild der Gruppe am Friedrichsplatz im Zentrum von Kassel zeigt im Gewimmel der unterschiedlichsten Figuren einen Soldaten mit Schweinsgesicht und einem Davidstern, dessen Helm die Aufschrift "Mossad" trägt. Außerdem findet sich darauf die Darstellung eines orthodox gekleideten Juden mit Schläfenlocken, spitzen Zähnen und SS-Runen auf seiner Kopfbedeckung.
Antisemitische Stereotype
"Beide Bilder sind eindeutig antisemitisch", sagt Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main. Die Motive zielten, trotz der Anspielung auf den israelischen Geheimdienst, nicht in erster Linie auf eine Kritik an Israel ab. Vielmehr würden hier vor allem Stereotype verwendet, die seit Jahrhunderten zur diffamierenden Darstellung von Juden dienten.

Diffamierende Stereotype: Wegen dieser und anderer Darstellungen steht das Bild des indonesischen Kollektivs "Taring Padi" in der Kritik.© dpa / Uwe Zucchi
Dass die Documenta laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung ankündigte, nun Teile des Werks von Taring Padi zu verdecken und zu "kontextualisieren", hält Mendel für völlig unzureichend.
Offenbar versuche die Leitung der Documenta, nach ohnehin zu langem Zögern, in dieser Sache einen Kompromiss zu finden. Doch Mendel kann sich nicht vorstellen, wie ein solcher "zwischen Antisemiten und Juden" gefunden werden kann. Hier werde versucht, "mit kleinen Korrekturen etwas zurechtzubiegen, was nicht zurechtgebogen werden kann".
Verteidigung gegen den Generalverdacht
Seit Monaten habe er die Documenta gegen Vorabvorwürfe und den Generalverdacht des Antisemitismus verteidigt, betont Mendel. "Aber wenn Antisemitismus eindeutig nachweisbar ausgestellt wird, dann gilt es, klar und eindeutig darauf zu reagieren."
Dass ein Künstlerkollektiv, das sich gerade "öffentlich disqualifiziert" habe, von der Leitung der Documenta überhaupt noch als akzeptabler Gesprächspartner betrachtet werde, irritiere ihn, so Mendel.
Von einem Abbruch der gesamten Ausstellung oder einem Boykott, wie ihn jetzt bereits manche fordern, hält Mendel jedoch nichts. "Ich bin immer gegen Boykott", sagt er. "Es schmerzt mich, dass wegen des Antisemitismus von Einzelnen die gesamte Documenta und vor allem die anderen Künstler, die gar nichts damit zu tun haben, in ein schlechtes Licht gestellt werden."
Erklärung überzeugt nicht
Der Kulturjournalist Ingo Arend sieht die Documenta schon am Eröffnungswochenende schwer beschädigt: "Das ist der GAU für die aktuelle Ausstellung, es ist aber auch ein GAU in der Documenta-Geschichte, der seinesgleichen sucht",
sagt Arend im Interview.
In der Verantwortung sieht er neben den Künstlern von "Taring Padi" das Kuratoren-Team von Ruangrupa und die Administration der Documenta.
Bei dem Kunstwerk von "Taring Padi" gebe es keinerlei Deutungsspielraum, sagt die Kunsthistorikerin Insa-Christiane Hennen im Interview : "Das ist eine ganz klare antijüdische Stellungnahme, die an die Ikonografie der Nazizeit anknüpft". Die Propagandabilder des NS-Regimes würden ihrerseits auf mittelalterliche antijüdische Kunstwerke zurückgreifen, sodass sich eine lange, unselige Tradition ergebe.
Die Erklärungsversuche von "Taring Padi" überzeugen auch Ingo Arend nicht. Das Künstlerkollektiv hatte davon gesprochen, dass die beiden Motive "antisemitische Lesarten" bieten würden: "Eine sehr wachsweiche Formulierung, als ob man das auch anders sehen könnte", sagt Arend.
Auch der Hinweis auf "kulturspezifische Erfahrungen" reicht Arend nicht. "Taring Padi" hat die Motive auf ihre Erlebnisse im Kampf gegen das indonesische Suharto-Regime zurückgeführt. "Das ruft das heftigste Kopfschütteln hervor, die antisemitische Ikonologie ist universell. Dafür sind die Motive, der Davidstern, die Schläfenlocken, zu eindeutig, als dass man sagen könnte, das hat nur was mit dem indonesischen Kontext zu tun", sagt Arend.
"Entsetzt über den blanken Judenhass"
Jüdische Organisationen reagierten entsetzt auf den Vorfall. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, forderte die Verantwortlichen der Documenta auf, Konsequenzen zu ziehen. Eine rote Linie sei überschritten.
Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, zeigte sich "entsetzt über den blanken Judenhass", der sich in dem Bild zeige. "Personen mit Schläfenlocken und SS-Runen, dazu ein Schweinekopf mit der Aufschrift 'Mossad': Das ist derart plump und so unzweideutig antisemitisch, dass man sich fragt, wozu es all die Gesprächsreihen und die langen Debatten im Vorfeld der Documenta wirklich gebraucht hat, wenn am Ende trotzdem mitten in Kassel ein solches Bild gezeigt werden kann."
Den angekündigten Schritt, das Gemälde teilweise zu verdecken und zu "kontextualisieren", kritisierte Knobloch als "absurd". Das "Allermindeste" sei, dass die Verantwortlichen die antisemitische Bildsprache vollständig aus dem öffentlichen Raum entfernten. Dies sei auch im Interesse der übrigen Künstler, sagte sie.
Der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG), Volker Beck, hat einem Medienbericht zufolge die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Beck sagte der "Bild"-Zeitung: "Gemessen an den Maßstäben des Urteils des Bundesgerichtshofs zur 'Wittenberger Judensau' stellt das Werk des Künstlerkollektivs 'Taring Padi' einen rechtsverletzenden Zustand dar." Durch die Darstellung von "Juden- und Mossad-Säuen" werde unmittelbar der Geltungs- und Achtungsanspruch eines jeden in Deutschland lebenden Juden angegriffen.
Der Kulturaussschuss tagt nicht
Das American Jewish Committee (AJC) Berlin betonte, das Werk erinnere an die antisemitische Bildsprache des nationalsozialistischen Hetzblattes "Der Stürmer". Documenta-Geschäftsführerin Sabine Schormann müsse "umgehend von ihren Aufgaben entbunden" werden.
Die Bundesregierung hatte am Montag den Antrag der Unionsfraktion abgelehnt, sich im Kulturausschuss mit der Documenta zu befassen, erklärte Fraktionsvize Dorothee Bär (CSU). Dies sei "inakzeptabel". Angesichts der "massiven Vorwürfe" gegen die Geschäftsleitung, der öffentlichen Debatte und der Bundesförderung mit Steuermitteln sei es "zwingend geboten", dass der Kulturausschuss deswegen zeitnah zusammenkomme.
Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, erklärte, es sei "vollkommen unverständlich, wie die Documenta-Verantwortlichen es zulassen konnten, dass diese antisemitischen Werke trotz aller Diskussionen im Vorfeld ausgestellt wurden". Es handele sich um einen "Skandal mit Ansage".
Schon im Vorfeld der am Samstag eröffneten Ausstellung hatte es eine längere, kontroverse Debatte über Antisemitismus und den Umgang mit Israel gegeben. Kritik gab es besonders an dem indonesischen Kunstkollektiv "Ruangrupa", dem die künstlerische Leitung übertragen worden war. "Ruangrupa" wurde vorgeworfen, für die Documenta Organisationen einzubeziehen, die das Existenzrecht Israels infrage stellen oder einen Boykott des Landes unterstützen.
Keine israelischen Künstlerinnen und Künstler
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte in seiner Rede zur Eröffnung, dass er lange gezweifelt habe, ob er die Ansprache überhaupt halten solle. „Denn so berechtigt manche Kritik an der israelischen Politik, etwa dem Siedlungsbau, ist“, die Anerkennung der israelischen Staatlichkeit sei „bei uns Grundlage und Voraussetzung der Debatte“.
Zudem nannte es Steinmeier verstörend, wenn „neuerdings häufiger Vertreter des globalen Südens sich weigern, an Veranstaltungen, an Konferenzen oder Festivals teilzunehmen, an denen jüdische Israelis teilnehmen“. In diesem Zusammenhang falle es auf, dass auf der Documenta keine jüdischen Künstlerinnen oder Künstler aus Israel vertreten seien.
(fka/kna/apf)