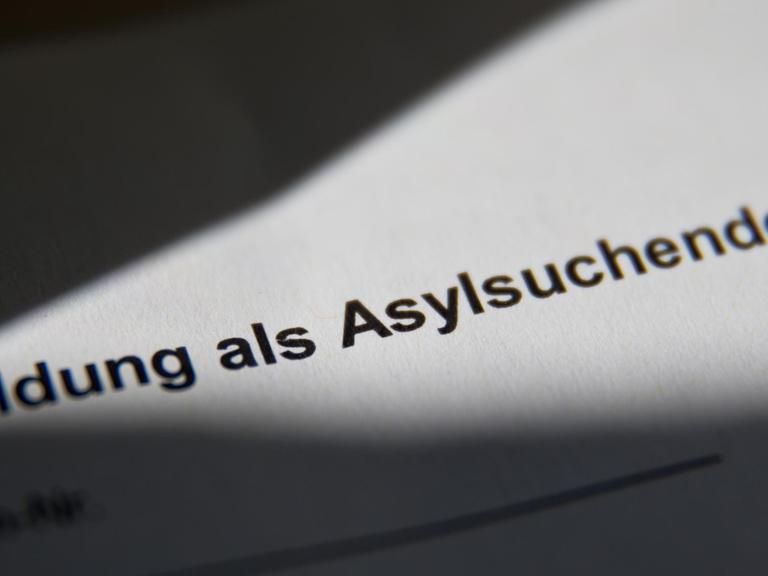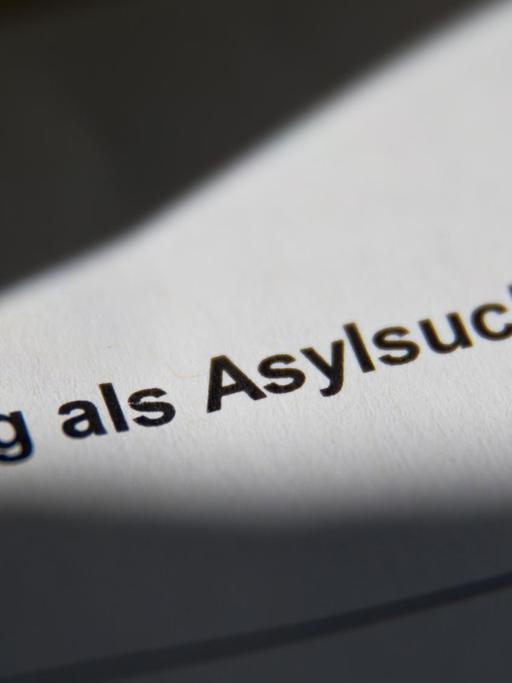Hagen im Ruhrgebiet statt Toflea in Rumänien
10:17 Minuten

Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU: Seit 2014 können Bulgaren und Rumänen in Deutschland arbeiten. Viele Menschen zog es ins Ruhrgebiet. Eine Zeitung schrieb gar, ein ganzes rumänisches Dorf sei nach Hagen gezogen. Wie ging es weiter in der Stadt?
„Dass wir besser leben können, dass wir eine gute Zukunft haben können. Das ist unsere Ziel gewesen, deswegen sind wie hierhin gekommen“, sagt Diego Dinca. Vor viereinhalb Jahren kam der heute 23-Jährige – braune Haare, weißblau-gestreiftes Hemd, schwarze Hose, Turnschuhe – aus Rumänien nach Hagen. Genauer gesagt: Aus Toflea, einem kleinen Dorf im Osten Rumäniens, etwa 200 Kilometer von Bukarest entfernt.
Insgesamt waren es rund 5000 Einwanderer aus Rumänien und Bulgarien, die in den letzten Jahren nach Hagen gezogen sind, darunter eben 500 Menschen aus Toflea.
„Da leben gerade nur die alten Leute. Die Omas, die da noch sind, die wissen, dass wir in Deutschland sind, in Hagen.“
„Da leben gerade nur die alten Leute. Die Omas, die da noch sind, die wissen, dass wir in Deutschland sind, in Hagen.“
Anderthalb Jahre Deutsch gelernt
Dinca lächelt. Er selbst hat anderthalb Jahre Deutsch gelernt, Praktika gemacht, sich mit der Schule vorbereitet. Mithilfe des Quartiersmanagement hat Dinca einen Ausbildungsplatz bekommen, lernt seit einem halben Jahr bei einer Apotheke in Hagen. Drei Jahre insgesamt geht die Ausbildung:
„Zwei Tage pro Woche Schule, dann vier, fünf Tage pro Woche arbeiten.“
Das bessere Leben, für Dinca scheint es Wirklichkeit zu werden.
„Zwei Tage pro Woche Schule, dann vier, fünf Tage pro Woche arbeiten.“
Das bessere Leben, für Dinca scheint es Wirklichkeit zu werden.

Diego Dinca in der neuen Heimat Hagen. © Moritz Küpper
Neben ihm sitzt Vater Vasile. Er arbeitet bei einem Paketzusteller, hat dazu noch einen Job als Hausmeister. Auf dem Handy zeigt er Bilder aus seiner Heimat, aus Toflea, wo die Familie Dinca erfolgreiche Handwerker waren. Die Fotos zeigen große Schalen, Grillroste, alles aus Metall hergestellt:
„Mein Opa war der Meister, der das machte; mein Vater hat davon auch gelernt und so weiter, dann ist es später schwierig geworden, weil die Roboter, die machen das. Das wird automatisch gemacht, wir werden gar nicht mehr gesucht.“
„Mein Opa war der Meister, der das machte; mein Vater hat davon auch gelernt und so weiter, dann ist es später schwierig geworden, weil die Roboter, die machen das. Das wird automatisch gemacht, wir werden gar nicht mehr gesucht.“
Maschinen statt Menschen
Die Industrialisierung, die Automatisierung, sie führten dazu, dass die Arbeit – nicht nur, aber auch – in Toflea knapp wurde. Doch: Warum gingen die Menschen dann ausgerechnet nach Hagen? Diego Dinca zuckt mit den Achseln:
„Weiß ich auch nicht, mein Vater kannte jemanden, der hier war, wir sind einfach hierhin gekommen, dann hat uns die Stadt gefallen, weil es eine sehr schöne Stadt ist.“
Ein ganzes Dorf zieht nach Hagen. Es war diese, wie aus einem Comic stammende, Zuspitzung, die es mancherorts in die Überschriften schaffte, die die Aufmerksamkeit auf die ehemalige Industriestadt am Rande des Ruhrgebiets legte – und die in der Stadt polarisierte.
„Weiß ich auch nicht, mein Vater kannte jemanden, der hier war, wir sind einfach hierhin gekommen, dann hat uns die Stadt gefallen, weil es eine sehr schöne Stadt ist.“
Ein ganzes Dorf zieht nach Hagen. Es war diese, wie aus einem Comic stammende, Zuspitzung, die es mancherorts in die Überschriften schaffte, die die Aufmerksamkeit auf die ehemalige Industriestadt am Rande des Ruhrgebiets legte – und die in der Stadt polarisierte.
Wie groß ist ein ganzes Dorf?
Gabriele Schwanke sitzt neben den Dincas. Die 58-Jährige, Jeans, schwarze Bluse, Brille im blonden Haar, leitet das Quartiersmanagement der Stadt Hagen.
„Also, ich muss sagen, was mich immer belustigt, ist: Manchmal steht da, ein ganzes Dorf ist nach Hagen gezogen, manchmal ist es auch nur ein halbes. Nach den Regeln der Mathematik trifft das nicht zu.“
Schwanke hält die Zahlen für zu hoch geschätzt, weist daraufhin, dass in Toflea rund 8000 Menschen leben. „Und dann von der Hälfte zu reden, ist vermessen.“
Schwanke kümmert sich. Zusammen mit acht Mitarbeitern aus unterschiedlichen Hagener Roma-Communities, zu denen auch die Rumänen aus Toflea zählen, unterstützt sie bei der Wohnungssuche, bei der Schulvermittlung, beim Unterricht oder Behördengängen.
„Wir arbeiten mit den Methoden des Empowerment, das heißt der Befähigung.“
Eben wie Diego Dinca selbstständig in der Lage zu sein, sein Leben zum Erfolg zu führen. Schwankes Team geht nun ins dritte Jahr, sie weiß um die Vorbehalte gegenüber den Zuwanderern, speziell gegenüber den Roma.
„Wir arbeiten mit den Methoden des Empowerment, das heißt der Befähigung.“
Eben wie Diego Dinca selbstständig in der Lage zu sein, sein Leben zum Erfolg zu führen. Schwankes Team geht nun ins dritte Jahr, sie weiß um die Vorbehalte gegenüber den Zuwanderern, speziell gegenüber den Roma.
Bereits im Nationalsozialismus verfolgt und millionenfach ermordet, sind sie noch heute die in Europa am stärksten diskriminierte Volksgruppe. Laut einer Studie der EU leben 80 Prozent von ihnen unterhalb der länderspezifischen Armutsgrenzen, sie erfahren Benachteiligungen bei Bildung, Arbeit und Wohnsituation.
Wasser abgestellt
So ist es jetzt auch in Hagen. Beispielsweise wenn mal wieder das Wasser abgestellt wurde:
„Was besonders traurig ist, dass dann – das ist in Hagen vorgekommen – in der Zeitung steht, Roma-Kinder verrichten ihre Fäkalien in Spielplatzhäuschen. Das stimmt. Was allerdings nicht da stand, ist, dass die Häuser seit längerem kein Wasser mehr hatten, obwohl die Mieter ihre Abgaben gezahlt haben, der Vermieter hingegen, auch unseriös, die Abgaben nicht weitergeleitet hat. Und dann muss man sich einfach überlegen, ob man dann wirklich sagen kann: ‚Okay, Roma sind unsauber‘, wie auch immer – oder ob letzten Endes die Familien das gemacht haben, was andere auch vielleicht auch gemacht hätten: ‚Guck mal, geh da rein, da sieht Dich keiner‘.“
Probleme, die sich auch oder vor allem im Hagener Stadtteil Wehringhausen zeigen.
„Ein Stadtteil, der sehr lebendig ist, wo aber auch sehr viele Unterschiede sind, wenn man so von oben nach unten den Stadtteil begeht. Und es ist eben auch Zentrum der Zuwanderung, weil es eben auch preiswerten Wohnraum gibt. Und von da aus gibt es in einigen Quartieren Diskussionen und manchmal auch nachbarschaftliche Streits.“
„Was besonders traurig ist, dass dann – das ist in Hagen vorgekommen – in der Zeitung steht, Roma-Kinder verrichten ihre Fäkalien in Spielplatzhäuschen. Das stimmt. Was allerdings nicht da stand, ist, dass die Häuser seit längerem kein Wasser mehr hatten, obwohl die Mieter ihre Abgaben gezahlt haben, der Vermieter hingegen, auch unseriös, die Abgaben nicht weitergeleitet hat. Und dann muss man sich einfach überlegen, ob man dann wirklich sagen kann: ‚Okay, Roma sind unsauber‘, wie auch immer – oder ob letzten Endes die Familien das gemacht haben, was andere auch vielleicht auch gemacht hätten: ‚Guck mal, geh da rein, da sieht Dich keiner‘.“
Probleme, die sich auch oder vor allem im Hagener Stadtteil Wehringhausen zeigen.
„Ein Stadtteil, der sehr lebendig ist, wo aber auch sehr viele Unterschiede sind, wenn man so von oben nach unten den Stadtteil begeht. Und es ist eben auch Zentrum der Zuwanderung, weil es eben auch preiswerten Wohnraum gibt. Und von da aus gibt es in einigen Quartieren Diskussionen und manchmal auch nachbarschaftliche Streits.“
Tausende Wohnungen stehen in Hagen leer
Reinhard Goldbach, der Fachbereichsleiter Jugend und Soziale Stadt in Hagen, steht auf dem Wilhelmsplatz in der unteren Hälfte von Wehringhausen. Er erinnert sich daran, dass die erste Zuwanderungswelle noch an Hagen vorbeiging:
„Das war so die Emscher-Schiene von Dortmund bis Gelsenkirchen. Und zum späteren Zeitpunkt, vermutlich, weil es da schwieriger wurde oder der Wohnraum nicht mehr so akquiriert werden konnte, sind bestimmte Stadtteile in Hagen dann im Fokus gewesen. Eine der Ursachen, sagen wir immer, ist, dass Hagen mehrere tausend leer stehende Wohnungen hat, und das ist untypisch. Es gibt andere Städte, die Universitätsstädte sind, wie Bochum, wo es eher Wohnungsknappheit gibt und da gibt es auch nicht diese Form der Zuwanderung.“
Hagen dagegen hat nur eine Fern-Uni – ohne Präsenzpflicht. Goldbach führt durch das Viertel, zeigt Problem-Immobilien, die versiegelt wurden; Zettel, auf denen auf Deutsch und Rumänisch erklärt wird, dass das Haus aufgrund von Mängeln geräumt wurde. Während es oben am Hang, schicke Fassaden, Bioläden, auch ein alternatives Kulturzentrum gibt, stehen hier – nahe der Bahnschienen – eher Häuser leer, türmt sich der Müll.

Reinhard Goldbach, Fachbereichsleiter Jugend und Soziale Stadt in Hagen.© Moritz Küpper
Ein Rentner kehrt jeden Donnerstag
Ein alter Mann läuft, gebückt, über den Platz. In der Hand trägt er einen Besen und ein Kehrblech. Langsam, aber seit Stunden, räumt er den Platz auf. Der Rentner, der bereits einen Schlaganfall erlitten hat, kommt seit dem Jahr 2015 jeden Donnerstag aus dem benachbarten Viertel.
„Die schmeißen ja vieles auch aus dem Fenster und auf die Erde. Zuhause, aus Südosteuropa kennen die ja nicht anders, die machen es so und es war erst auch noch sehr viel schlimmer und auch noch mit viel Ratten.“
Goldbach weiß um die Probleme, weiß um die Diskussionen, um die Sprengkraft, die diese Zuwanderung für seine Geburtsstadt hat. Denn: Der Stadt geht es ohnehin nicht gut, sie ist hoch verschuldet, es fehlen Millionen um Kindergärten oder Schulen auszubauen. Nun kommt die Zuwanderung als Kostenfaktor hinzu.
„Wer seid ihr denn?“
In der Unterführung trifft Goldbach auf eine Gruppe Drogensüchtiger und Alkoholiker, die sofort losschimpft:
„Was die Zigeuner hier an Scheiße machen.“
„Ja, genau.“
„Da liegt immer Müll, vollgekackte Windeln, Nahrungsmittel, die sie zuhause nicht entsorgen können. Und gerade leergemacht, es dauert keine Woche, dann ist da wieder voll.“
Goldbach lächelt, etwas gequält – er kennt die Zustände.
„Die schmeißen ja vieles auch aus dem Fenster und auf die Erde. Zuhause, aus Südosteuropa kennen die ja nicht anders, die machen es so und es war erst auch noch sehr viel schlimmer und auch noch mit viel Ratten.“
Goldbach weiß um die Probleme, weiß um die Diskussionen, um die Sprengkraft, die diese Zuwanderung für seine Geburtsstadt hat. Denn: Der Stadt geht es ohnehin nicht gut, sie ist hoch verschuldet, es fehlen Millionen um Kindergärten oder Schulen auszubauen. Nun kommt die Zuwanderung als Kostenfaktor hinzu.
„Wer seid ihr denn?“
In der Unterführung trifft Goldbach auf eine Gruppe Drogensüchtiger und Alkoholiker, die sofort losschimpft:
„Was die Zigeuner hier an Scheiße machen.“
„Ja, genau.“
„Da liegt immer Müll, vollgekackte Windeln, Nahrungsmittel, die sie zuhause nicht entsorgen können. Und gerade leergemacht, es dauert keine Woche, dann ist da wieder voll.“
Goldbach lächelt, etwas gequält – er kennt die Zustände.
Besuch der Sozialdezernentin in Rumänien
Hagens parteilose Sozialdezernentin sieht die Situation kritisch, sagt: Das Problem werde größer. Alle zusammen, sprich Schwenker, Goldbach und auch die Sozialdezernentin, waren sie vor einem Jahr in Rumänien, machten sich dort ein Bild der Lage:
„Da ist dann ein sehr einfaches Wohnhaus, wo dann eine Schmiede quasi, so wie bei uns im Freilichtmuseum, da noch existiert, mit einfachsten Mitteln, wo dann Dachnägel produziert werden und andere Dinge mehr. Das ist so das, was dann als Lebensunterhalt gemacht wird und das muss man schon mal gesehen haben. Ja, war von da aus für uns durchaus aufschlussreich.“
Goldbachs Fazit: Die Menschen werden wohl bleiben – und die Stadt muss handeln: Seit einigen Monaten gibt es Initiativen, die Quartiere aufzuwerten. Schrottimmobilien werden versiegelt, mithilfe von Fassadenprogrammen sollen die teilweise beeindruckenden Altbauten neu gestaltet werden.
„Da ist dann ein sehr einfaches Wohnhaus, wo dann eine Schmiede quasi, so wie bei uns im Freilichtmuseum, da noch existiert, mit einfachsten Mitteln, wo dann Dachnägel produziert werden und andere Dinge mehr. Das ist so das, was dann als Lebensunterhalt gemacht wird und das muss man schon mal gesehen haben. Ja, war von da aus für uns durchaus aufschlussreich.“
Goldbachs Fazit: Die Menschen werden wohl bleiben – und die Stadt muss handeln: Seit einigen Monaten gibt es Initiativen, die Quartiere aufzuwerten. Schrottimmobilien werden versiegelt, mithilfe von Fassadenprogrammen sollen die teilweise beeindruckenden Altbauten neu gestaltet werden.
Mietführerschein für die neuen Einwohner
Beim Quartiersmanagement bieten sie nun einen sogenannten Mietführerschein an, bei dem bis heute rund 50 Menschen gelernt haben, was eine Hausordnung ist oder wie Mülltrennung geht. Als warnendes Beispiel, sieht Goldbach aktuell die sogenannten Clan-Razzien, die vor allem im Ruhrgebiet und Berlin stattfinden:
„Weil, als die Libanesen kamen, ist eben nicht Richtung Integration gedacht worden, sondern man hat gesagt, die müssen eines Tages alle wieder gehen und hat ihnen alle Möglichkeiten sich positiv zu integrieren erstmal verwehrt und dann haben sich die eigenen Strukturen geschaffen um zu überleben. Heute beschwert man sich darüber, dass sie genau diese Parallelwelt dort haben. Das spricht aber eben nicht dagegen, dass wir jetzt eine Integrationsstrategie fahren müssen, sondern bestätigt es eher.“
Doch das, das weiß auch Goldbach, wird in Hagen noch ein langer, mühsamer Weg.
„Weil, als die Libanesen kamen, ist eben nicht Richtung Integration gedacht worden, sondern man hat gesagt, die müssen eines Tages alle wieder gehen und hat ihnen alle Möglichkeiten sich positiv zu integrieren erstmal verwehrt und dann haben sich die eigenen Strukturen geschaffen um zu überleben. Heute beschwert man sich darüber, dass sie genau diese Parallelwelt dort haben. Das spricht aber eben nicht dagegen, dass wir jetzt eine Integrationsstrategie fahren müssen, sondern bestätigt es eher.“
Doch das, das weiß auch Goldbach, wird in Hagen noch ein langer, mühsamer Weg.