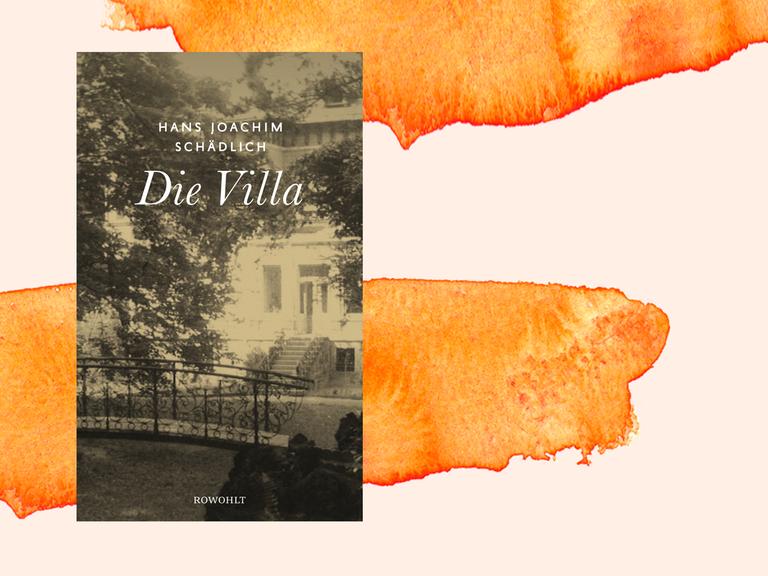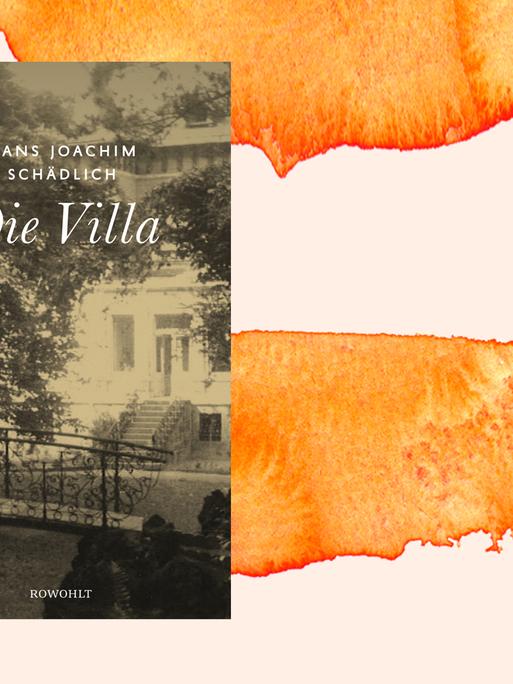„‚So schnell mochte Zola ihn nicht gehen lassen. ‚Wollen Sie denn gar nicht wissen, was die Zukunft für Sie bereithält?‘, fragte sie und zog das Seidentuch von der Glaskugel. Der Großhändler setzte den Hut auf die Glatze. ‚Unsere Zukunft nehmen wir jetzt selbst in die Hand‘, sagte er. ‚Und mit solchen spiritistischen Sperenzchen werden wir auch noch aufräumen …‘“
Arno Frank: „Ginsterburg“
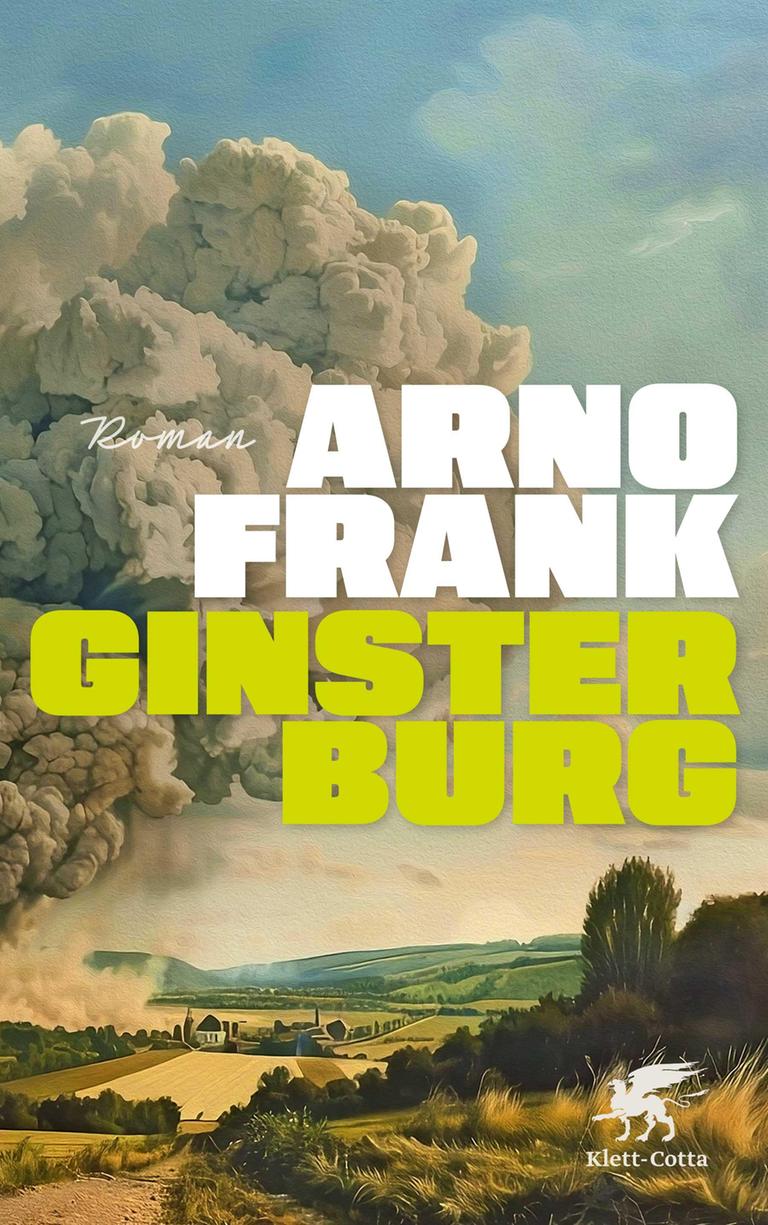
Zwischen Panzer-Torte und Feuersturm
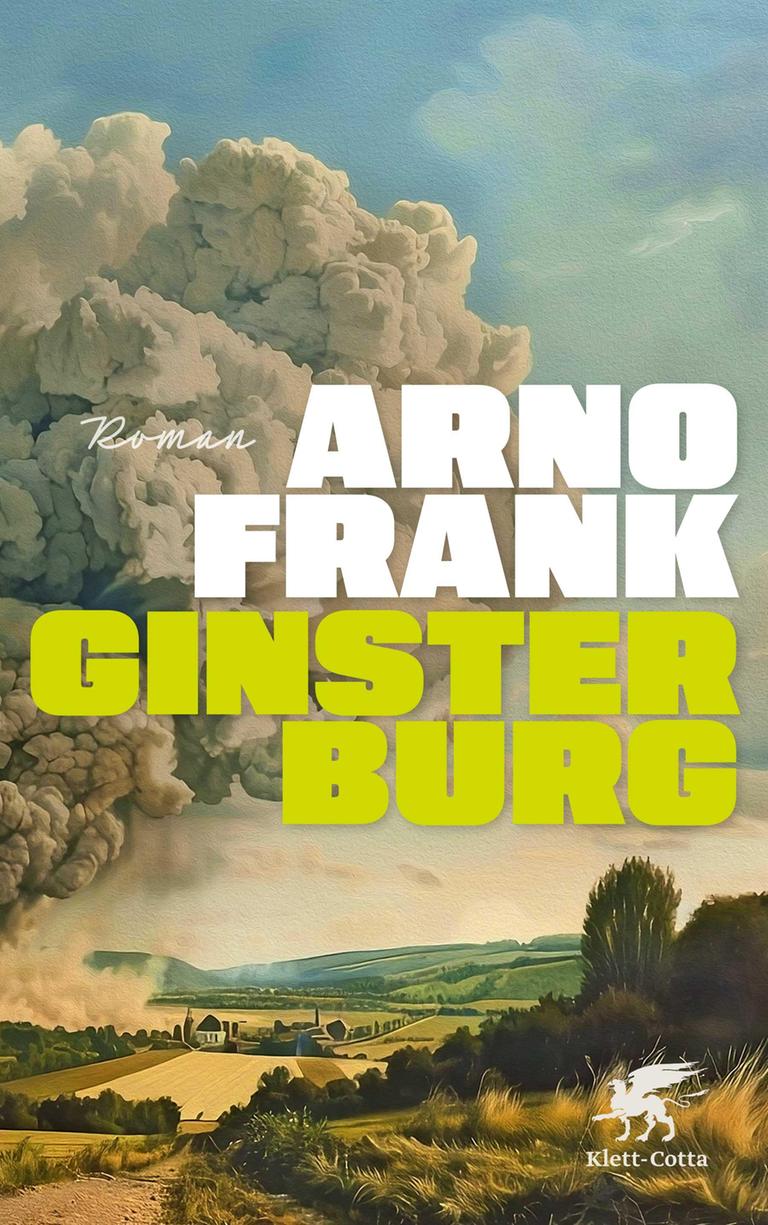
Arno Frank
GinsterburgKlett-Cotta, Stuttgart 2025432 Seiten
26,00 Euro
Ein Roman über Mitläufer, Karrieristen und menschliche Abgründe während der NS-Zeit: Arno Franks „Ginsterburg“ verwebt die Schicksale von Kleinstadtcharakteren und zeigt, wie sich das Böse in den Alltag einschleicht.
Ein Zirkus, der in eine Kleinstadt kommt, ein Junge, der seine Mutter ins Zelt der Wahrsagerin schleppt: Der Anfang von Arno Franks neuem Roman erinnert an Ray Bradburys Gruselklassiker „Das Böse kommt auf leisen Sohlen“ von 1962, in dem ein Jahrmarkt den Bewohnern einer Stadt die Lebenszeit stiehlt. Mit dem Unterschied freilich, dass sich das Böse in Ginsterburg längst eingenistet hat. Denn das fiktive titelgebende Provinznest erweckt nur auf den ersten Blick den „Eindruck verschlafener Freundlichkeit“.
Deshalb sind es im Handlungsjahr 1935 des ersten Romanteils auch nicht wie bei Bradbury die Einwohner, die sich vorsehen müssen, sondern die Schausteller. Wie die Wahrsagerin Zola, die beim letzten Mal dem Blumenhändler Otto Gürckel eine glänzende Zukunft vorausgesagt hatte. Jetzt, wenige Jahre später, ist in Ginsterburg der Blumenschmuck so allgegenwärtig wie die Hakenkreuzfahnen und Otto als NSDAP-Kreisleiter lachender Profiteur der neuen Verhältnisse.
NS-Alltag im Fünfjahrestakt
Arno Frank, Jahrgang 1971, ist vor allem als Journalist und Kritiker tätig. Nach Achtungserfolgen mit Romanen über seine Kindheit mit einem kriminellen Vater und über ein Freibad und seine Besucher wagt Frank nun als Schriftsteller den großen Wurf: mit einem ambitionierten, genau recherchierten Roman über den Alltag im Nationalsozialismus. „Ginsterburg“ ist multiperspektivisch angelegt, und allein wie souverän hier die Lebensläufe von über einem Dutzend glaubwürdiger Figuren miteinander verflochten werden, ist bemerkenswert.
Deren Schicksale verfolgt Arno Frank im Fünfjahrestakt: Der zweite Romanteil spielt 1940, als man nicht nur im allgegenwärtigen Sehnsuchtsort Berlin, sondern auch im kleinen Ginsterburg vom nahen Sieg träumt. Im dritten Teil dann, 1945, nehmen englische Bomber die Stadt ins Visier und entfachen einen Feuersturm, der der Stadt ein gleichsam alttestamentarisches Ende beschert.
Ginsterburg, das ist eine Stadt der Mitläufer und Karrieristen. So etwas wie Identifikationsfiguren gibt es nicht, was der Lektüre aber überraschenderweise nicht schadet; das verbindet Franks Roman etwa mit Florian Göttlers Romantrilogie „Dachau 1933-1945“. Ein ums andere Mal offenbart die Froschperspektive der „Volksgenossen“, dass man im Zweifel doch lieber den Weg des geringsten Widerstands geht. Gerade die, die sich als Sympathieträger anbieten würden, erweisen sich als Enttäuschung.
Für die Buchhändlerin Merle etwa, Witwe eines Kommunisten, ist die Davidstern-Schmiererei an ihrem Schaufenster kaum mehr als ein Fall von „falsch adressiert“; ansonsten flüchtet sie sich in eine Affäre und in die Überzeugung, dass ihr Sohn Lothar bei der Hitler-Jugend nur „Leibesübungen“ lernen würde. Der gewissenhafte, anständige Junge wiederum kann zu Romanbeginn nicht mal einen Fisch töten; fünf Jahre später erhält Lothar als Fliegerass das Ritterkreuz. Und dann ist da noch Eugen, die wohl interessanteste, jedenfalls ambivalenteste Figur des Romans: ein wackerer Zeitungsredakteur und Kriegskamerad des eingangs erwähnten Kreisleiters, der in den Weimarer Jahren noch den Kontakt zur linken „Weltbühne“ Carl von Ossietzkys gesucht hat.
Panzer-Torte mit drehbarem Geschützturm
Franks historischer Roman ist souverän geschrieben; seine stilistische Bandbreite reicht vom inneren Monolog einer Fünfjährigen bis zum auktorial erzählten Wetterbericht nach dem Muster von Robert Musils „Mann ohne Eigenschaften“. Mehr noch als von seiner Sprache lebt „Ginsterburg“ aber von starken Szenen, die auch nach der Lektüre noch lange nachhallen: Wie die vom Bäcker stolz präsentierte Torte in Panzerform mit drehbarem Geschützturm. Oder der Moment, als Eugens dementer Vater, Ginsterburgs Nationalheld der Kaiserzeit, sich ausgerechnet auf seiner Geburtstagsfeier nur noch an die Sinnlosigkeit all der erlebten Gräuel erinnern kann.
Und der Holocaust? Die wenigen jüdischen Mitbürger der Kleinstadt haben fast alle rechtzeitig das Weite gesucht; in den Köpfen von Franks empathiebefreitem Romanpersonal sind sie für wenig mehr als abfällige Gedanken gut.
Werden im Deutschunterricht eigentlich noch 400-Seiten-Romane gelesen? Falls ja, würde man Arno Franks „Ginsterburg“ gerade in unseren Tagen die Wahl zur Schullektüre sehr wünschen.