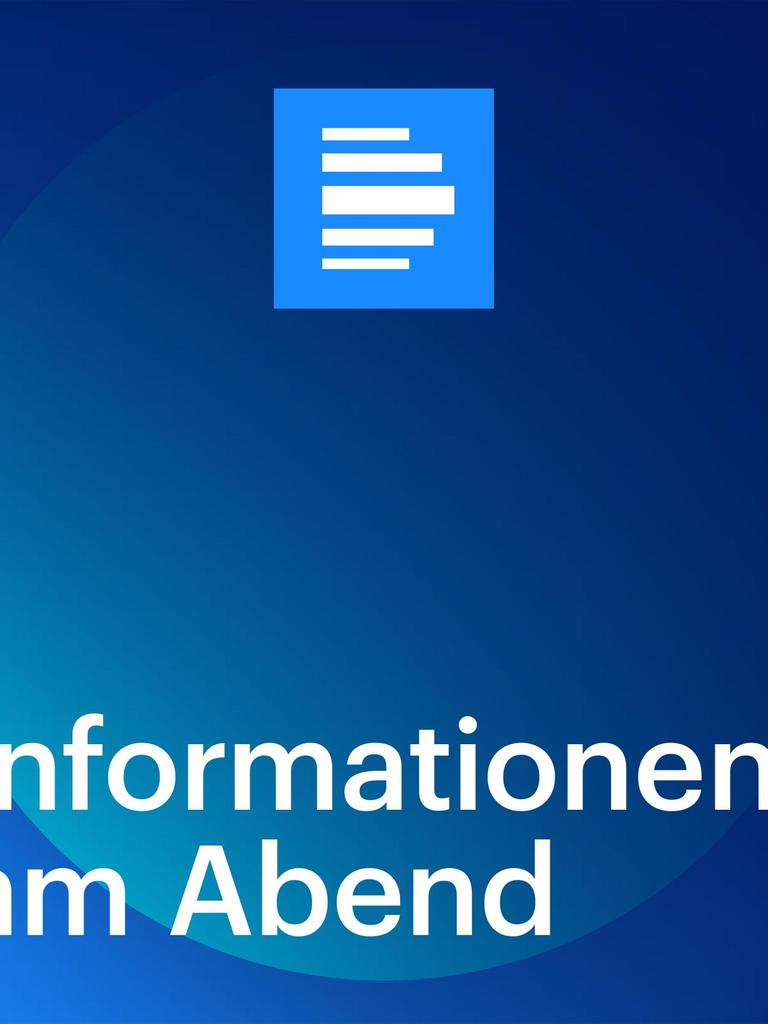- Warum übernehmen Investoren in Deutschland immer mehr Arztpraxen?
- Warum dürfen Privatinvestoren überhaupt Arztpraxen in Deutschland kaufen?
- Wie funktioniert das Geschäftsmodell von Private-Equity-Firmen?
- Welche Kritik gibt es am Engagement von Finanzinvestoren im medizinischen Sektor?
- Gibt es auch Gründe, die für den Einstieg von Investoren in den medizinischen Sektor sprechen?
- Wie wird der vermehrte Aufkauf von Arztpraxen politisch diskutiert und wie steht die Bundesregierung dazu?
Aufkauf von Arztpraxen durch Investoren

Radiologie: eine der Fachrichtungen, die Investoren bevorzugen, wenn sie Arztpraxen aufkaufen. © picture alliance / dpa / Monika Skolimowska
Gesundheit als Ware

In Deutschland kaufen Finanzinvestoren immer mehr Arztpraxen auf. Kritiker fürchten, dass die Orientierung am Profit zulasten der Patienten geht. Bundesgesundheitsminister Lauterbach will den Trend per Gesetz unterbinden.
Gesundheit ist ein krisensicheres Geschäft - das haben internationale Finanzkonzerne schon vor über 20 Jahren bemerkt. Erst investierten sie in Krankenhäuser, später kamen Pflegeheime dazu. Und seit einigen Jahren sind auch Arztpraxen ins Visier von großen Kapitalgebern geraten.
Diese haben vor allem ein Ziel: Rendite erzielen. „Krank werden wir alle, und die Gesellschaft wird nicht jünger, im Gegenteil“, sagt der Autor Rainer Bobsin, der sich schon lange mit dem Engagement von Finanzinvestoren im Gesundheitswesen beschäftigt. Dieses sei mit wenig Risiko behaftet, betont der Experte. Insolvenzen in diesem Bereich seien äußerst selten.
Inhaltsverzeichnis
Warum übernehmen Investoren in Deutschland immer mehr Arztpraxen?
Es geht natürlich ums Geld – um viel Geld. Die Gesundheitsausgaben betrugen in Deutschland 2021 nach Angaben des Statistischen Bundesamtes knapp 466 Milliarden Euro. Im Gesundheitsmarkt ringen viele Akteure um einen möglichst großen Teil vom Kuchen. Und Krankenhäuser, Pflegeheime oder Arztpraxen lassen sich auch als Unternehmen betrachten, die Gewinne abwerfen können und bei denen sich der Profit möglicherweise auch noch steigern lässt.
Schon 2019 schrieb das Institut Arbeit und Technik in Gelsenkirchen von einem Boom bei Übernahmen durch Finanzinvestoren im Gesundheitswesen. Dieser Boom werde wesentlich von Private-Equity-Gesellschaften getragen. Diese beschränkten sich dabei nicht auf die bloße Übernahme einzelner Arztpraxen, sondern fügten die übernommenen Praxen zu Ketten zusammen.
Solche Ketten werden dann auf Wirtschaftlichkeit getrimmt und sollen mit hoher Rendite betrieben oder auch nach ein paar Jahren gewinnbringend weiterverkauft werden. Das Geschäftsmodell ist hochspekulativ - denn ob sich nach fünf oder sechs Jahren tatsächlich ein neuer Investor findet, der einen noch höheren Preis bezahlt, ist schwer abzuschätzen. Deshalb stehen die Investoren unter Druck, den Wert einer Praxiskette zu erhöhen – beispielsweise durch den Zukauf weiterer Praxen. Oder auch durch Kosteneinsparungen, die zu höheren Gewinnen führen.
Wie viele Praxen in der Hand von Investoren sind, kann niemand sagen. Es gibt dazu keine verlässlichen Daten. In bestimmten Regionen sind es aber zum Teil schon so viele, dass das Bundeskartellamt die Situation beobachtet. Präsident Andreas Mundt spricht von „Konzentrationstendenzen“: „Da haben wir ein waches Auge drauf.“
Das Problem ist nur: Von den meisten Übernahmen erfahren die Wettbewerbshüter gar nichts, weil die Arztpraxen, die übernommen werden, zu klein sind. Denn die Fusionskontrolle greift erst ab einer Umsatzschwelle von 17,5 Millionen Euro. Etwa zehn Praxisübernahmen pro Jahr würden geprüft, sagt Mundt. Untersagt haben die Wettbewerbshüter bislang noch keine.
Laut der Stiftung Gesundheit haben schon 11,7 Prozent der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte ein Angebot zur Übernahme ihrer Praxis von einem Investor bekommen. Besonders gefragt sind der Umfrage zufolge Facharztpraxen: Etwa jeder sechste Facharzt (17,1 Prozent) wurde schon von Investoren wegen einer Übernahme kontaktiert. Von allen Medizinern, die ein Angebot erhalten hatten, nahmen 8,5 Prozent dieses an. Und 25,5 Prozent sagen, sie hätten es angenommen, wenn die Konditionen gestimmt hätten.
Warum dürfen Finanzinvestoren überhaupt Arztpraxen in Deutschland kaufen?
Lange Zeit war es für Finanzinvestoren nicht möglich, Arztpraxen in Deutschland zu kaufen. Denn diese dürfen eigentlich nur von Ärzten betrieben werden. Das änderte sich allerdings vor 20 Jahren, als die Bundesregierung die Einrichtung von Medizinischen Versorgungszentren – kurz MVZ - ermöglichte.
Die Idee war, dass Ärzte verschiedener Fachrichtungen unter einem Dach arbeiten sollten. Auf diese Weise sollte die Versorgung vor allem in den ländlichen Gebieten sichergestellt werden.
Medizinische Versorgungszentren, in denen angestellte Ärzte arbeiten, können zum Beispiel von Kommunen, Ärztegemeinschaften oder Krankenhäusern getragen werden. Und genau dieser Umstand ermöglicht es Finanzinvestoren, sich auch im ambulanten Sektor zu engagieren. Sie kaufen beispielsweise ein kleines Krankenhaus in der Eifel oder im Sauerland, das dann als Trägergesellschaft für Arztpraxen im gesamten Bundesgebiet fungieren kann.
Wie funktioniert das Geschäftsmodell von Private-Equity-Firmen?
Private-Equity-Firmen sind Kapitalsammelstellen. Sie legen Fonds auf, in die vor allem sogenannte institutionelle Anleger – also beispielsweise große Versicherungen oder private Pensionsfonds - Geld investieren, in der Erwartung, nach ein paar Jahren eine möglichst hohe Rendite zu erhalten.
Private-Equity-Gesellschaften haben in bestimmten Kreisen keinen guten Ruf: Sie werden von Kritikern auch gern als „Heuschrecken“ bezeichnet, weil sie vieles der Gewinnerzielung unterordnen und so zum Symbol eines rücksichtslosen Kapitalismus geworden sind.
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat den Vergleich mit dem gefräßigen Tier auch schon im Zusammenhang mit dem Aufkauf von Arztpraxen benutzt: Er wolle den „Einstieg von Heuschrecken“ in Arztpraxen unterbinden, kündigte er an.
Welche Kritik gibt es am Engagement von Finanzinvestoren im medizinischen Sektor?
Patienten müssten sich darauf verlassen können, dass sie die bestmögliche medizinische Behandlung bekommen, wenn sie zum Arzt gehen, sagt Bundesärztekammerpräsident Klaus Reinhardt. Doch das Interesse von Investoren bestehe nun einmal im Wesentlichen darin - wie im üblichen Wirtschaftsleben auch - eine möglichst große Rendite zu erwirtschaften. Das könnte dann Veränderungen bei der medizinischen Versorgung zur Folge haben, sagt Reinhardt: „Davor warnen wir, diese Sorge treibt uns um.“
Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sieht die Übernahmen von Arztpraxen durch Finanzinvestoren sehr kritisch. Er warnt davor, dass es zu einer „Rosinenpickerei“ kommt und sich die neuen Arzt-Zentren vor allem auf die besonders lukrativen Patienten konzentrieren. „Es wird dann oft eine Medizin gemacht, die Gewinne abwerfen muss“, sagt Lauterbach: „Das geht halt nur, wenn ich bestimmte Formen der Behandlung in den Vordergrund stelle, die gewinnträchtig sind.“ Doch wenn Patienten das Gefühl bekämen, dass der wirtschaftliche Anreiz im Vordergrund stehe, verlören sie das Vertrauen in das Gesundheitssystem.
Gibt es auch Gründe, die für den Einstieg von Investoren in den medizinischen Sektor sprechen?
„Der Zweck ist die Patientenversorgung. Würde man schlechte Patientenversorgung liefern, hätte man keine Patienten auf die Dauer, und man hätte auch keine Mitarbeiter“, sagt Sibylle Stauch-Eckmann, Vorsitzende des Bundesverbands der Betreiber Medizinischer Versorgungszentren.
Das würde dann wiederum wirtschaftlichen Gewinn verhindern, so Stauch-Eckmann, die auch Geschäftsführerin von Ortheum, einer auf Orthopädie spezialisierten MVZ-Gruppe, ist. Daher hätten Finanzinvestoren ein großes Interesse daran, eine gute Versorgung für die Patienten anzubieten, betont sie. Die Investitionen seien zielgerichtet als auch langfristig orientiert.
Deshalb sei die Sorge vor einer Kommerzialisierung der ambulanten Versorgung völlig unbegründet, betont Stauch-Eckmann. Das Kapital der privaten Investoren könne viel mehr helfen, Lücken in der Versorgung auszugleichen.
Hinzu komme: Viele junge Ärztinnen und Ärzte wollten sich gar nicht mehr selbstständig machen und eine eigene Praxis erwerben, weil damit finanzielle Risiken und eine hohe Arbeitsbelastung verbunden seien: „Wir müssen der Realität ins Auge schauen, dass die jungen Ärztinnen und Ärzte eine andere Vorstellung haben von ihrer Arbeitswelt.“ Teilzeitangebote, Vereinbarkeit von Beruf und Familie: Das alles werde wichtig.
Wie wird der vermehrte Aufkauf von Arztpraxen politisch diskutiert und wie steht die Bundesregierung dazu?
Der Bundesrat hat schon 2018 davor gewarnt, dass sich „in immer mehr Bereichen der ambulanten ärztlichen Versorgung konzernartige Strukturen ausbreiten, oft in der Hand renditeorientierter Unternehmen". Es könne "zu einer Einengung der angebotenen Versorgung auf bestimmte, besonders lukrative Leistungen" kommen. Kürzlich verabschiedete die Länderkammer erneut einen Antrag an die Bundesregierung, den Spielraum von Finanzinvestoren im ambulanten Sektor zu begrenzen – und legte einen Katalog mit konkreten Maßnahmen vor.
Unter anderem geht es um mehr Transparenz. Wem ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) gehöre, sei weder für Patienten noch Aufsichtsbehörden sichtbar - das soll künftig auf dem Praxisschild stehen. Außerdem müsse ein Register aufgebaut werden, in dem die Eigentumsverhältnisse offengelegt werden, fordert die Länderkammer.
Das unterstützen auch die MVZ-Betreiber. Umstrittener ist dagegen die Forderung, den Anteil von einzelnen MVZ-Betreibern an der Versorgung regional auf maximal 50 Prozent zu begrenzen. Außerdem sollen einzelne Krankenhäuser nicht mehr so einfach als Vehikel für bundesweite Arztketten genutzt werden können. Der Radius, in dem Kliniken MVZ übernehmen oder gründen können, soll auf 50 Kilometer begrenzt werden.
„Gute Versorgung ist nur möglich, wenn ärztliche Entscheidungen unabhängig von Renditeerwartungen getroffen werden“, begründete Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) den Vorstoß der Länderkammer. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hält sich noch bedeckt, was genau er unternehmen will. Dabei hatte er bereits Ende 2022 angekündigt, im ersten Quartal 2023 dazu ein Gesetz vorlegen zu wollen.
„Ich schiebe einen Riegel davor, dass Investoren mit absoluter Profitgier Arztpraxen aufkaufen“, sagte der SPD-Politiker im Dezember 2022 der „Bild am Sonntag“. Auf einen entsprechenden Gesetzentwurf wartet die Öffentlichkeit auch nach Ablauf des zweiten Quartals 2023 allerdings noch immer.
Gerhard Schröder, ahe, dpa