Auf der Suche nach dem Wir-Gefühl
Mythen und Symbole spielen in einer Gesellschaft eine wichtige Rolle, denn aus ihnen speist sich der Zusammenhalt eines Gemeinwesens. Doch den Deutschen sind die positiven geschichtlichen Erfahrungen weitgehend abhanden gekommen, stellt der Politikwissenschaftler Herfried Münkler in seinem Buch "Die Deutschen und ihre Mythen" fest.
Barack Obamas Vereidigungssrede als neuer US-Präsident war ein Lehrstück in der Kunst. die Kraft politischer Mythen einer demokratischen Nation für die Bewältigung der Gegenwart einzusetzen, indem man sie im Blick auf die Zukunft forterzählt. Sogleich kam hierzulande wieder die Frage auf, warum wir keine Politiker mit ähnlich mitreißender Ausstrahlung haben.
Doch Obama hatte gar kein forciertes Pathos einsetzen müssen, um seine Mitbürger zu berühren und für schwierige Zeiten neu zu motivieren. Es genügte, eindringlich an die großen Ideale und Erfolge der amerikanischen Demokratie zu erinnern. Dabei verkörpert Obama als der erste schwarze US-Präsident in seiner Person selbst deren ungebrochene Erneuerungskraft.
In Deutschland aber verfügen wir nun einmal über kein solches Potenzial an Mythen, die durch positive geschichtliche Erfahrungen beglaubigt sind. Wie sie uns abhanden kamen, beziehungsweise warum sie bei uns nicht zum Guten wirkten – darüber hat der Berliner Politikwissenschaftler Herfried Münkler eine fesselnde Studie vorgelegt.
Hinter seiner historischen Untersuchung scheint die bange Frage auf: Was hält ein politisches Gemeinwesen auf Dauer eigentlich zusammen, wenn es nicht auf ein stets abrufbares Reservoir mythologischer Großerzählungen zurückgreifen kann? Denn, so Münkler:
"In politischen Mythen wird das Selbstbewusstsein eines politischen Verbandes zum Ausdruck gebracht. Beziehungsweise dieses Selbstbewusstsein speist sich aus ihnen. Sie sind die narrative Grundlage der symbolischen Ordnung eines Gemeinwesens, die insbesondere dann in Anspruch genommen werden muss, wenn sich Symboliken nicht mehr von selbst erschließen oder wenn es gilt, sie zu erneuern."
Ein Mythos wirkt aber nur dauerhaft, wenn er ständig frei forterzählt und verändert werden kann. Bleibt er – vermittelt durch Literatur und Geschichtsschreibung - nicht ständig im Fluss, erstarrt er im Ikonischen und verblasst. Dieses Problem haben Diktaturen bei seiner Indienstnahme. Anderseits droht das ständige Variieren des Mythos, wenn seine diversen Neuinterpretationen nicht im politischen Handlungsraum erprobt werden können, eine Scheinrealität zu erzeugen. So war es lange in Deutschland, wo der sozialen Trägerschicht der Nationalmythologie, dem Bildungsbürgertum, die volle politische Machtentfaltung verwehrt war.
"Bis 1871 waren Mythen und Symbole die einzige Repräsentation der Nation. Das hatte zur Folge, dass die nationalen Erwartungen und Anstrengungen auf das Feld des Symbolischen verwiesen waren. Was im politischen Erfahrungsraum nicht der Fall war, wurde mit umso größerer Intensität in den Erwartungshorizont hineingeschrieben, und der wurde über weite Strecken durch Mythen illustriert. Heinrich Heine hat das deutsche Streben ins ´Luftrevier` verspottet, aber kaum einer hat besser gewusst als er, welche gewaltige Kraft von diesen ´Hirngespinsten´ ausgehen konnte."
Durch die Herausbildung und die Umformungen deutscher Nationalmythen wie die vom Kaiser Barbarossa, den Nibelungen oder Hermann, dem Cherusker wurde Deutschland im 19. Jahrhundert - so Münkler - "ein regelrechtes Dorado der politischen Mythographien". Auch Orte dienten als Projektionsflächen nationaler Einheits- und Größensehnsucht: die Wartburg, Nürnberg, Dresden, der Rhein. Von ihnen hat eigentlich nur der Mythos Dresdens, das noch kurz vor Kriegsende durch alliierte Bombenangriffe zerstört wurde, die Ausplünderung des deutschen Mythenschatzes durch den Nationalsozialismus überstanden. In gewandelter Bedeutung:
"Der Wiederaufbau der Frauenkirche wurde zu einer Art Abschluss der Wiedervereinigung, bei dem die letzte klaffende ´Wunde` des Krieges fünfzig bis sechzig Jahre nach dessen Ende geschlossen wurde – er wurde selbst zum Mythos, der von der Rückgewinnung des vernichteten Dresden als der ´schönsten Stadt Deutschlands` berichtet. Das im Krieg Zertrümmerte wurde restauriert und wieder zusammengefügt (…)"
Nach dem Krieg hatten sich die Bundesrepublik und die DDR eine Art Duell der Gegenmythen geliefert. Der großen Erzählung vom antifaschistischen Widerstand und vom Erbe der frühbürgerlichen Revolution standen die Narrative von Währungsreform und Wirtschaftswunder gegenüber. Nach dem Wegfall der Systemkonkurrenz aber bleibt die mythische Unterfütterung nationalen Selbstbewusstseins nun vor allem Werbekampagnen und medialen Inszenierungen überlassen. Deren Funktionsweise analysiert Münkler anhand der Kampagne "Du bist Deutschland", mit der die Deutschen 2006 zu mehr persönlichem Einsatz für ihr Landes motiviert werden sollten. Einer solchen Kampagne fallen Aufgaben zu,
""die ansonsten Gründungs- und Orientierungsmythen übernehmen. Sie soll das Wir-Bewusstsein stärken und die Bereitschaft fördern, sich für die Aufgaben der Gemeinschaft in die Pflicht nehmen zu lassen. Das geht nicht ohne einen starken Zugriff auf die Emotionalität der Menschen. Wurde sie in den klassischen politischen Mythen durch heroische Opfererzählungen, kollektive Verheißungen, gemeinsame Verpflichtungen und narrative Beglaubigungen stimuliert, so tritt in den Werbekampagnen die Erzählung in den Hintergrund.: Wenig Text wird in viele Bilder umgesetzt, wobei der Text von vorneherein im Hinblick auf diese Bilder konzipiert wird."
Doch Konzeption und Inhalt solcher Kampagnen bleiben einer kleinen Gruppe von Kreativspezialisten überlassen, wendet Münkler ein. Die Bürger verharren in der Position passiver Zuschauer. Auch stünden hier, anders als beim vieldeutigen Mythos, eindeutige Zwecke von vorneherein fest:
"Der Wirtschaftsstandort Deutschland muss vermarktet werden, und dabei stört die schlechte Stimmungslage der Bevölkerung. Also muss man sie aufhellen."
Derartig durchschaubare mediale Botschaften verpuffen schnell. Je stärker aber die politische Partizipation in der Demokratie werde, umso nötiger seien dauerhaft verbindende Großerzählungen, mahnt Münkler. Woher sie freilich in Deutschland kommen sollen, kann auch er nicht sagen. Doch sein Buch objektiviert die Debatte über politische Mythen. Jenseits des Generalverdachts, sie dienten stets reaktionären Zwecken, analysiert Herfried Münkler präzise die Bedingungen, unter denen sie Fluch statt Segen wurden.
Herfried Münkler: Die Deutschen und ihre Mythen
Rowohlt Berlin Verlag, Berlin/2009
Doch Obama hatte gar kein forciertes Pathos einsetzen müssen, um seine Mitbürger zu berühren und für schwierige Zeiten neu zu motivieren. Es genügte, eindringlich an die großen Ideale und Erfolge der amerikanischen Demokratie zu erinnern. Dabei verkörpert Obama als der erste schwarze US-Präsident in seiner Person selbst deren ungebrochene Erneuerungskraft.
In Deutschland aber verfügen wir nun einmal über kein solches Potenzial an Mythen, die durch positive geschichtliche Erfahrungen beglaubigt sind. Wie sie uns abhanden kamen, beziehungsweise warum sie bei uns nicht zum Guten wirkten – darüber hat der Berliner Politikwissenschaftler Herfried Münkler eine fesselnde Studie vorgelegt.
Hinter seiner historischen Untersuchung scheint die bange Frage auf: Was hält ein politisches Gemeinwesen auf Dauer eigentlich zusammen, wenn es nicht auf ein stets abrufbares Reservoir mythologischer Großerzählungen zurückgreifen kann? Denn, so Münkler:
"In politischen Mythen wird das Selbstbewusstsein eines politischen Verbandes zum Ausdruck gebracht. Beziehungsweise dieses Selbstbewusstsein speist sich aus ihnen. Sie sind die narrative Grundlage der symbolischen Ordnung eines Gemeinwesens, die insbesondere dann in Anspruch genommen werden muss, wenn sich Symboliken nicht mehr von selbst erschließen oder wenn es gilt, sie zu erneuern."
Ein Mythos wirkt aber nur dauerhaft, wenn er ständig frei forterzählt und verändert werden kann. Bleibt er – vermittelt durch Literatur und Geschichtsschreibung - nicht ständig im Fluss, erstarrt er im Ikonischen und verblasst. Dieses Problem haben Diktaturen bei seiner Indienstnahme. Anderseits droht das ständige Variieren des Mythos, wenn seine diversen Neuinterpretationen nicht im politischen Handlungsraum erprobt werden können, eine Scheinrealität zu erzeugen. So war es lange in Deutschland, wo der sozialen Trägerschicht der Nationalmythologie, dem Bildungsbürgertum, die volle politische Machtentfaltung verwehrt war.
"Bis 1871 waren Mythen und Symbole die einzige Repräsentation der Nation. Das hatte zur Folge, dass die nationalen Erwartungen und Anstrengungen auf das Feld des Symbolischen verwiesen waren. Was im politischen Erfahrungsraum nicht der Fall war, wurde mit umso größerer Intensität in den Erwartungshorizont hineingeschrieben, und der wurde über weite Strecken durch Mythen illustriert. Heinrich Heine hat das deutsche Streben ins ´Luftrevier` verspottet, aber kaum einer hat besser gewusst als er, welche gewaltige Kraft von diesen ´Hirngespinsten´ ausgehen konnte."
Durch die Herausbildung und die Umformungen deutscher Nationalmythen wie die vom Kaiser Barbarossa, den Nibelungen oder Hermann, dem Cherusker wurde Deutschland im 19. Jahrhundert - so Münkler - "ein regelrechtes Dorado der politischen Mythographien". Auch Orte dienten als Projektionsflächen nationaler Einheits- und Größensehnsucht: die Wartburg, Nürnberg, Dresden, der Rhein. Von ihnen hat eigentlich nur der Mythos Dresdens, das noch kurz vor Kriegsende durch alliierte Bombenangriffe zerstört wurde, die Ausplünderung des deutschen Mythenschatzes durch den Nationalsozialismus überstanden. In gewandelter Bedeutung:
"Der Wiederaufbau der Frauenkirche wurde zu einer Art Abschluss der Wiedervereinigung, bei dem die letzte klaffende ´Wunde` des Krieges fünfzig bis sechzig Jahre nach dessen Ende geschlossen wurde – er wurde selbst zum Mythos, der von der Rückgewinnung des vernichteten Dresden als der ´schönsten Stadt Deutschlands` berichtet. Das im Krieg Zertrümmerte wurde restauriert und wieder zusammengefügt (…)"
Nach dem Krieg hatten sich die Bundesrepublik und die DDR eine Art Duell der Gegenmythen geliefert. Der großen Erzählung vom antifaschistischen Widerstand und vom Erbe der frühbürgerlichen Revolution standen die Narrative von Währungsreform und Wirtschaftswunder gegenüber. Nach dem Wegfall der Systemkonkurrenz aber bleibt die mythische Unterfütterung nationalen Selbstbewusstseins nun vor allem Werbekampagnen und medialen Inszenierungen überlassen. Deren Funktionsweise analysiert Münkler anhand der Kampagne "Du bist Deutschland", mit der die Deutschen 2006 zu mehr persönlichem Einsatz für ihr Landes motiviert werden sollten. Einer solchen Kampagne fallen Aufgaben zu,
""die ansonsten Gründungs- und Orientierungsmythen übernehmen. Sie soll das Wir-Bewusstsein stärken und die Bereitschaft fördern, sich für die Aufgaben der Gemeinschaft in die Pflicht nehmen zu lassen. Das geht nicht ohne einen starken Zugriff auf die Emotionalität der Menschen. Wurde sie in den klassischen politischen Mythen durch heroische Opfererzählungen, kollektive Verheißungen, gemeinsame Verpflichtungen und narrative Beglaubigungen stimuliert, so tritt in den Werbekampagnen die Erzählung in den Hintergrund.: Wenig Text wird in viele Bilder umgesetzt, wobei der Text von vorneherein im Hinblick auf diese Bilder konzipiert wird."
Doch Konzeption und Inhalt solcher Kampagnen bleiben einer kleinen Gruppe von Kreativspezialisten überlassen, wendet Münkler ein. Die Bürger verharren in der Position passiver Zuschauer. Auch stünden hier, anders als beim vieldeutigen Mythos, eindeutige Zwecke von vorneherein fest:
"Der Wirtschaftsstandort Deutschland muss vermarktet werden, und dabei stört die schlechte Stimmungslage der Bevölkerung. Also muss man sie aufhellen."
Derartig durchschaubare mediale Botschaften verpuffen schnell. Je stärker aber die politische Partizipation in der Demokratie werde, umso nötiger seien dauerhaft verbindende Großerzählungen, mahnt Münkler. Woher sie freilich in Deutschland kommen sollen, kann auch er nicht sagen. Doch sein Buch objektiviert die Debatte über politische Mythen. Jenseits des Generalverdachts, sie dienten stets reaktionären Zwecken, analysiert Herfried Münkler präzise die Bedingungen, unter denen sie Fluch statt Segen wurden.
Herfried Münkler: Die Deutschen und ihre Mythen
Rowohlt Berlin Verlag, Berlin/2009
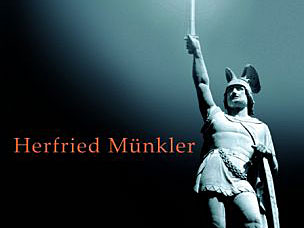
Herfried Münkler: Die Deutschen und ihre Mythen© Rowohlt Berlin Verlag
