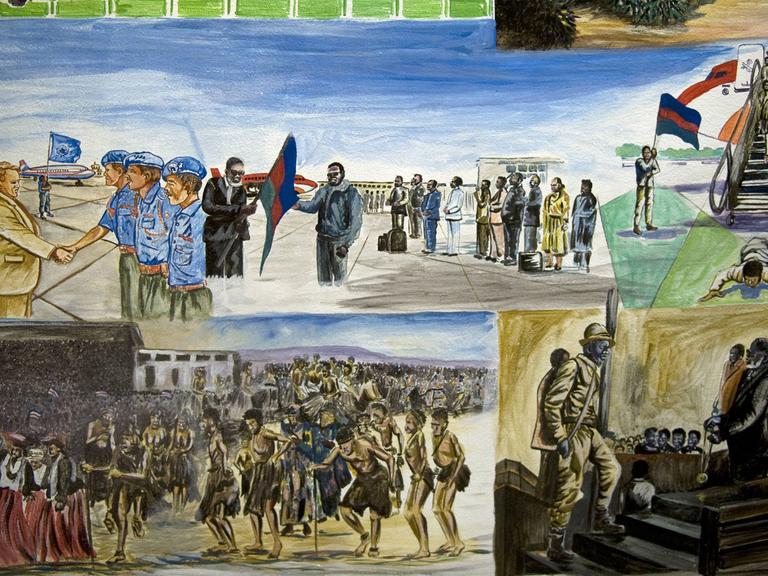„Es ist schwierig, sich dieser Geschichte zu stellen“
13:23 Minuten

Die Geschichte der Mission in Afrika ist auch eine Geschichte des Kolonialismus. Der evangelische Pfarrer Jean-Félix Belinga Belinga spricht über Machtmissbrauch, die Rolle der Frau in afrikanischen Kirchen und die Chance, voneinander zu lernen.
Christopher Ricke: In unserer Denkfabrik beschäftigen wir uns mit Kolonialismus und in diesem Gespräch zusätzlich mit Mission und mit dem, was beides verbindet und trennt. Ich spreche jetzt mit dem evangelischen Pfarrer und Autor Jean-Félix Belinga Belinga. Er lebt in Hessen, stammt aus Kamerun, also einem Land, das bis vor gut 100 Jahren deutsche Kolonie war. Wie schauen Sie denn als Nichtweißer auf diese deutschen Versuche, die eigenen Kolonial- und auch die eigene Missionsgeschichte aufzuarbeiten?
Belinga Belinga: Die Kolonialgeschichte Deutschlands ist wie in allen anderen europäischen Ländern natürlich eine Geschichte, in der leider sehr viele negative Attribute hervorstechen. Es sind Attribute, die – so wie ich das persönlich empfinde – für die Menschen in den ehemaligen Kolonien kratzen und richtig weh tun. Da haben wir es mit Missbrauch von Macht zu tun, wir haben es mit Raub zu tun, mit Missachtung der Würde des Menschen und so weiter. Es wird dadurch auch schwierig, sich all dem in der Gegenwart zu stellen. Mein Eindruck ist, dass man es lieber als vergangen und zum Teil verdeckt behalten will und nicht bereit ist, sich der Realität dieser Geschichte zu stellen.
Ricke: Das ist eine Realität der Geschichte, die bis in die heutige Zeit reicht.
Belinga Belinga: Sie reicht bis in die heutige Zeit. Die Folgen dieser Geschichte werden in der Gegenwart immer wieder wahrgenommen. Letztlich hängen auch die Migrationsbewegungen, die wir im Zusammenhang mit Afrika wahrnehmen, ganz eng mit dieser Geschichte zusammen.
Wessen Erinnerung zählt?
Ricke: Wir beschäftigen uns bei Deutschlandradio in unseren drei Programmen schon das ganz Jahr über mit dem Thema Dekolonialisierung, wir reden darüber und versuchen auch, mit Betroffenen ins Gespräch zu kommen, also eine Art Miteinander zu finden. Da geht es natürlich auch um die Missionsgeschichte. Wie wichtig ist denn dieses miteinander ins Gespräch kommen?
Belinga Belinga: Das Miteinanderreden ist für mich das A und O, ist extrem wichtig, hat aber auch klare Anforderungen. Nur wenn wir die gegenseitigen Meinungen ernst nehmen, können wir weiterkommen.
Aber die postkoloniale Ära ist auch schon davon geprägt, dass die mächtigere Seite, die der ehemaligen Kolonialherren, die Macht besitzt, festzulegen, was wichtig ist und was nicht. Ein derartig gestaltetes Miteinanderreden hat für mich keine Zukunft.
Einfluss der Missionare wirkt bis heute nach
Ricke: Machen wir es konkret. Vielleicht können Sie mal die Position Kameruns einnehmen und sagen: Dieser Punkt, der wird weder von Deutschland noch von den westeuropäischen Kirchen wirklich gesehen und auch angesprochen.
Belinga Belinga: Da ist zum Beispiel die Frage der Frauenordination in den Kirchen. Wir haben es immer sehr leicht, wenn wir sagen, viele afrikanischen Kirchen, die wollen gar nichts davon haben, die halten von den Frauen gar nichts und so weiter. Wir sehen aber nicht unsere eigene Verantwortung an diesem Punkt. Welche Kirche haben wir denn den Afrikanerinnen und Afrikanern vermittelt? War das eine Kirche, die einen Platz für alle Frauen ließ? Das glaube ich nicht.
Meine Heimatkirche in Kamerun stellt heute immer noch die Frage, haben denn die Missionare Frauen ordiniert? Und wenn die Missionare das nicht gemacht haben, dann lohnt es sich auch nicht, diese Frage in der Gegenwart zu stellen. Das heißt, die Missionare sind die Instanz, auf die wir uns berufen.
Negatives Frauenbild christlicher Traditionen
Wir haben den Menschen in anderen Erdteilen eine Kirche vermittelt, die sich unbedingt von der Aufklärung distanzieren wollte, und weil sie sich eben von der Aufklärung distanzierte, hat sie Formen gesucht, die traditioneller waren, die archaischer waren und dadurch auch ein Bild aus der Bibel geschöpft, das die Frau zunichte machte.
Da ist die Frage mit dem Blut, da ist die Rede davon, dass die Frau letztlich von der Rippe des Mannes gemacht worden ist, und die Frau ist auch diejenige, die den Mann verführt hat. Das sind alles Bilder, die dann in so eine Predigt einfließen, die dann natürlich ein sehr, sehr negatives Bild von der Frau geben. Das ist das Bild der Frau, das die Missionare in den entstehenden Kirchen installiert haben.
Ricke: Jetzt sehen Sie mich aber tatsächlich ratlos, Herr Belinga Belinga. Das ist geschehen, aber das können Missionare doch jetzt nicht ändern. Das muss doch tatsächlich dann in den Ortskirchen geschehen.
Belinga Belinga: Das kann nur in den Ortskirchen geschehen, das sehe ich genauso. Aber wir müssen erst einmal versuchen wahrzunehmen, wie tief dieses Bild oder diese Lehre in die Menschen reingegangen ist, wie tief dieses Bild verankert ist im Denken der Kirchen.
Fehler der Missionszeit eingestehen
Dann können wir auch besser verstehen, warum sich die Kirchen so schwer damit tun. Das heißt, wir müssen erst einmal akzeptieren, dass wir einen Fehler gemacht haben, indem wir ihnen genau dieses Bild vermittelt haben. Ob sie heute anders damit umgehen wollen, das ist selbstverständlich ihre Sache.
Ricke: Das sind beschriebene Fehlentwicklungen aus der Vergangenheit, die bis heute reichen, aber es gibt tatsächlich auch Fehlentwicklungen, die bei uns Tag für Tag stattfinden. Zum Beispiel die Frage nach der Würde des Menschen, und zwar jetzt nicht unbedingt in Afrika, sondern durchaus hier in Deutschland.
Wenn nicht jedes Kind lernt, dass jeder Mensch die gleiche Würde hat, unabhängig von Geschlecht und Hautfarbe, dann hat es dieses Kind als Erwachsener vielleicht schwer, vernünftig, demokratisch auf der Basis des Grundgesetzes zu leben, was dort steht, nämlich die Unantastbarkeit der Würde des Menschen zu akzeptieren. Damit solche Fehler, wie Sie sie beschrieben haben, sich nicht wiederholen, was kann man da heute tun?
Belinga Belinga: Wir haben meiner Meinung nach eine exzellente Möglichkeit, Kindern schon im Kindergartenalter die Welt zu zeigen – wir erzählen ihnen Geschichten, sie lesen, sie bekommen Geschichten aus Büchern vorgetragen. Wenn wir uns die Mühe machen, diese Möglichkeit in einer gesunden Art und Weise zu nutzen, tun wir unserer Zukunft einen tollen Dienst.
Rassistische Klischees in Kinderbüchern
Als vor ein paar Jahren zum Beispiel die Diskussion um die Kinderbücher kam, das Bild von Fremden in den Kinderbüchern, da verging das leider viel zu schnell wieder. Ich frage mich, warum wir solche Diskussionen überhaupt erst anfangen, wenn die nach kurzer Zeit wieder einschlafen.
Ricke: Sie meinen jetzt die Debatte, in der bei Astrid Lindgren in „Pippi Langstrumpf“ der Vater zum „Südseekönig“ wurde, der vorher anders hieß?
Belinga Belinga: Ja, wobei in den Geschichten von Astrid Lindgren, da finde ich es immer noch relativ harmlos. Harmlos finde ich es auch in „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“. Sehr, sehr viel schwieriger finde ich es, wenn Bilder in Kinderbüchern auftauchen, wo ein Mensch mit einer Frisur auftaucht, mit einem Knochen in die Haare gesteckt, oder wo Menschen gekocht werden, weil sie letztlich bei Kannibalen angekommen sind. Also Bilder, die so weit weg von der Realität sind, dass man sich fragt, warum gerade solche Bilder Kindern gezeigt werden müssen. Ich habe das Gefühl, es geht auch um das Exotische, was da drinsteckt, was vielleicht das Ganze interessanter macht.
Hartnäckiges Verlangen nach Exotik
Ricke: Wie haben Sie das denn selber erlebt, als Sie vor Jahrzehnten zum Studium nach Deutschland kamen? Da standen Sie auf einmal mitten im Alltag und sind möglicherweise wegen Ihrer Hautfarbe auch als, so wie Sie es gerade gesagt haben, „Exot“ wahrgenommen worden.
Belinga Belinga: Es gibt eine Art, Menschen, die durch ihre äußere Erscheinung fremd aussehen, wahrzunehmen. Man kann ihnen negative Attribute verleihen oder auch positive – die positiven Attribute haben aber meistens einen eher exotischen Charakter. Ich konnte viel Sympathie bei den Menschen genießen, war aber auch mit der Frage sehr schnell konfrontiert, warum ich nach Deutschland gekommen bin.
Meine Gegenüber waren oft enttäuscht, wenn ich keine Kriegsgeschichten zu erzählen hatte, die mich zur Flucht von meiner Heimat getrieben hätten. Eine solche Geschichte hätte interessanter geklungen als die Realität. Wenn die Realität ganz harmlos ist, also normal, dann ist es eher langweilig.
Festgelegt auf den „afrikanischen Hintergrund“
Ricke: Ist denn da was besser geworden in den letzten 30, 40, 50 Jahren, oder ist das immer noch so?
Belinga Belinga: Es ist immer noch so, nur nicht mehr so intensiv. Das Muster ist immer noch das gleiche. In vielen Gesprächen höre ich auch immer raus, ich soll doch jetzt mal das Empfinden des Afrikaners in ein Thema reinbringen, das wir gerade miteinander diskutieren. Auch im Kreis von Kollegen bin ich nicht nur Kollege, sondern „der mit dem afrikanischen Hintergrund“. Und dieser afrikanische Hintergrund hat immer zu erscheinen. Das enttäuscht mich manchmal und macht mich wirklich manchmal ein bisschen ratlos.
Ricke: Schauen wir noch mal auf das Thema Mission, bei dem wir vorhin schon waren, wo Sie beklagt haben, was Missionare in missionierten Gebieten angerichtet haben. Wir sind in Deutschland inzwischen an einem Punkt, wo Deutschland längst Missionsgebiet ist, wo Priester „importiert“ werden, weil das Land immer heidnischer wird.
Vor 1400 Jahren kamen irische Mönche, um den Germanen das Christentum zu verkünden. Sind wir vielleicht bald irgendwann so weit, dass tatsächlich aus Lateinamerika oder aus Afrika die Menschen kommen, um uns nochmal mit der Botschaft vertraut zu machen?
Dialog auf Augenhöhe führen
Belinga Belinga: Wir können jetzt nicht mehr mit Mission anfangen. Ich denke, die Mission hat einfach auch durch ihre Geschichte ein sehr, sehr negatives Bild bekommen. Wir können das Ganze heute sehr viel positiver gestalten. Ich denke, wenn wir das Verhältnis entstehen lassen, dass die einen etwas bringen, was gut ist für die anderen, und nur die Bringer haben es selber so identifiziert als Gutes, dann machen wir genau den gleichen Fehler. Also, die einen müssen nicht für die anderen daherkommen und ihnen etwas bringen, was sie angeblich nicht haben.
Ich baue auf Dialog auf Augenhöhe, weil ich denke, wir sind tatsächlich Kirche auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Wir haben eine andere Vergangenheit als die Christen hier in Europa, wir haben eine andere Geschichte. Und was macht uns zu Christen? Darüber können wir unendlich viele Themen finden, die hochbrisant, hochinteressant sein können.
Wir verwickeln uns mit dem Begriff Mission immer in eine mögliche Begegnung, die sehr viel Unheil bringen könnte. Wer etwas bringt und das dem anderen geben muss oder das Gefühl hat, es geben zu müssen, der bringt auch die Macht mit, und das ist keine gesunde Begegnung.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandfunk Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.