Aufräumen mit der kollektiven Ausrede
Der Historiker Mommsen ringt immer mit entscheidenden Fragen: Wie konnte die NS-Ideologie Zustimmung finden? Wie konnte sich das Dritte Reich zum totalen Verbrecherregime entwickeln? Wie viel Entgegentreten war möglich?
Es war ja so einfach, damals, in den ersten Jahrzehnten nach dem Krieg. Im Osten, in der neu-antifaschistischen DDR hatte man sich darauf geeinigt, dass an der Katastrophe des Dritten Reiches nur die kapitalistischen Bonzen schuld seien. Und die saßen ja im Westen.
Dort wiederum versicherte man sich gegenseitig: Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit hatten ein anständiges Volk in die Arme eines teuflisch begabten Redners und Verführers getrieben. Für die Verbrechen war nur eine kleine Gruppe hochrangiger Nazis verantwortlich.
Heute klingen diese kollektiven Ausreden hohl und billig. Und das verdanken wir einer neuen Geschichtsschreibung, die sich nicht allein mit den Taten und Untaten der Staatenlenker und den Geschehnissen in den Kommandozentralen beschäftigt – sondern auch mit den komplexen Abläufen im gesellschaftlichen Maschinenraum.
Hans Mommsen ist einer der wichtigsten Chronisten des deutschen Maschinenraums. Kaum jemand hat so entschieden mit der Unkultur der kollektiven Ausrede aufgeräumt wie er. Wie entschieden und auch wie differenziert, ist in dieser Aufsatzsammlung anlässlich seines 80. Geburtstages zu besichtigen.
Ganz klar notiert Mommsen, der im Grunde ein verzweifelter Verteidiger des Bürgertums ist:
"Es war in den zwölf Jahren der nationalsozialistischen Diktatur nicht gelungen, die bürgerlichen Strukturen zu zerschlagen, obwohl sie massiv geschwächt wurden. Neben der Penetration durch die NS-Organisationen ist eine tief greifende moralische Korrumpierung der bürgerlichen Über- und Mittelschicht zu konstatieren, die sich bereitwillig am jüdischen Eigentum bereicherte und den gewaltsamen Verfolgungen, auch den Deportationen nicht entgegen trat, obwohl das, wie der Fall der Euthanasie zeigt, nicht ganz unmöglich gewesen war."
Die Eitelkeit – und Einsamkeit – des Akademikers, der seinen Elfenbeinturm mit undurchdringlichem Sprachdickicht vor unerwünschten Eindringlingen schützt, ist ihm gänzlich fremd. Größten Respekt hat er für den Publizisten Sebastian Haffner übrig, der sehr früh begriff, dass der Nationalsozialismus keine geschlossene Weltanschauung, sondern eine aus lauter Versatzstücken bestehende Ideologie war:
"Es dauerte mehr als drei Jahrzehnte, bis sich in der zeitgeschichtlichen Forschung ähnliche Auffassungen durchzusetzen begann, die den überwiegend manipulativen Charakter und die Substanzlosigkeit der NS-Ideologie hervorhoben."
Vor allem Haffners "Geschichte eines Deutschen" - bereits 1939 verfasst - sei bahnbrechend gewesen, so Mommsen.
"Sie zwingt dazu den Zusammenhang zwischen der Rolle Hitlers und den angestammten Defiziten der deutschen politischen Kultur neu zu überdenken, ohne in einen fragwürdigen Hitlerzentrismus zu verfallen, dessen apologetische Tendenz offen zu Tage liegt. All das ist umso bemerkenswerter, als Haffner seine Einsichten ohne Kenntnis von internem Material, allein aufgrund seines sorgfältigen Studiums der zugänglichen gedruckten Quellen aufschrieb."
Immer – das wird in den Aufsätzen Mommsens zum Ende der Weimarer Republik, zu Hitlers Aufstieg, zur Verfolgung und Ermordung der Juden oder auch zum Widerstand deutlich – immer ringt der Historiker um entscheidende Fragen: Wie konnte eine wild zusammengewürfelte Ideologie je Zustimmung finden? Warum und wie konnte sich das Dritte Reich zum totalen Verbrecherregime entwickeln? Und wie viel Entgegentreten war möglich?
Ernst Nolte wollte im Holocaust nur eine Antwort auf die bolschewistischen Untaten sehen. Daniel Jonah Goldhagen unterstellte den Deutschen einen eliminatorischen Antisemitismus, der schon seit Jahrhunderten bestanden hätte. Diesen großen Vereinfachern ist Hans Mommsen in der öffentlichen Auseinandersetzung immer entschieden entgegen getreten.
Wie tief ihn die Frage der möglichen Tat gegen das Verbrechen berührt, zeigt auch seine Beschäftigung mit dem konservativ-bürgerlichen Widerstand. Es ist ihm nicht möglich, die Männer hinter dem Staatsstreich des 20. Juli zu heroisieren. Aber es ist ihm auch keine überhebliche Beurteilungsfreude zueigen, die den Widerstand als zu spät, zu zaghaft, zu unentschlossen abschreiben würde. Bei der Behandlung des Widerstands, darauf besteht er,
"… steht weniger die Frage im Vordergrund, welche Chancen für einen Umsturz unter den jeweils wechselnden Konstellationen vorhanden waren, als vielmehr die Frage nach der denkbaren politisch-gesellschaftlichen Alternative zur NS-Herrschaft."
Hier gehört seine Sympathie ganz deutlich Helmuth James Graf von Moltke und dem Kreisauer Kreis, der einen solchen Neuansatz am radikalsten dachte.
Hans Mommsen hat alte Mythen zertrümmert und wie kaum ein anderer zu einem differenzierten Blick auf das Dritte Reich beigetragen. Das macht ihn zu einem wichtigen Zeitgeschichtler. Dass er aber keine abschließenden Antworten auf die entscheidende Frage des "Warum war das möglich" gefunden hat, dass er immer noch ringt – das macht ihn zu einem der ganz großen Historiker.
Hans Mommsen: Zur Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert. Demokratie, Diktatur, Widerstand
Deutsche Verlags-Anstalt, München 2010
Dort wiederum versicherte man sich gegenseitig: Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit hatten ein anständiges Volk in die Arme eines teuflisch begabten Redners und Verführers getrieben. Für die Verbrechen war nur eine kleine Gruppe hochrangiger Nazis verantwortlich.
Heute klingen diese kollektiven Ausreden hohl und billig. Und das verdanken wir einer neuen Geschichtsschreibung, die sich nicht allein mit den Taten und Untaten der Staatenlenker und den Geschehnissen in den Kommandozentralen beschäftigt – sondern auch mit den komplexen Abläufen im gesellschaftlichen Maschinenraum.
Hans Mommsen ist einer der wichtigsten Chronisten des deutschen Maschinenraums. Kaum jemand hat so entschieden mit der Unkultur der kollektiven Ausrede aufgeräumt wie er. Wie entschieden und auch wie differenziert, ist in dieser Aufsatzsammlung anlässlich seines 80. Geburtstages zu besichtigen.
Ganz klar notiert Mommsen, der im Grunde ein verzweifelter Verteidiger des Bürgertums ist:
"Es war in den zwölf Jahren der nationalsozialistischen Diktatur nicht gelungen, die bürgerlichen Strukturen zu zerschlagen, obwohl sie massiv geschwächt wurden. Neben der Penetration durch die NS-Organisationen ist eine tief greifende moralische Korrumpierung der bürgerlichen Über- und Mittelschicht zu konstatieren, die sich bereitwillig am jüdischen Eigentum bereicherte und den gewaltsamen Verfolgungen, auch den Deportationen nicht entgegen trat, obwohl das, wie der Fall der Euthanasie zeigt, nicht ganz unmöglich gewesen war."
Die Eitelkeit – und Einsamkeit – des Akademikers, der seinen Elfenbeinturm mit undurchdringlichem Sprachdickicht vor unerwünschten Eindringlingen schützt, ist ihm gänzlich fremd. Größten Respekt hat er für den Publizisten Sebastian Haffner übrig, der sehr früh begriff, dass der Nationalsozialismus keine geschlossene Weltanschauung, sondern eine aus lauter Versatzstücken bestehende Ideologie war:
"Es dauerte mehr als drei Jahrzehnte, bis sich in der zeitgeschichtlichen Forschung ähnliche Auffassungen durchzusetzen begann, die den überwiegend manipulativen Charakter und die Substanzlosigkeit der NS-Ideologie hervorhoben."
Vor allem Haffners "Geschichte eines Deutschen" - bereits 1939 verfasst - sei bahnbrechend gewesen, so Mommsen.
"Sie zwingt dazu den Zusammenhang zwischen der Rolle Hitlers und den angestammten Defiziten der deutschen politischen Kultur neu zu überdenken, ohne in einen fragwürdigen Hitlerzentrismus zu verfallen, dessen apologetische Tendenz offen zu Tage liegt. All das ist umso bemerkenswerter, als Haffner seine Einsichten ohne Kenntnis von internem Material, allein aufgrund seines sorgfältigen Studiums der zugänglichen gedruckten Quellen aufschrieb."
Immer – das wird in den Aufsätzen Mommsens zum Ende der Weimarer Republik, zu Hitlers Aufstieg, zur Verfolgung und Ermordung der Juden oder auch zum Widerstand deutlich – immer ringt der Historiker um entscheidende Fragen: Wie konnte eine wild zusammengewürfelte Ideologie je Zustimmung finden? Warum und wie konnte sich das Dritte Reich zum totalen Verbrecherregime entwickeln? Und wie viel Entgegentreten war möglich?
Ernst Nolte wollte im Holocaust nur eine Antwort auf die bolschewistischen Untaten sehen. Daniel Jonah Goldhagen unterstellte den Deutschen einen eliminatorischen Antisemitismus, der schon seit Jahrhunderten bestanden hätte. Diesen großen Vereinfachern ist Hans Mommsen in der öffentlichen Auseinandersetzung immer entschieden entgegen getreten.
Wie tief ihn die Frage der möglichen Tat gegen das Verbrechen berührt, zeigt auch seine Beschäftigung mit dem konservativ-bürgerlichen Widerstand. Es ist ihm nicht möglich, die Männer hinter dem Staatsstreich des 20. Juli zu heroisieren. Aber es ist ihm auch keine überhebliche Beurteilungsfreude zueigen, die den Widerstand als zu spät, zu zaghaft, zu unentschlossen abschreiben würde. Bei der Behandlung des Widerstands, darauf besteht er,
"… steht weniger die Frage im Vordergrund, welche Chancen für einen Umsturz unter den jeweils wechselnden Konstellationen vorhanden waren, als vielmehr die Frage nach der denkbaren politisch-gesellschaftlichen Alternative zur NS-Herrschaft."
Hier gehört seine Sympathie ganz deutlich Helmuth James Graf von Moltke und dem Kreisauer Kreis, der einen solchen Neuansatz am radikalsten dachte.
Hans Mommsen hat alte Mythen zertrümmert und wie kaum ein anderer zu einem differenzierten Blick auf das Dritte Reich beigetragen. Das macht ihn zu einem wichtigen Zeitgeschichtler. Dass er aber keine abschließenden Antworten auf die entscheidende Frage des "Warum war das möglich" gefunden hat, dass er immer noch ringt – das macht ihn zu einem der ganz großen Historiker.
Hans Mommsen: Zur Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert. Demokratie, Diktatur, Widerstand
Deutsche Verlags-Anstalt, München 2010
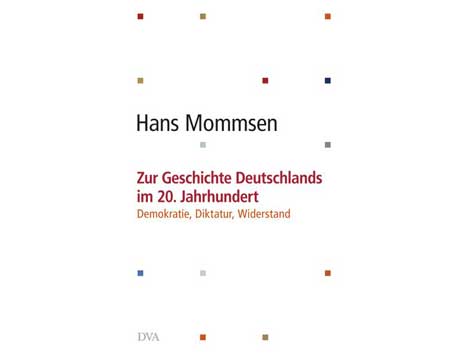
Cover: "Zur Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert" von Hans Mommsen© Deutsche Verlags-Anstalt
