Aufstieg und Niedergang der islamischen Zivilisation
Ibn Khladun befasste sich schon im 14. Jahrhundert mit Recht, Steuern, Ökonomie und beschreibt seine Erkenntnisse über das Leben in der Wüste und den Städten Nordafrikas in der "Muqaddima". Die Übersetzerin Alma Giese zeigt jetzt, wie aktuell Ibn Khaldûn immer noch ist.
Klassische arabische Texte müsse man im Original lesen, sagen all jene, die des Arabischen mächtig sind. Anders könne man nicht erfahren, wie schön ihr Ausdruck, wie gehaltvoll ihre Aussage sei. Ibn Khaldûn aber macht selbst Experten zu schaffen.
Alma Giese zitiert ihre Kollegin Annemarie Schimmel, um anzudeuten, dass die Muqaddima, diese breite sozial- und geisteswissenschaftliche Einführung in ein großes Geschichtsbuch, schwer zu lesen und zu verstehen sei, so kompliziert wäre der Satzbau, so selten die Wörter, so vielfältig die Themen.
Umso überraschter wird der Leser sein, wie verständlich Ibn Khaldûn schreibt, wie nah uns der Autor aus dem 14. Jahrhundert sprachlich kommt, wie prägnant der gelehrte Beobachter des arabisch-islamischen Lebens in Wüste und Städten Nordafrikas vieles formuliert, was uns auch heute noch beschäftigt. Das ist die Leistung der Übersetzerin, die einen biblisch anmutenden Erzählstil mit der nüchternen Wortwahl der Moderne verbindet.
Und so sehen auch die Orientalisten Ibn Khaldûn: Einen gründlichen Wissenschaftler, erfahren als Politiker und oberster Richter, der seiner Zeit voraus war und bereits damals Methoden der Forschung einforderte, die mittlerweile als Standard gelten. Wissenschaftstheorie und Geschichte sind seine Fachgebiete. Aber nicht nur: Er behandelte genauso Religion und Ethik, gute Regierungsführung, Soziologie und Ökonomie, Stadtentwicklung, Klima und Gesundheit.
Und dementsprechend war er ausgebildet, erläutert Alma Giese. Er absolvierte religiöse Studien des Koran und des Hadît, also der Überlieferung des Propheten Mohammed, der Theologie und der Mystik sowie des Rechts.
"Auch die rationalen Wissenschaften wie Logik, Mathematik, Naturphilosophie und Metaphysik gehörten mit zur Ausbildung, außerdem die grundlegenden linguistischen, biografischen und historischen Kenntnisse und die Kunst, wissenschaftliche Werke zu schreiben."
Quellen zu erforschen, Berichte von Zeitzeugen zu prüfen, Fakten von Propaganda zu trennen, eine historische Periode aus ihrer Zeit heraus zu verstehen, dies beschäftigte den Universalgelehrten in seiner wissenschaftstheoretischen Analyse der Geschichtsschreibung.
"Zu den Gründen, welche die Unwahrheit in den Berichten verursachen, gehört auch das Vertrauen in die Überlieferer. Ein anderer Grund ist fehlendes Verständnis für die Absicht der Handelnden. Auch die bloße Vermutung der Richtigkeit einer historischen Aussage gehört hierher."
Soziologisch und ethisch verkörpern die Wüstenbewohner, die Nomaden und Berber, seine Ideale. Sie stehen für Menschen und Gruppen, die gesellschaftlichen Aufbruch wollen. Sie seien wild, kämpferisch, unabhängig, bescheiden, gesund und solidarisch. In diesen Banden - einer Familie, eines Volkes, einer anderweitig bestimmten Gruppe - sieht er, so Alma Giese, die Basis jeglicher politischer Führung.
"Den Kernpunkt bildet die Gruppensolidarität, die soziale Kraft, die in Ibn Khaldûns Theorie die Grundlage für alle Gesellschaftsstrukturen und Geschichtsabläufe ist."
Im Aufstieg und Niedergang der islamischen Zivilisation entdeckt er ein immer gleiches Muster. Sobald die Gruppensolidarität sich auflöst, endet die Blütezeit einer Stadt, einer Gesellschaft, einer Dynastie. Er beschrieb diese Entwicklung in einem Zyklus aus vier Phasen, die von den Erbauern, den Erben der Erbauer, den Nachahmern und den Zerstörern bestimmt werden.
Dem Lebensstil der Wüstenbewohner stellte er den der Stadtbewohner gegenüber. Ihm haftet Verfall und Niedergang an. Denn er scheitert am Erfolg. Aufstrebendes Handwerk führe erst zu Reichtum und Luxus, dann zu Bequemlichkeit und schließlich zu Kosten, die in den Ruin führten.
"Du musst wissen, dass die Steuereinkünfte zu Beginn der Dynastie aus geringen Abgaben bestehen und es trotzdem hohe Einnahmen gibt, es am Ende der Dynastie jedoch hohe Abgaben und geringe Einnahmen gibt."
Zwei Fehler warf Ibn Khaldûn den Herrschern und ihren Clans vor. Auf steigende Lebenshaltungskosten reagierten sie mit höheren Steuern, auf die guten Geschäfte der Kaufleute mit rigiden Eingriffen in das Marktgeschehen, um aus Gier an den verlockenden Gewinnen teilzuhaben.
"Und so tritt bei den Untertanen Not und Bedrängnis ein; das Absacken der Gewinne nimmt ihnen die Hoffnung, so dass sie sich überhaupt nicht mehr anstrengen, und das führt zum Niedergang des Steueraufkommens."
Abgaben drastisch zu erhöhen und den fairen Wettbewerb zu zerstören, hielt er nicht nur für ökonomisch, sondern auf für ethisch falsch.
"Die Überlistung bei Kauf und Verkauf ist jedoch gesetzlich erlaubt. Verboten ist es, die Besitztümer der Menschen zu verbrauchen, ohne dazu berechtigt zu sein."
Es sei nämlich im ureigensten Interesse des Herrschers, seine eigene Macht- und Finanzbasis nicht durch Fehler zu gefährden, sondern die Gruppensolidarität der Bürger zu fördern, indem er ihr Eigentum und ihre Rechte schützt.
"Was nun herrschaftlicherseits mit Gewalt, dem Brechen von Widerstand und aus unkontrollierten Zornesimpulsen heraus geschieht, das ist Ungerechtigkeit und Tyrannei und ist nach dem religiösen Gesetz ebenso tadelnswert, wie es auch die politische Weisheit gebietet"
Politische Weisheit und weltliche Regeln mochte Ibn Khaldûn für geboten halten, aber er misstraute ihnen, eher baute er auf das religiöse Gesetz, weil es durch den gemeinsamen Glauben der Muslime von einer unbestechlichen Instanz verbürgt ist.
"Sich auf Autorität etwas einzubilden, ist ein Mangel an Vernunft. Die Herrschaft gehört Gott allein. Er kann sie geben und nehmen."
Recht, Steuern, Preisbildung auf den Märkten untersuchte er ebenso wie die Frage, von wann an die Größe der Stadt, das Bevölkerungswachstum oder die Gesundheitsschäden - kurz die Folgen der Expansion - den gesellschaftlichen Niedergang beschleunigen.
"Krankheiten treten häufiger bei den sesshaften Menschen und Stadtbewohnern auf, weil diese ein Leben im Überfluss führen und weil sie viel essen. Weiterhin wird die Luft in den Metropolen durch Beimischung von fauligen Dämpfen aus vielen Abfällen verpestet. Außerdem gibt es bei den Einwohnern von Metropolen keine körperliche Ertüchtigung"
Und deshalb empfahl er, wie andere Gelehrte seiner Zeit auch, die Städte nicht so dicht zu bebauen, freies Feld zwischen den Quartieren zu lassen, damit die Wohngebiete besser durchlüftet werden.
Was Ibn Khaldûn vor bald 700 Jahren dachte und forderte, erschließt sich dem Leser heute sehr schnell. Nur wird er nicht als eine der historischen Quellen europäischer Ideen zitiert. Eher schon beziehen wir uns auf griechische und römische Autoren. Daran hat schon er sich gestört, schreibt Alma Giese, seine Übersetzerin, er, der viel reiste, zwischen den kulturellen und politischen Hochburgen des islamischen Westens pendelte.
""Ibn Khaldûn hat sich intensiv bemüht, so viel Material wie möglich über andere Kulturen zu verarbeiten. Dafür war Kairo mit seinen reichhaltigen Bibliotheken der richtige Ort"."
Seine Muqaddima derart ansprechend ins Deutsche zu übersetzen, dient nicht nur der Grundlagenforschung, wie es Naturwissenschaftler ausdrücken würden, sondern auch der Orientalistik. Ihre Vertreter sind in der schrillen christlich-islamischen Debatte oft sprachlos, ja zuweilen wunderlich, wenn sie sich denn äußern.
Mit einer solchen Übersetzung beweisen sie vor allem Interessierten außerhalb ihres Faches, dass sich der Griff in eine Neue Orientalische Bibliothek lohnen kann. Und sei es, um nur eines zu erkennen, welch langes literarisches Gedächtnis das Hocharabisch den Muslimen erlaubt - zu erkennen, bevor der Christ von ihnen das Kulturgut Aufklärung einfordert.
Ibn Khaldûn: Die Muqaddima. Betrachtungen zur Weltgeschichte
Übersetzt von Alma Giese
C.H.Beck Verlag, München, 2011
Alma Giese zitiert ihre Kollegin Annemarie Schimmel, um anzudeuten, dass die Muqaddima, diese breite sozial- und geisteswissenschaftliche Einführung in ein großes Geschichtsbuch, schwer zu lesen und zu verstehen sei, so kompliziert wäre der Satzbau, so selten die Wörter, so vielfältig die Themen.
Umso überraschter wird der Leser sein, wie verständlich Ibn Khaldûn schreibt, wie nah uns der Autor aus dem 14. Jahrhundert sprachlich kommt, wie prägnant der gelehrte Beobachter des arabisch-islamischen Lebens in Wüste und Städten Nordafrikas vieles formuliert, was uns auch heute noch beschäftigt. Das ist die Leistung der Übersetzerin, die einen biblisch anmutenden Erzählstil mit der nüchternen Wortwahl der Moderne verbindet.
Und so sehen auch die Orientalisten Ibn Khaldûn: Einen gründlichen Wissenschaftler, erfahren als Politiker und oberster Richter, der seiner Zeit voraus war und bereits damals Methoden der Forschung einforderte, die mittlerweile als Standard gelten. Wissenschaftstheorie und Geschichte sind seine Fachgebiete. Aber nicht nur: Er behandelte genauso Religion und Ethik, gute Regierungsführung, Soziologie und Ökonomie, Stadtentwicklung, Klima und Gesundheit.
Und dementsprechend war er ausgebildet, erläutert Alma Giese. Er absolvierte religiöse Studien des Koran und des Hadît, also der Überlieferung des Propheten Mohammed, der Theologie und der Mystik sowie des Rechts.
"Auch die rationalen Wissenschaften wie Logik, Mathematik, Naturphilosophie und Metaphysik gehörten mit zur Ausbildung, außerdem die grundlegenden linguistischen, biografischen und historischen Kenntnisse und die Kunst, wissenschaftliche Werke zu schreiben."
Quellen zu erforschen, Berichte von Zeitzeugen zu prüfen, Fakten von Propaganda zu trennen, eine historische Periode aus ihrer Zeit heraus zu verstehen, dies beschäftigte den Universalgelehrten in seiner wissenschaftstheoretischen Analyse der Geschichtsschreibung.
"Zu den Gründen, welche die Unwahrheit in den Berichten verursachen, gehört auch das Vertrauen in die Überlieferer. Ein anderer Grund ist fehlendes Verständnis für die Absicht der Handelnden. Auch die bloße Vermutung der Richtigkeit einer historischen Aussage gehört hierher."
Soziologisch und ethisch verkörpern die Wüstenbewohner, die Nomaden und Berber, seine Ideale. Sie stehen für Menschen und Gruppen, die gesellschaftlichen Aufbruch wollen. Sie seien wild, kämpferisch, unabhängig, bescheiden, gesund und solidarisch. In diesen Banden - einer Familie, eines Volkes, einer anderweitig bestimmten Gruppe - sieht er, so Alma Giese, die Basis jeglicher politischer Führung.
"Den Kernpunkt bildet die Gruppensolidarität, die soziale Kraft, die in Ibn Khaldûns Theorie die Grundlage für alle Gesellschaftsstrukturen und Geschichtsabläufe ist."
Im Aufstieg und Niedergang der islamischen Zivilisation entdeckt er ein immer gleiches Muster. Sobald die Gruppensolidarität sich auflöst, endet die Blütezeit einer Stadt, einer Gesellschaft, einer Dynastie. Er beschrieb diese Entwicklung in einem Zyklus aus vier Phasen, die von den Erbauern, den Erben der Erbauer, den Nachahmern und den Zerstörern bestimmt werden.
Dem Lebensstil der Wüstenbewohner stellte er den der Stadtbewohner gegenüber. Ihm haftet Verfall und Niedergang an. Denn er scheitert am Erfolg. Aufstrebendes Handwerk führe erst zu Reichtum und Luxus, dann zu Bequemlichkeit und schließlich zu Kosten, die in den Ruin führten.
"Du musst wissen, dass die Steuereinkünfte zu Beginn der Dynastie aus geringen Abgaben bestehen und es trotzdem hohe Einnahmen gibt, es am Ende der Dynastie jedoch hohe Abgaben und geringe Einnahmen gibt."
Zwei Fehler warf Ibn Khaldûn den Herrschern und ihren Clans vor. Auf steigende Lebenshaltungskosten reagierten sie mit höheren Steuern, auf die guten Geschäfte der Kaufleute mit rigiden Eingriffen in das Marktgeschehen, um aus Gier an den verlockenden Gewinnen teilzuhaben.
"Und so tritt bei den Untertanen Not und Bedrängnis ein; das Absacken der Gewinne nimmt ihnen die Hoffnung, so dass sie sich überhaupt nicht mehr anstrengen, und das führt zum Niedergang des Steueraufkommens."
Abgaben drastisch zu erhöhen und den fairen Wettbewerb zu zerstören, hielt er nicht nur für ökonomisch, sondern auf für ethisch falsch.
"Die Überlistung bei Kauf und Verkauf ist jedoch gesetzlich erlaubt. Verboten ist es, die Besitztümer der Menschen zu verbrauchen, ohne dazu berechtigt zu sein."
Es sei nämlich im ureigensten Interesse des Herrschers, seine eigene Macht- und Finanzbasis nicht durch Fehler zu gefährden, sondern die Gruppensolidarität der Bürger zu fördern, indem er ihr Eigentum und ihre Rechte schützt.
"Was nun herrschaftlicherseits mit Gewalt, dem Brechen von Widerstand und aus unkontrollierten Zornesimpulsen heraus geschieht, das ist Ungerechtigkeit und Tyrannei und ist nach dem religiösen Gesetz ebenso tadelnswert, wie es auch die politische Weisheit gebietet"
Politische Weisheit und weltliche Regeln mochte Ibn Khaldûn für geboten halten, aber er misstraute ihnen, eher baute er auf das religiöse Gesetz, weil es durch den gemeinsamen Glauben der Muslime von einer unbestechlichen Instanz verbürgt ist.
"Sich auf Autorität etwas einzubilden, ist ein Mangel an Vernunft. Die Herrschaft gehört Gott allein. Er kann sie geben und nehmen."
Recht, Steuern, Preisbildung auf den Märkten untersuchte er ebenso wie die Frage, von wann an die Größe der Stadt, das Bevölkerungswachstum oder die Gesundheitsschäden - kurz die Folgen der Expansion - den gesellschaftlichen Niedergang beschleunigen.
"Krankheiten treten häufiger bei den sesshaften Menschen und Stadtbewohnern auf, weil diese ein Leben im Überfluss führen und weil sie viel essen. Weiterhin wird die Luft in den Metropolen durch Beimischung von fauligen Dämpfen aus vielen Abfällen verpestet. Außerdem gibt es bei den Einwohnern von Metropolen keine körperliche Ertüchtigung"
Und deshalb empfahl er, wie andere Gelehrte seiner Zeit auch, die Städte nicht so dicht zu bebauen, freies Feld zwischen den Quartieren zu lassen, damit die Wohngebiete besser durchlüftet werden.
Was Ibn Khaldûn vor bald 700 Jahren dachte und forderte, erschließt sich dem Leser heute sehr schnell. Nur wird er nicht als eine der historischen Quellen europäischer Ideen zitiert. Eher schon beziehen wir uns auf griechische und römische Autoren. Daran hat schon er sich gestört, schreibt Alma Giese, seine Übersetzerin, er, der viel reiste, zwischen den kulturellen und politischen Hochburgen des islamischen Westens pendelte.
""Ibn Khaldûn hat sich intensiv bemüht, so viel Material wie möglich über andere Kulturen zu verarbeiten. Dafür war Kairo mit seinen reichhaltigen Bibliotheken der richtige Ort"."
Seine Muqaddima derart ansprechend ins Deutsche zu übersetzen, dient nicht nur der Grundlagenforschung, wie es Naturwissenschaftler ausdrücken würden, sondern auch der Orientalistik. Ihre Vertreter sind in der schrillen christlich-islamischen Debatte oft sprachlos, ja zuweilen wunderlich, wenn sie sich denn äußern.
Mit einer solchen Übersetzung beweisen sie vor allem Interessierten außerhalb ihres Faches, dass sich der Griff in eine Neue Orientalische Bibliothek lohnen kann. Und sei es, um nur eines zu erkennen, welch langes literarisches Gedächtnis das Hocharabisch den Muslimen erlaubt - zu erkennen, bevor der Christ von ihnen das Kulturgut Aufklärung einfordert.
Ibn Khaldûn: Die Muqaddima. Betrachtungen zur Weltgeschichte
Übersetzt von Alma Giese
C.H.Beck Verlag, München, 2011
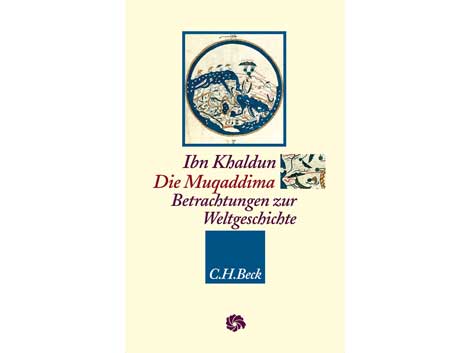
Cover Ibn Khaldûn: "Die Muqaddima"© C.H. Beck
