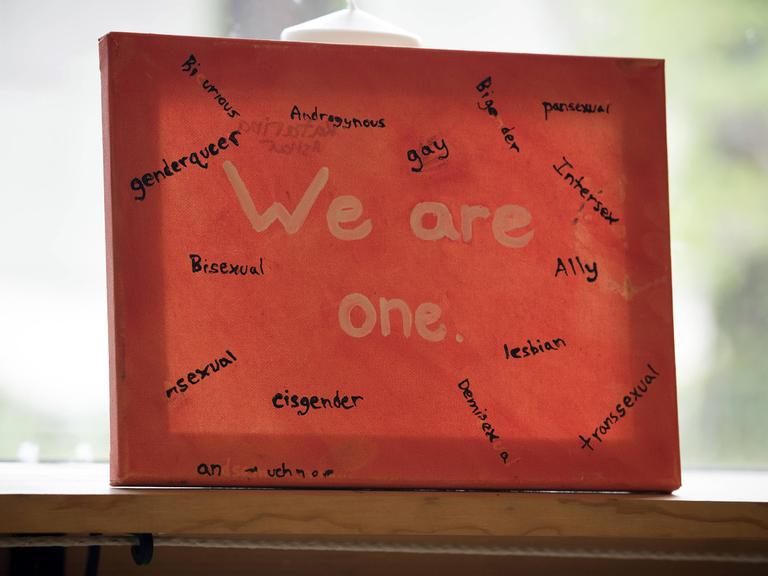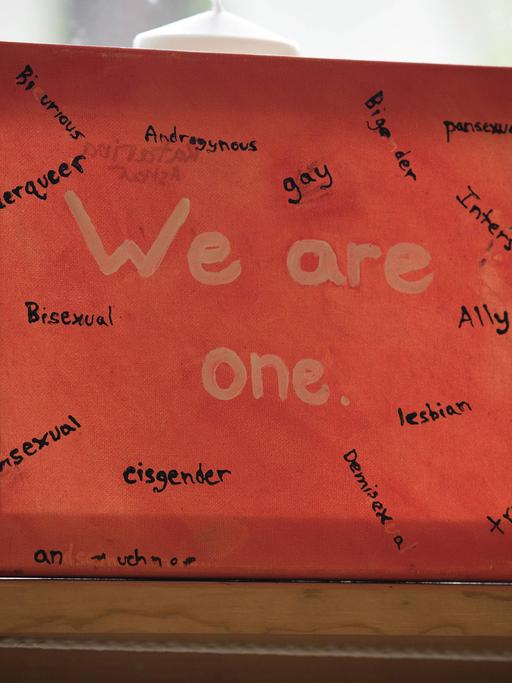Diagnose F64.0 - auf einmal gilt man als krank
04:45 Minuten
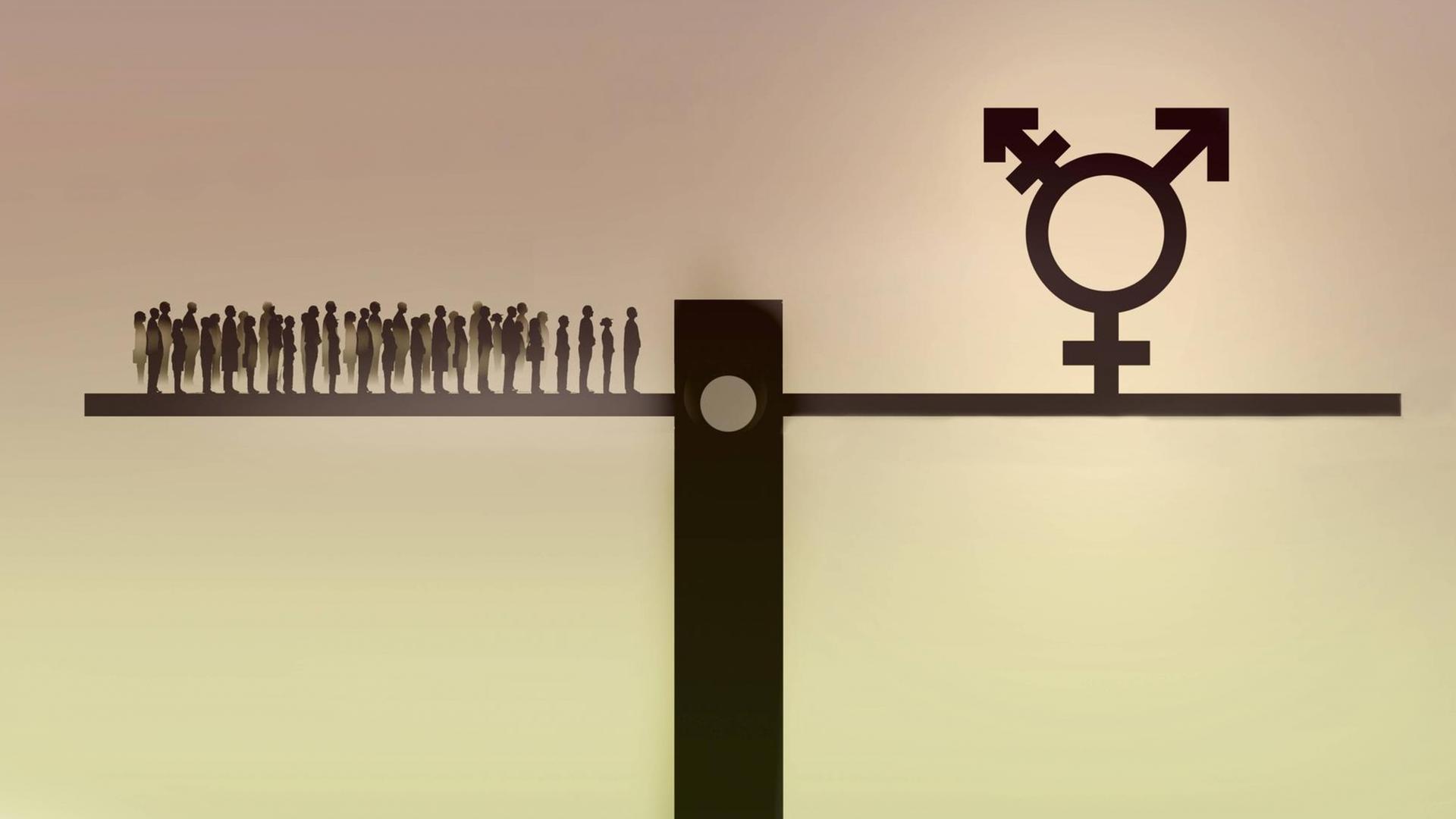
Wie belastend ist der Alltag für eine Trans-Person in Deutschland? Welche Benachteiligungen ergeben sich? Julia Monro, Vorstandsmitglied der Bundesvereinigung "trans*", erzählt.
Trotz "Ehe für Alle" und gesetzlicher Verankerung des dritten Geschlechts ist Deutschland in der aktuellen Ausgabe des "Gay Travel Index" vom dritten auf Platz 23 abgerutscht. Der Reiseführer der internationalen queeren Community gibt Auskunft über die Sicherheit für Homosexuelle, Bisexuelle, Trans- und Inter-Personen in den jeweiligen Ländern. Gegenüber Frankreich, wo es einen Aktionsplan gegen homophobe Gewalt gibt, und Portugal, wo der Schutz von LGBTI-Menschen sogar Verfassungsrang erlangte, hat Deutschland Nachholbedarf.
In der Einstufung abgerutscht ist Deutschland aufgrund einer gestiegenen Zahl von homo- und trans-feindlichen Übergriffen. Aber auch in gesetzlicher Hinsicht sind Trans- und Inter-Personen benachteiligt. Wie belastend das Leben aufgrund dieser Benachteiligungen ist, erzählt uns Julia Monro, Vorstandsmitglied der Bundesvereinigung "trans*".
Der Gesetzgeber erklärt Trans-Personen für psychisch krank
"Transsexualismus" zählt laut Weltgesundheitsorganisation mit der Diagnose F64.0 noch immer zu den psychischen Störungen. Das damit einhergehende Stigma lasse sich nur schwer abschütteln, so Monro: "Das ist so eine verletzende demütigende Haltung vom Gesetzgeber, dass er einem das nicht zutraut, dass wir mit der eigenen Wahrnehmung in der Lage seien, uns eh selbst definieren zu können." Sie empfindet das "als schwer diskriminierend."

Julia Monro erzählt aus ihrem Alltag. Vieles empfindet sie als diskriminierend.© privat
Das Gesetz sieht zwei Gutachten vor. "Die stellen dir dann sehr unangenehme sehr intime Fragen. Teilweise auch zum Sexualverhalten, wie oft man am Tag masturbiert und solche Sachen. Da habe ich gedacht, das ist so eine große Demütigung, die ich mir gar nicht antun möchte."
Probleme in der Gemeinde und bei der Berufswahl
Julia Monro ist gläubige Christin, wurde aber aus ihrer Kirchengemeinde ausgeschlossen und zwar "letztendlich mit der Begründung, dass die seelsorgerlichen Probleme zu weit fortgeschritten seien." Ernst genommen fühlte sie sich nicht.
Auch bei der Jobwahl erlebte sie Benachteiligungen, etwa bei einer Bewerbung beim Bundeskriminalamt. Das BKA gebe sich zwar nach Außen als weltoffen und tolerant. Dennoch sei sie ohne Anhörung als "dienstuntauglich" eingestuft worden: "Ich habe nur in einem Satz reingeschrieben, dass ich heute in der für mich als weniger belastend empfundenen Rolle als Frau lebe. Das war eine Bewerbung für ein duales Studium mit einem anschließendem Beamtenverhältnis. Kein Streifenjob, bei dem man jetzt täglich viel Sport machen muss oder sowas. Es ging einfach um eine IT-Stelle. Männliche Bewerber müssen mindestens einen funktionierenden Hoden haben, ja. Das steht da tatsächlich drin", erklärt sie und lacht.
Zwangsouting durch behördliche Willkür
Auch in "behördliche Willkür", bei der "alles nur nach irgendwelchen Gesetzen und Vorschriften abläuft", rutsche man schnell, erzählt Julia Monro weiter.
"Die Menschlichkeit geht da irgendwie total verloren. So ist man in vielen Lebenssituationen einfach dazu gezwungen in der Rolle noch zu leben, so lang man noch diese öffentliche, diese amtliche Namensänderung noch nicht durchgeführt hat. Und das führt zu massiven Ausgrenzungen, Zwangsoutings. Man stellt sich einfach mal vor, du sitzt in der Arztpraxis, hast ein komplett weibliches Aussehen und dann wird von der Schwester ein Herr aufgerufen und alle gucken auf einmal blöd, wenn du aufstehst. Das fühlt sich so diskriminierend an. Das fühlt sich so negativ an, wie die Leute dann da drauf reagieren. Man fühlt sich einfach geoutet, zwangsgeoutet."
(Onlineversion, thg)