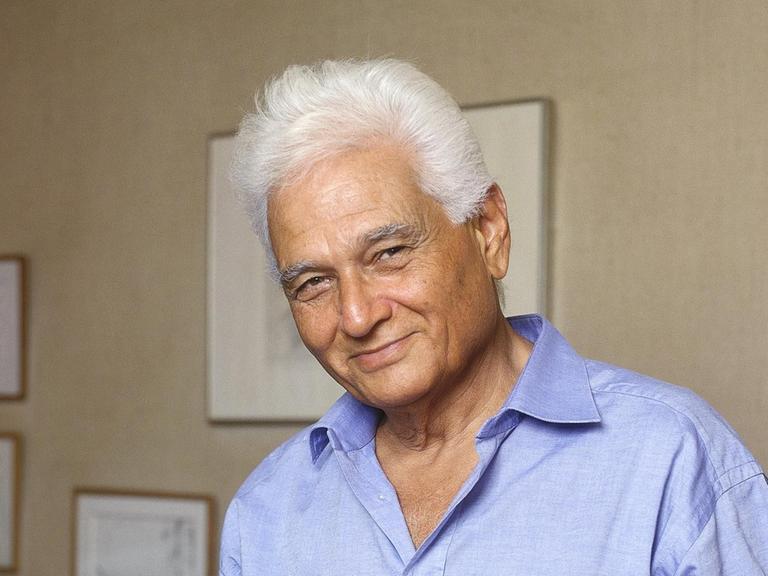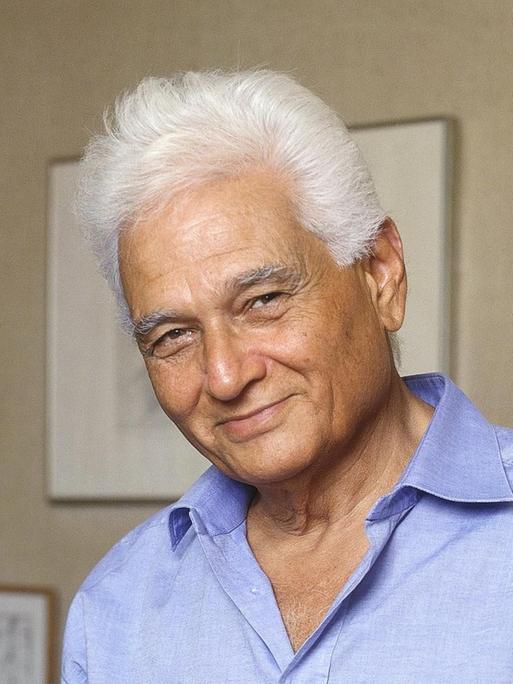Radikaler Umbau der Stiftung Preußischer Kulturbesitz
06:15 Minuten

Durch die vom Wissenschaftsrat vorgeschlagene Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz könnten die Berliner Museen endlich die Strahlkraft entfalten, die ihnen kraft ihrer Sammlungen eigentlich gebührt, heißt es in der „Zeit“.
"Die Welt ist das Homeoffice Gottes." So haut der Schweizer Pfarrer Christoph Siegrist eine Verteidigungsrede mit Schmackes heraus: In der NEUEN ZÜRCHER ZEITUNG nimmt er die Kirchen vor dem Vorwurf in Schutz, sie hätten während der Coronakrise schlicht "nicht stattgefunden".
"Keinen Exorzismus!" Das fordert Ijoma Mangold in der ZEIT. Wo sind wir nur hineingeraten! Wobei – wenn Gott im Homeoffice Welt sitzt, sollte er von da aus die Teufelsaustreibung ja eigentlich ganz bequem hinkriegen können, und sowieso gehören das Niederste und das Höchste auch irgendwie zusammen.
Ein Riesentanker mit 2000 Mitarbeitern
Jedoch – die markige Überschrift in der ZEIT bezieht sich auf ein Konstrukt, das eben keine Marke ist, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz nämlich. Ein Riesentanker, den so, wie die Stiftung derzeit ist, wohl auch der beste Kapitän nicht lenken kann. Der Wissenschaftsrat schlägt vor, das Ungetüm mit 2000 Mitarbeitern und behördenschwerblütiger Struktur zu reformieren und "auf vier selbständige Einheiten herunter zu brechen".
Auch, damit die wunderbaren Berliner Museen dann endlich die Strahlkraft entfalten, die ihnen kraft ihrer Sammlungen eigentlich gebührt – nur dass der manövrierunfähige Riesentanker eben keine attraktiven, publikumswirksamen Ausstellungen ausstößt. Neue Struktur und eine ordentliche Portion Geld woher auch immer – dann müsste es viel besser laufen, so hofft man.
"Es ist richtig, die aufgeblasene Stiftung aufzuteilen", kommentiert Ijoma Mangold. Zugleich macht er sich Sorgen, dass im Eifer dann auch alles Preußische gleich mit entsorgt werden könnte. Deshalb eben: "keinen Exorzismus!", bitte.
"Das Preußen nicht des Generalstabs, sondern das der Reformer Stein und Hardenberg und der Weltgelehrten Alexander und Wilhelm von Humboldt wurde zur Bezugsgröße der neu geschaffenen Republik, für die die Museumsinsel genauso steht wie der Reichstag" – daran erinnert Mangold vorsorglich in der ZEIT.
Hermann Parzinger, derzeit Präsident des zu reformierenden Stiftungsungetüms, erhofft sich ganz dringend eine intensive öffentliche Debatte. "Dieser Wunsch sollte ihm unbedingt erfüllt werden", meint Harry Nutt sibyllinisch in der FRANKFURTER RUNDSCHAU. In seinen verbleibenden fünf Dienstjahren wird Parzinger nämlich "an der Dekonstruktion des eigenen Amtes mitarbeiten", lesen wir in der ZEIT.
Derridas Politik der Freundschaft
Für Dekonstruktion ist/war der Philosoph Jacques Derrida zuständig. Er wäre dieser Tage 90 Jahre alt geworden, und die zahlreichen Würdigungen des Denkers in dieser Woche zeigen wohl auch, dass er fehlt – selbst seinen Kritikern wohl fehlt, die ihm "allen Sinn zerstörende Verunklarung" vorwarfen, "Derridadaismus". Das lesen wir in der SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG.
Die wartet prompt mit einem der schönsten, menschlichsten und verständlichsten Zitate von Jacques Derrida auf: "Der eigentliche politische Akt oder die eigentliche politische Handlung besteht darin, so viel Freundschaft wie möglich zu stiften."
Dem deutschen Professor Hans Ulrich Gumbrecht, der Derridas Denken eher skeptisch gegenübersteht und der es in der NEUEN ZÜRCHER ZEITUNG als durchaus etwas angejahrt beschreibt, ging der stets überaus freundlich auftretende Derrida als Mensch trotzdem nah. Er beeindruckte "als ein eher bescheidener Kollege, dessen Umgangsformen an einen Diplomaten oder auch den Besitzer eines Weinguts erinnerten".
Wieviel Abstand ist im Kino nötig?
"Ausverkauft mit leeren Plätzen – rechnet sich das?" Der TAGESSPIEGEL fragt nach dem Neustart der Kinos nach der Coronapause. Zwar sind Kinos im Sommer stets weniger ausgelastet, aber jetzt liegt man noch ein gutes Drittel unter dem üblichen Schnitt. Dabei läuft es nicht so schlecht wie befürchtet, "tapfere Zahlen" werden durchaus gemeldet, aber das reicht eben nicht.
"Vor allem hoffen die Kinobetreiber auf weitere Lockerungen bei den Abstandsvorgaben. Wegen der 1,50 Meter Distanz müssen derzeit zwei Plätze zwischen den Besuchern frei bleiben. Und höchstens jede zweite Reihe kann überhaupt genutzt werden. In Österreich, Frankreich und der Schweiz genügen längst ein Meter Abstand", betont der TAGESSPIEGEL. Ebensolche Regeln bei uns würden nicht nur den Kinos helfen, sondern auch den Theatern, Konzerthäusern, den Orchestern und Ensembles überhaupt, fügen wir noch an.
"Der reisende Teutone" verschickt gerne Postkarten
Die Ansichtskarte hat Geburtstag, den 150.! Die SÜDDEUTSCHE huldigt und schreibt der Postkarte eine rührende Postkarte: "Wer hätte das gedacht von so einem Winzling von Druckerzeugnis, noch dazu einem so schamlos unverhüllten, offen lesbar für alle. Diese ‚unanständige Form der Mitteilung‘ wurde anfangs noch inkriminiert, dabei bist du, wie wir heute wissen, die Mutter aller Whatsapp-Grüße, Tweets und Instagram-Storys. Dass die elektronischen Medien mit ihrer superschnellen Bild-Text-Übermittlung dir den Garaus zu machen drohen, ist bitter."
Unverdrossen berichtet der Kommunikationswissenschaftler Walter Hömberg in der FAZ, dass nach wie vor 155 Millionen Postkarten pro Jahr in deutschen Briefkästen landen. Fast so, als sei ein britischer Seitenhieb aus dem Standard von 1899 noch heute aktuell:
"Der reisende Teutone scheint es als seine feierliche Pflicht zu betrachten, von jeder Station seiner Reise eine Postkarte zu schicken, als befinde er sich auf einer Schnitzeljagd. Seine erste Sorge, nachdem er ein einigermaßen bemerkenswertes Reiseziel erreicht hat, ist es, ein Gasthaus zu finden, wo er abwechselnd sein Bier trinkt und Postkarten adressiert." Und stets schreibt er dabei über den Rand, denn nie reicht der Platz!