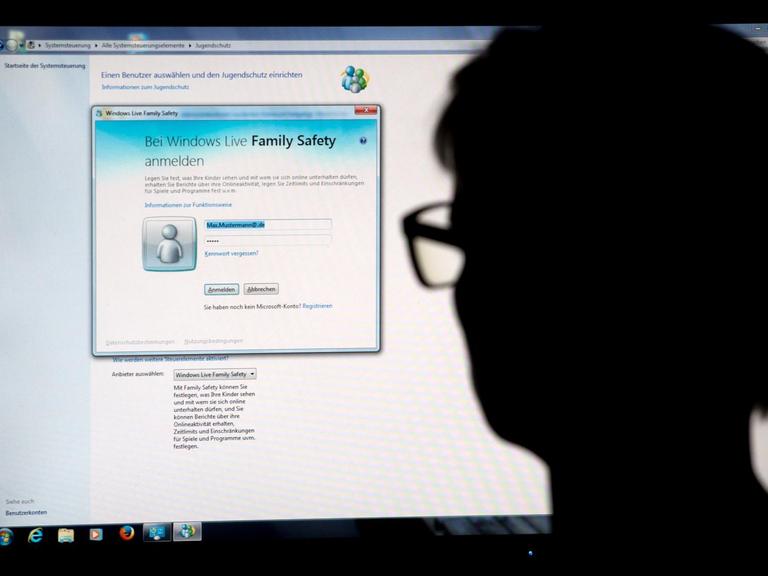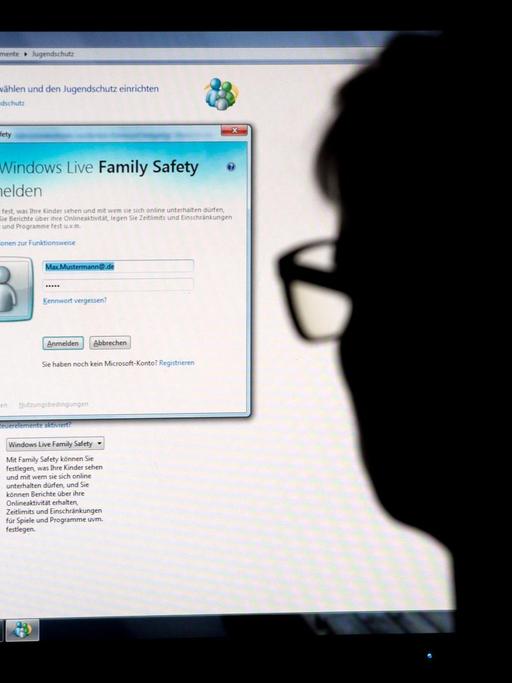Verunsicherung im Zeitalter des Internets

Die "Welt" beschäftigt sich mit der informationellen Überforderung des Menschen, der den Herausforderungen des Internets nicht gewachsen scheint. Die "SZ" geht der Frage nach, wie Journalismus im Internet seriös bleiben kann.
"Herr Küppersbusch, was war schlecht in der vergangenen Woche?", fragt die TAZ. Und Friedrich Küppersbusch antwortet: "Die Party ist vorbei, wir werden bald wieder regiert."
Gerüchte im Netz
Die Party ist für Politiker in gewisser Weise allerdings nicht erst seit der Mitgliederentscheidung der SPD vorbei. Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen hat ein Buch über "Die große Gereiztheit" geschrieben und analysiert nun im Gespräch mit Jörn Lauterbach von der WELT, was Gereiztheit und Empörung, die sich besonders mittels Internet Bahn brechen, für negative Folgen haben.
Politiker seien nun verzagt und ängstlich, trauten sich nicht mal mehr bei internen Gesprächen, außergewöhnliche Gedanken zu äußern, aus Angst, das könne jemand an die Presse weiterleiten. "Das Ideal der informationellen Selbstbestimmung ist zur Erfahrung der informationellen Verunsicherung geworden", folgert Pörksen.
"Klima der politischen Visionslosigkeit"
Schuld an diesem "Klima der politischen Visionslosigkeit" hätten alle: Politiker, Medien und das Publikum. Hinzu komme, dass das Internet gezielte Desinformation erleichtere: "Zu viel Information, ungefiltert und ungeordnet, macht Desinformation effektiver", erklärt der Medienwissenschaftler. "Denn in einer solchen Situation der Überforderung greifen viele Menschen auf ihre Vorurteile zurück und halten sich an das, was sie immer schon gedacht und geglaubt haben. Wir Menschen sind bestätigungssüchtige Wesen und finden Dissonanz unangenehm." Es sei zwar "eigentlich eine großartige Nachricht", dass jeder im Internet eine eigene Stimme habe. Allerdings gebrauche die eben auch nicht jeder verantwortungsvoll. So ständen plötzlich "Banales, Bestialisches, Gerüchte und präzise Berichte […] unterschiedslos nebeneinander". Bernhard Pörksens Schlussfolgerung: "Ethisch-moralisch ist die Gesellschaft der neuen Freiheit noch nicht gewachsen."
Neue Technologie hilft seriösem Journalismus
"Civil", ein US-amerikanisches Projekt, das Benedikt Frank in der SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG vorstellt, könnte aber schon einen kleinen Beitrag dazu leisten. Mit Hilfe der sogenannten Blockchain-Technologie, wie sie beim Erstellen von Bitcoins verwendet wird, sollen auch digitale Texte so unveränderlich gemacht werden, als wären sie auf Papier gedruckt:
"Die Blockchain kann man als eine Art digitale Kartei beschreiben, die durch kryptographische Verfahren und tausendfache öffentliche Kopien gegen Manipulation gesichert ist",
erläutert Frank.
"Wenn selbst ein Kommafehler nicht mehr nachträglich im Geheimen korrigiert werden kann, gewinnt seriöser, sorgfältiger Journalismus, glauben die Civil-Macher."
So könne sich der Journalismus gegen Populismus wehren und "demokratischer" werden. In den USA steht schon die Finanzierung für erste journalistische Redaktionen nach diesem Prinzip. Auch der Burda-Verlag und "Die Zeit" interessieren sich für die Technologie.
Technik und Computer sind überhaupt das bestimmende Thema in den Feuilletons vom Montag. Die FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG berichtet über selbstfahrende Sammeltaxis in den USA. Die NEUE ZÜRCHER ZEITUNG erklärt, wie Roboter lernen.
Aber mit humorlosen Robotern sollte man nicht enden in einer für Menschen gemachten Kulturpresseschau. Drum zum Schluss noch etwas Keckes von Küppersbusch. "Das Peng-Kollektiv ruft seit Mittwochabend zu zivilem Ungehorsam auf. Deutschland soll zurückklauen, was Lidl, Aldi, Edeka und Rewe den Gewerkschaften im globalen Süden wegnehmen. Eine gute Methode, um Druck auszuüben?", fragt die TAZ.
Und Friedrich Küppersbusch antwortet: "Cool! Der ganze Einzelhandel ist eine Tafel! Da nimmt man den Supermärkten viel Arbeit ab, wenn der Kaufpreis künftig ein unverbindlicher Spendenvorschlag wird."