Was in den Bundesländern wichtig wird

Der Blick auf den chinesischen Kalender zeigt: Das Jahr 2015 steht im Zeichen des sanften Holzschafes. Schafsjahre seien Jahre ohne große Höhen und Tiefen. Was gibt es dann Spannendes in den Bundesländern? Jede Menge!
Rheinland-Pfalz – Ungemütliche Aussichten und die Frage: Was geschieht mit den Steuergeldern?
Von Anke Petermann
Parkplätze im Nieselregen, soweit das Auge reicht. Kein Auto weit und breit. Das kasernenähnliche, weiß getünchte Terminalgebäude verwaist, die Großflugzeug-taugliche Betonpiste glänzt regennass – wie poliert.
"Do hinne, de Tower: ist die halbe Landebahn, und was do Platz is drum rum, also meiner Meinung nach könnt des ä internationaler Flughafe gebbe – mit dem Platz, wo do is."
Davon träumt jedenfalls Flughafenfreund Gerhard Mayer. Doch Platz ist nicht alles im Luftfahrt-Geschäft, die Realität kehrt mit einem Rütteln an der Tür zum verrammelten Terminal zurück.
"Do is zu jetzt, offiziell geschlosse, in Winterpause."
In die Pause ging Zweibrücken Ende 2014 als insolventer "Regionalflughafen“. Aus der Pause kommt er demnächst wohl zurück als "Verkehrssonderlandeplatz“ für Privatjets und Maschinen, die zur Reparatur einfliegen. 47 Millionen Euro an Subventionen pumpte die Mainzer Landesregierung in den Airport Zweibrücken. Der nutzte die Staatsknete, um den dreißig Kilometer westlich gelegenen, vom Saarland subventionierten Konkurrenten Saarbrücken gebührenmäßig zu unterbieten und den ein oder anderen Billigflieger abzuwerben. Doch Dumping als Geschäftsmodell akzeptiert die EU-Kommission nicht, Zweibrücken sollte die Beihilfen zurückzahlen. Das konnte der Airport aber nicht. Also: Bruchlandung. Pleite. Neuer Investor gesucht. Investor gefunden. Ein Retter also, von dem die rot-grüne Landesregierung mit Malu Dreyer an der Spitze nun das Geld eintreibt? Keinesfalls. Im Gegenteil – sie hat hart verhandelt mit dem Wettbewerbskommissar,
"Ob man da ein Stückweit eine Befreiung, bezogen auf die Rückforderungsansprüche, erreichen kann. Die Unterstützung des Landes ist auch sichergestellt."
Verzichtet der Investor, das Trierer Immobilienunternehmen Triwo, auf regulären Flugbetrieb, bleibt es wohl verschont, hat die Kommission angedeutet. Triwo kaufte Zweibrücken zu einem unbekannten Preis. 17 Millionen Euro will Vorstandschef Peter Adrian investieren, um aus dem Millionengrab einen Gewerbepark zu machen. Aber wann Triwo wieviel Geld locker macht und ob sich überhaupt Interessenten für neues Gewerbe auf dem Flughafengelände finden lassen – alles offen. Dass die fast fünfzig Millionen unerlaubter Beihilfen futsch sind, zeichnet sich dagegen ab: begraben unter der regennassen Großflugzeugtauglichen Landebahn, die – wenn es gut läuft – demnächst Autoteststrecke wird.
Was Zweibrücken im Süden verbindet mit einem weiteren Pleite-Pech-und Pannen–Projekt im Norden von Rheinland-Pfalz, dem Nürburgring. Im vergangenen Oktober: hörbares Aufatmen bei Rot-Grün. Nachdem nacheinander das Freizeitpark-Projekt samt Mega-Achterbahn und das Zukunftskonzept der damaligen SPD-Alleinregierung gescheitert waren, genehmigte die EU-Kommission den Verkauf an den regionalen Auto-Zulieferer Capricorn. Dumm nur: auch der brachte am Ende das Geld nicht auf, ein russischer Finanzinvestor übernahm die Anteile. War Capricorn nur ein Strohmann für den russischen Oligarchen, der bereitwillig einsprang? Das fragen sich viele. Die Initiative "Ja zum Nürburgring“ demonstrierte in Mainz und fordert von der EU-Kommission, den Verkauf erneut zu prüfen.
"Es sind viele Sachen falsch gelaufen."
"Malu Dreyer – Abschiedsfeier, Malu Dreyer – Abschiedsfeier!"
"Malu Dreyer – Abschiedsfeier, Malu Dreyer – Abschiedsfeier!"
Was die Privatisierungsanläufe am Ring insgesamt kosteten, die bis in die sozialliberale Ära Beck zurückreichen? Regierungschefin Malu Dreyer denkt nicht an "Abschiedsfeier“, übt sich aber in Demut.
"Dass der Schaden beim Steuerzahler bei einer halben Milliarde, irgendwo zwischen 400 und 500 Euro sein wird, das beschönigt keiner, das ist das, was wir in der Vergangenheit falsch gemacht haben, das muss jetzt auch getragen werden."
Neben Nürburgring und Zweibrücken ist da noch der verlustbringende Flughafen Hahn. 130 Millionen kostet es, den zu entschulden, um ihn für die baldige Privatisierung fitzumachen. Beim Hunsrück-Airport besteht wenigstens noch ein Fünkchen Hoffnung, dass sich das lohnt. Und dann ist noch offen, ob die knappe halbe Milliarde Bundesmittel für den Hochmoselübergang gut investiert ist. Experten halten den Hang auf der Eifelseite für rutschgefährdet, möglicherweise ungeeignet für riesige Brückenpfeiler. Rot-Grün will trotz der Zweifel weiterbauen. Das Jahr ist jung, doch so viel ist klar: Der rheinland-pfälzische Steuerzahler braucht 2015 ein starkes Kreuz.
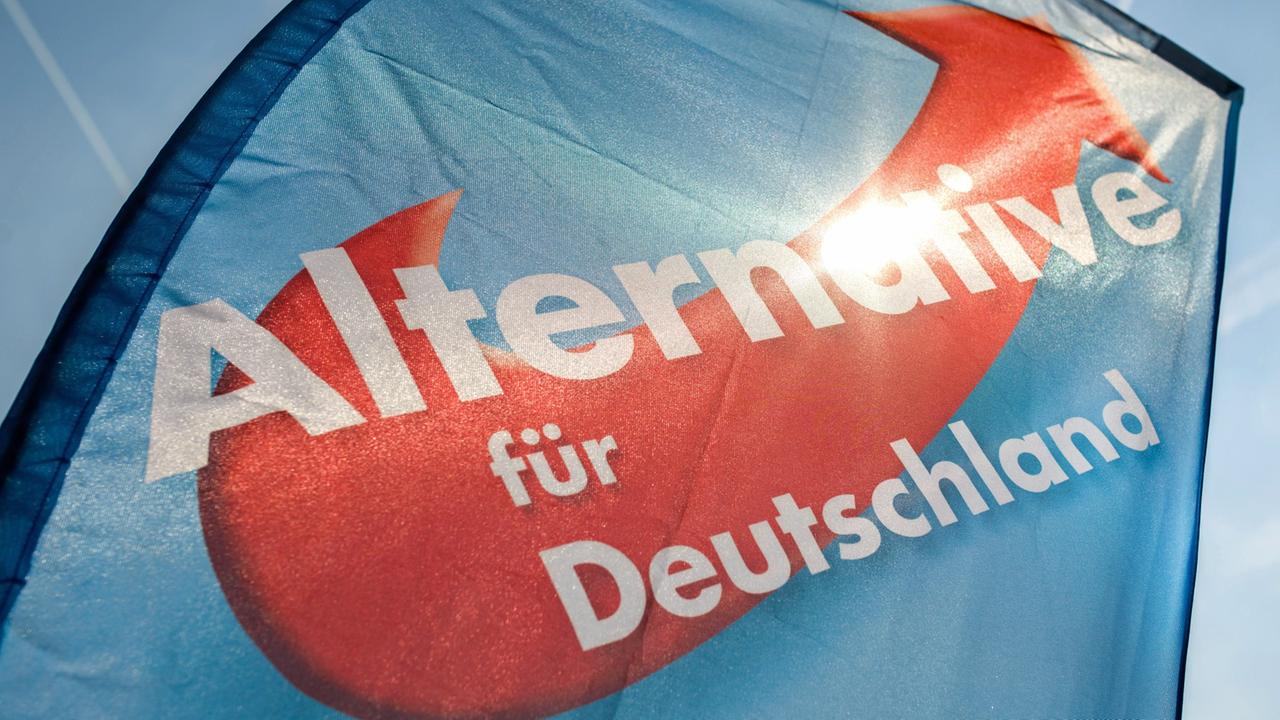
Ein Aufsteller der Partei Alternative für Deutschland (AfD). © dpa / picture-alliance / Candy Welz
Thüringen – Ein unsympathisch gallisches Dorf und die Frage: Wie umgehen mit der AfD?
Von Henry Bernhard
Von Henry Bernhard
Thüringen ist ein gallisches Dorf. Das kleine Bundesland mitten in Deutschland tanzt aus der Reihe. Es hält sich nicht an die Regel, dass ein Linker, ein "Kommunist“, wie die Konkurrenz nicht müde wird zu betonen, keine Regierung in Deutschland anführen darf.
(Bodo Ramelow:) "Wahrscheinlich habe ich die Mauer gebaut. Möglicherweise esse ich mit Hammer und Sichel Abendessen."
Aber der Linke Bodo Ramelow ist gewählt, damit hat sich inzwischen selbst die CDU - fast - abgefunden. Der Fraktionschef, Mike Mohring: "Rot-Rot-Grün in Thüringen als der zweite Sündenfall – in der Politik. Ich hoffe, daß der Zeitraum vom zweiten Sündenfall bis zur Erlösung nicht wie bei dem ersten 4.000 Jahre, sondern maximal 5 Jahre dauert."
Dafür gründet die CDU nun ein eigenes gallisches Dorf – in Opposition nicht nur zur Linken, zur SPD und zu den Grünen, sondern auch zur eigenen Parteiführung. Eine Art Radikalopposition gegen alle. Außer gegen die AfD, die Alternative für Deutschland. Das Schmuddelkind auf der rechten Seite, das schon am Wahlabend im September drohte: "Diese Partei wird zu einer blauen Bewegung werden, zu einer blauen Bewegung, die unser gesamtes Vaterland in eine bessere Zukunft führen wird."
Und auch – oder gerade – weil Björn Höcke das Blaue vom Himmel verspricht: Mit den Schmuddelkindern spielt man nicht. Das sagen alle: Linke, SPD und Grüne sowieso, aber auch Mutti Merkel. So hat es auch der CDU-Bundesvorstand beschlossen. Aber in Thüringen scheint es darum zu gehen das Böse zu vertreiben, zur Not auch mit Hilfe der Untoten. Auf dem CDU-Parteitag stieg erstmals seit seinem Sturz vor fünf Jahren Alt-Ministerpräsident Dieter Althaus aus der Polit-Gruft: "Dafür zu sorgen, dass wir in Zukunft wieder Leute wie Ramelow aus der Regierung loswerden ist die wichtigste Aufgabe der Union, liebe Freunde! Und deshalb wäre es richtig gewesen, die Thüringer Union zu unterstützen auf diesem Weg, statt ihr Steine in den Weg zu legen."
Althaus kritisierte die Kritik der Parteiführung an Mike Mohrings geheimen Gesprächen mit der AfD vor der Ministerpräsidentenwahl. Parteifreundin Martina Schweinsburg ergänzte: "Mit wem hätte er denn reden sollen im Thüringer Landtag? Und hier sollten wir auch im Rahmen unserer bürgerlichen Werte Partner für die Zukunft suchen."
Natürlich spricht es keiner aus bei der CDU. Am klarsten ist immer noch Mike Mohring, der strahlende und vom langen Reden heisere neue Parteichef: "Ich habe in meiner Rede nicht dazu gesagt, weil ich nichts dazu sagen möchte."
Das heißt?
(Mike Mohring:) "Nichts. Sie hören doch, wie die Partei tickt und wie der Beifall gewesen ist! Aber ich selber sage zu dem Thema nichts mehr; ich habe alles gesagt."
AfD-Chef Björn Höcke, der Mike Mohring mit den Worten, er sei ein "junger Stürmer“, umgarnte, zeigte der Union derweil im Landtag schon mal, worauf sie sich in der "bürgerlichen Mitte“, wie die AfD sie versteht, einstellen muss.
(Björn Höckej:) "Jetzt halten sie doch mal ihre Klappe! … So, jetzt hören sie mal auf, dazwischen zu sabbeln! Ich bin gleich fertig! Bleiben Sie entspannt! Gaaanz ruhig! Ja, gehen sie zu einem guten Therapeuten, alles klar! Entspannen sie sich! Machen sie ein bißchen Sport! Ich weiß, Herr Ramelow, daß sie und ihre Kollegen vom roten Block das ideologische Ziel haben, Deutschland abzuschaffen, das möchte ich hier mal in aller Deutlichkeit sagen!"
Und dann, sanfter im Ton, an die CDU gewandt: "Ich glaube, gerade Sie, Herr Mohring, haben vielleicht die Chance, die Union auf einen Kurs zu bringen, der dieser Partei, dieser großen alten Partei, die mal eine gute Vergangenheit hatte, die aber mittlerweile etwas unkenntlich geworden ist, vielleicht doch wieder zu neuen Ufern zu führen und ihr eine neue Zukunft zu geben. Das würde ich mir wünschen, Herr Mohring."
Was sagte Mike Mohring doch gleich auf dem CDU-Parteitag zum Thema AfD? "Jetzt fangen sie schon wieder mit dem Thema an! Ich habe in meiner Rede nicht dazu gesagt, weil ich nichts dazu sagen möchte."
Ah ja! Na dann sind wir gespannt, wie sie in Thüringen zusammenfinden, die beleidigte CDU und die pöbelnde AfD, die immer vom "gesunden Menschenverstand“ spricht, was sich bei ihr aber anhört wie "gesundes Volksempfinden“. Auch gallische Dörfer können unsympathisch sein.

Stein des Anstoßes vor Gericht: die Elbe - und ihre geplante Vertiefung© picture-alliance / dpa / Christian Charisius
Hamburg – Der tiefe Streit und die Frage: Dröhnen bald die Eimerkettenbagger?
Von Axel Schröder
Von Axel Schröder
Ob das martialische Geräusch von Eimerkettenbaggern zum Klang des Jahres wird, entscheidet sich im Frühjahr. Auf 108 Kilometern soll die Elbe auf 14,5 Meter vertieft, zusätzlich streckenweise verbreitert werden, damit auch die größten Containerschiffe einander reibungslos passieren können. Die Entscheidung, ob die Baggerarbeiten mit dem Naturschutzgesetzen vereinbar sind, trifft das Leipziger Bundesverwaltungsgericht. Im Kern geht es – wie auch bei der Vertiefung der Weser – um die Einhaltung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Das Weser-Verfahren und die Auslegung der Wasserrahmenrichtlinie verhandelt gerade der Europäische Gerichtshof in Straßburg.
Deshalb warten die Leipziger Richter in Sachen Elbvertiefung auf die Entscheidung ihrer Straßburger Kollegen. Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz blieb angesichts der neuerlichen Verzögerung gelassen: "Wir hätten uns eine andere Entscheidung erhofft. Aber immerhin: die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts und die Mitteilung die es gemacht hat beinhaltet auch die Auskunft, dass es im Übrigen so ist, dass es nicht zu einer Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses und der Planfeststellungsbeschlüsse gekommen wäre, wenn nicht diese Frage vorrangig noch zu klären wäre."
Die demonstrative Gelassenheit des Bürgermeisters verdeckt aber: nach wie vor können die Gerichte die, so der offizielle Terminus: Fahrrinnenanpassung, weiter verzögern. Dann nämlich, wenn sie feststellen, dass sich Wasserqualität der Elbe durch die Baggermaßnahmen maßgeblich verschlechtert und nicht verbessert. Dieses Verschlechterungsverbot schreibt die Europäische Wasserrahmenrichtlinie vor.
Die Fronten beim Thema Elbvertiefung sind so klar wie bei kaum einer anderen Debatte in der Hansestadt: auf er einen Seite stehen die Umweltverbände BUND und Nabu, die den Planfeststellungsbeschluss gerichtlich überprüfen lassen. Auf der anderen Seite die Hafenwirtschaft, unterstützt vom Hamburger Senat und der Handelskammer. Die einen fürchten eine unumkehrbare Naturzerstörung, die anderen einen langsamen Niedergang des Hamburger Hafens. Gunther Bonz, der Präsident des Unternehmensverbandes Hafen Hamburg findet es skandalös, dass BUND und Nabu über eine Verbandsklage gegen die Elbvertiefung Arbeitsplätze in Gefahr brächten:
"Das Problem in Deutschland ist, dass wir eine Verbandsklage haben in einer Ausgestaltung und mit ideologisch verbohrten Verbänden, wie es sie in keinem anderen EU-Staat gibt. Das sind auf Dauer untragbare Zustände! Oder ist etwa der Arbeitsnehmer weniger schützenswert als ein Grashalm am Rande eines Deichs neben der Elbe?"
Manfred Braasch, Landesgeschäftsführer des BUND kennt diese Töne aus der Hafenwirtschaft, die mit jeder weiteren Verzögerung der Baggerarbeiten, noch schriller werden: "Wir leben in einem Rechtsstaat. Der Deutsche Bundestag hat allen anerkannten Naturschutzverbänden ein Klagerecht eingeräumt. Und zwar aus dem Grund, weil die Flora und Fauna per se keine Klage einreichen kann. Es muss also jemanden geben, er als Anwalt der Natur auftritt. Das ist unser Job als BUND. Und den nehmen wir dann natürlich auch wahr."
Klar scheint schon heute: der Lebensraum für den geschützten Schierlingswasserfenchel wird durch die Elbvertiefung schrumpfen. Es werden mehr Fische durch den jeden Sommer auftretenden Sauerstoffmangel sterben, als heute schon.
Wenn sich der Wasserzustand der Elbe aber nicht verbessert, könnten die Vertiefungspläne die Europäische Wasserrahmenrichtlinie verletzen. Die Fahrrinnenanpassung müsste abgesagt werden. Die Hamburger Hafenwirtschaft darf aber trotzdem weiter hoffen; wie fast jedes Regelungswerk lässt auch die Wasserrahmenrichtlinie Ausnahmen zu: die Wasserqualität darf sich – in Maßen – verschlechtern, wenn "überwiegend andere Interessen“ dahinterstehen. Zum Beispiel sichere Arbeitsplätze in Deutschlands größtem Hafen. Ob das Gedröhn der Eimerkettenbagger demnächst über die Elbe hallt, bleibt ungewiss.

Die Städte in Ostdeutschland sind alle saniert. Unser Bild zeigt die Leipziger Innenstadt. © dpa / picture-alliance / Jan Woitas
Sachsen – Gemischte Aussichten
Von Nadine Lindner
Von Nadine Lindner
"Wir sind wieder eine wachsende blühende Stadt und mir ist überhaupt nicht bange für die nächsten 1000 Jahre. Kommen sie, schauen sie es sich an!"
Es ist eines dieser schönen Stadtmarketing Videos mit tollen Bildern und gefühliger Musik. Der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung macht sich schon mal warm für das Festjahr 2015. Denn es wird richtig was zu feiern geben in der Stadt. 1000 Jahre sind seit der urkundlichen Ersterwähnung vergangen. Das geht zurück auf Thietmar, den Bischof von Merseburg.
(Burkhard Jung:) "Wir wollen insbesondere das Jubiläum begehen mit der Festwoche vom 31. Mai bis 07. Juni. Der Höhepunkt wird das Stadtfestspiel sein. Mit großen Figuren. Für den Hörer vielleicht ganz plastisch zu beschreiben: große Köpfe bewegen sich sternförmig auf die Innenstadt zu. Menschen können sich anschließen. Diese Köpfe sind thematisch orientiert an Wissenschaft, Kultur… "
Eine kleine Randnotiz: im Jahr 1965 hat Leipzig schon einmal Stadtjubiläum gefeiert. Und zwar 800 Jahre. Ja, naja, heißt es jetzt auf der Homepage, man solle sich nicht wundern, damals ging es um die Stadtwerdung, jetzt um die Ersterwähnung. Wie auch immer, Hauptsache Jubiläum.
"Handel mit Messe, Universität und Wissenschaft, Bürgerstolz und die friedliche Revolution, seit 1989 ist viel passiert, wieder haben die Bürgerinnen und Bürger die Ärmel hochgekrempelt und diese Stadt neu aufgebaut."
Auch die Leipziger Messe gibt 2015 einen aus, denn sie wird 850 Jahre alt. Sie ist damit einer der ältesten Messestandorte der Welt. Bekannt ist vor allem die Buchmesse im Frühjahr. 850 Jahre – Zeit für einen Blick zurück. Aber auch ein gutes Datum, um mit Branchenvertretern aus aller Welt über die Zukunft zu sinnieren, findet Martin Buhl-Wagner, Sprecher der Geschäftsführung:
"Einerseits wollen wir in die Geschichte schauen. Was heißt Messegeschäft, was ist in Leipzig passiert? Was ist generell im Messegeschäft passiert? Das andere ist: wie können wir Personen, Unternehmen nach Leipzig ziehen, die damit unseren Messeplatz kennenlernen, näher kennenlernen und für zukünftiges Geschäft stehen. Wir wollen das Jubiläum nutzen, um zukünftiges Geschäft zu gestalten."
Die Wahlen für Landtag, Europa oder Kommunalparlament sind vorbei. Der Prozess um riskante Finanzgeschäfte der Leipziger Wasserwerde ist glimpflich ausgegangen. Jetzt können sich die Leipziger also voll und ganz ihren Feierlichkeiten zuwenden.
Ganz anders sieht es dagegen in der Landeshauptstadt Dresden aus: Dort, an der Elbe wird es 2015 um ernstere Themen gehen. Seit Wochen gehen die Demonstranten der islam- und asylkritischen Pegida auf die Straße. Stadtvertreter befürchten, dass der Ruf von Dresden als weltoffene Kulturstadt leiden und dass sich die Stadtgesellschaft spalten könnte: in Pegida-Befürworter und Gegner.
Hinzu kommt: am 13. Februar gedenkt die Stadt dem 70. Jahrestag der Bombardierung im zweiten Weltkrieg. Damals starben Zehntausende in der brennenden Stadt. Schon seit Jahren nutzen Rechtsextreme dieses Datum für ihre Aufzüge. Die Dresdner setzen mit einer Menschenkette ein Zeichen dagegen. Stadtsprecher Kai Schulz:
"Da wird es eine große Festveranstaltung in der Frauenkirche und die traditionelle Menschenkette. Wir werden im Sommer, Ende Juni, die Oberbürgermeisterwahlen haben, die natürlich von großer politischer Tragweite sind."
Feiern in Leipzig, Gedenken in Dresden. Für die beiden großen sächsischen Städte könnte 2015 sehr unterschiedlich werden.

Wahlplakate© picture alliance / dpa
Baden-Württemberg – Vorgezogener Wahlkampf und die Frage: Wie will die CDU sich profilieren?
Von Michael Brandt
Das politische Jahr beginnt in Baden-Württemberg in der kommenden Woche wie gewohnt mit dem Dreikönigstreffen der FDP. Aber natürlich ist alles ganz anders als gewohnt, denn die Liberalen kämpfen ums politische Überleben.
In ihrem Stammland selbst machen sie zwar muntere Oppositionspolitik, dennoch sind die Augen in der Landespolitik derzeit auf die andere Oppositionspartei, die CDU, gerichtet.
Anfang Dezember hat sich die Partei für Noch-Landtagspräsident Guido Wolf als Herausforderer von Ministerpräsident Kretschmann entschieden. Und Ende Januar soll die Entscheidung von einem Parteitag umgesetzt werden.
"Dann geht’s natürlich mit Vollgas los. Wir werden Ende Januar in der Fraktion über die künftige Fraktionsspitze entscheiden. Ich werde mich dafür bewerben."
Es gilt als ausgemacht, dass der neue starke Mann der Landes-CDU Fraktionschef wird; und gilt als möglich, dass er auch die Partei führen will – mit Blick natürlich auf die Landtagswahlen im Frühjahr 2016.
Es geht um die zentrale Frage, ob Grün-Rot auch ohne Fukushima und Stuttgart 21 eine Chance hat. Und ob der Bonus des ziemlich beliebten Ministerpräsidenten Kretschmann ausreicht, um die CDU weitere 5 Jahre auf die Oppositionsbänke zu schicken.
Die Gefahr dabei aus Sicht von Kretschmann: Dass der Wahlkampf schon jetzt und damit viel zu früh beginnt.
"Nächstes Jahr finde ich OK, heiße Wahlkampfhase dann drei Wochen vorher, vorher natürlich ein gewisser Vorwahlkampf, ein bisschen Vorgeplänkel, klar, aber richtiger Wahlkampf im nächsten Jahr."
Aber besonders realistisch ist dieser Neujahrswunsch des Ministerpräsidenten nicht, denn CDU-Mann Wolf muss sich als Fraktionschef profilieren und die Schärfe der politischen Auseinandersetzung wird zwangsläufig zunehmen.
Neben der Schulpolitik, über die in Baden-Württemberg schon fast aus Prinzip gestritten wird, wird es um die Wirtschaft gehen. Kretschmann ist in den vergangenen vier Jahren zum Wirtschaftsversteher geworden und will die Themen Digitalisierung und Industrie 4.0, also die Vernetzung von Maschinen und Internet voranbringen:
"Ein ganz wichtiges Querschnittsthema, wo wir eine interministerielle Arbeitsgruppe eingerichtet haben und in meinem Haus ja eine Stabsstelle eingerichtet wird, die sich speziell mit diese Thema befasst und es vernetzt in allen Gebieten."
Damit bewegt sich der Grüne auf einem Gebiet, das der schwarze Frontmann Guido Wolf als sein Revier betrachtet:
"Für uns stehen die Themen Wirtschaft und Innovation im Mittelpunkt. Alles was die Zukunft des Landes ausmacht, sind Themen, die wir anstoßen wollen."
Aber natürlich bleibt für Grün und Rot auch die Energiewende auf der politischen Tagesordnung. Dazu stehen noch einige Gesetze an, aber unter anderem wird sich Umweltminister Franz Untersteller am Ende daran messen lassen müssen, ob es ihm gelingt, den stockenden Ausbau der Windkraft in Fahrt zu bringen:
"Da haben wir länger gebraucht, als ursprünglich gedacht. Wir haben jetzt eine Reihe von neuen Genehmigungen, wir haben über 270 Anlagen im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren, das heißt ich gehe davon aus, dass nächstes Jahr die Zahl der Anlagen in der Landschaft auch hochläuft."
Und die Wirtschaft, für die die Energiewende ebenfalls ein zentrales Thema ist? Sie hat sich in den vergangenen vier Jahren ganz gut arrangiert mit der grünen Politik, zumal in den Bereichen Automobil und Maschinenbau der Zug ohnehin in Richtung Ressourceneffizienz unterwegs ist. Und für 2015 erwartet Peter Kulitz, Präsident des baden-württembergischen Industrie- und Handelskammertags
"Also ganz pauschal müssen wir darauf achten, dass die Politik die Rahmenbedingungen erhält, so dass wir wettbewerbsfähig bleiben können. Dazu gehören natürlich Steuerfragen aber auch Freiräume, die wir haben im tariflichen Bereich."
Apropos tariflicher Bereich: In den nächsten Tagen beginnt die Metall-Tarifrunde, die in Baden-Württemberg immer eine zentrale Rolle spielt. Und diesmal liegen Gewerkschaft und Arbeitgeber so weit auseinander, dass Warnstreiks so gut wie sicher sind und ein richtiger Streik nicht auszuschließen ist.
