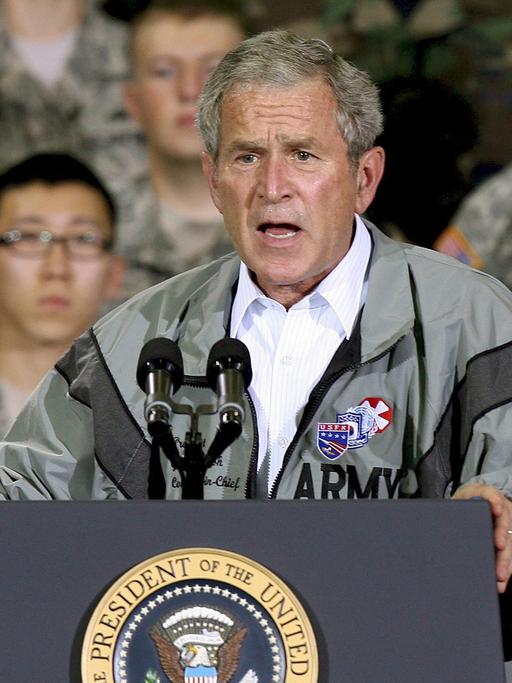"Amerika kann nicht der Weltpolizist sein"

Barack Obama hielt sich während seiner Amtszeit außenpolitisch zurück, die USA griffen nur bei wenigen Konflikten ein. Dieses "selektive Engagement" sei richtig, findet Charles King Mallory, allerdings sei Obama dabei zu weit gegangen. So sei ein Vakuum im Nahen Osten entstanden.
Charles King Mallory, ehemaliger Direktor des Aspen Instituts Deutschland, sieht die beiden Amtszeiten von US-Präsident Barack Obama in einem eher positivem Licht. Im Deutschlandradio Kultur hob er vor allem die eher abwägende und zurückhaltende Außenpolitik Obamas hervor. Es sei richtig, dass die USA sich nicht mehr überall auf der Welt engagierten und versuchten, immer eine dominierende Rolle zu spielen, sagte er.
Obama sei dabei aber zu weit gegangen, betone Mallory. So sei beispielsweise im Nahen Osten ein Vakuum entstanden. Bei "selektivem Engagement" müsse man dennoch einsatzbereit sein und internationale Koalitionen schmieden, die dann das Vakuum füllten, so Mallory. Dies habe die Obama-Administration nicht geschafft. Als besondere Leistung Obamas hob Mallory den Iran-Deal hervor.
Das Gespräch war der Auftakt zu einer Themenwoche im Deutschlandradio Kultur, die sich anlässlich der Präsidentschafts-Wahl im November eingehend mit den Vereinigten Staaten beschäftigt.
Das Gespräch im Wortlaut
Nana Brink: Was war das für ein Präsident, der da 2008 die Weltbühne betreten hat – Barack Obama, jung, dynamisch, schon eine Popikone damals, ein Mann mit Gewissen auch, der erste schwarze Präsident in der Geschichte. Einer, der die Massen begeistert hat, der nicht nur zu Hause, auch hier – wir erinnern uns noch an den Auftritt vor der Berliner Siegessäule im Sommer 2008, da haben ja über 200.000 dem neuen Hoffnungsträger zugejubelt, der ein ganz anderes Amerika ja verkörpert hat und der "Change" versprochen hat.
Eine bessere Welt wollte er schaffen, mit mehr Diplomatie, mehr internationaler Zusammenarbeit und weniger Atomwaffen. Das war übrigens die Begründung des Nobelpreis-Komitees, das ihm im Jahr 2009 den Friedensnobelpreis verliehen hat. Wenn er jetzt geht, können wir dann sagen: "Yes, he did?" Charles King Mallory war Direktor des Aspen Instituts Deutschland und hat Obamas Politik von beiden Seiten des Atlantiks aus beobachtet – wir erreichen ihn in New Orleans. Schönen guten Morgen!
Charles King Mallory: Guten Morgen, Frau Brink!
Brink: Hat sich dieser Präsident selbst entzaubert?
Mallory: Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, es kommt immer eine Periode der Ernüchterung mit Präsidentschaften. Man fängt mit großen Hoffnungen an und oft auch mit großen Versprechungen, und allmählich sickert die Realität durch nach einiger Zeit. Und es kommt immer deswegen ein Gefühl der Entzauberung bei Präsidenten, in einigen Fällen geht es tiefer als in anderen.
Brink: Obama hat ja blutige Kriege geerbt, und er wollte sie beenden, das hat er auch. Nun kann man sich ja fragen, war das sinnvoll, denn sowohl der Irak wie ja auch Afghanistan sind ja alles andere als befriedet.
Obama wollte weg von der amerikanischen Dominanz
Mallory: Ich glaube, seine große Politik, die Idee, dass man sich wegbewegt von einer Strategie der amerikanischen Dominanz, die wirklich seit Ende des Kalten Krieges von Herrn Clinton und auch von Herrn Bush geführt wurde, im Prinzip aber die richtige war. Er ist einfach ein bisschen zu weit gegangen, und dadurch sind Vakua entstanden im Nahen Osten und anderswo, und das hat negative Konsequenzen mit sich gezogen.
Brink: Sie haben ja genau diese Doktrin auch von Obama beschrieben, dieses Vakuum, was er hinterlassen hat, zum Beispiel in Syrien, in das ja dann in Russland reingehen konnte. Er hat das ja "Leading from Behind" genannt, also wie führen von hinten. Das war falsch?
Mallory: Ich glaube, im Prinzip nicht. Ich glaube, die Beschreibung, also "Leading from Behind", ist nicht sehr positiv ausgedrückt. es ist eigentlich eine hybride Strategie von quasi Isolationismus und selektives Engagement, die Idee, Amerika kann nicht der Weltpolizist sein.
Was da falsch war, ist, dass man wirklich, wenn man eine solche Politik führen möchte, dann muss man auch sehr einsatzbereit sein in Fällen, wo man sich nicht engagiert, um internationale Koalitionen zusammenzubasteln, die dann dieses Loch anstatt der Vereinigten Staaten füllen.
Und das verlangt ein sehr effektives Team, ein erfahrenes Team, und es verlangt auch ein Team, das das Vertrauen hat, die Bürokratie arbeiten zu lassen. Und das ist leider nicht geschehen in seiner Administration.
Brink: Das würde ich gerne noch ein bisschen genauer wissen von Ihnen, ein bisschen präzisieren. Wenn Sie sagen, das Vakuum, das entstanden ist, Beispiel Syrien, da hat er ja eine sogenannte rote Linie gezogen, damit hat er gemeint, wenn Giftgas eingesetzt wird, dann werden wir auch militärisch, also auch mit "Boots on the ground" intervenieren, also mit Soldaten vor Ort. War das der Kapitalfehler, dass er das nicht gemacht hat?
"Politik des selektiven Engagements"
Mallory: Es ist nie eine gute Idee, eine rote Linie zu ziehen und dann, wenn sie überschritten wird, nichts zu tun, weil die Glaubwürdigkeit der Vereinigten Staaten und eines Präsidenten damit infrage gestellt wird.
Das Problem war, es gab eine Revolution in Syrien, ein Kampf ist angefangen, und die Vereinigten Staaten wollten sich nicht engagieren. Das heißt, es ist ein Loch entstanden, es gab keine straffe politische Führung mehr in Syrien, es gab keine internationale Initiative, sich da wirklich schnell und stark zu engagieren, ein humanitäres Desaster ist entstanden, extremistische Gruppen sind reingegangen.

So sieht Aleppo in Syrien inzwischen aus: Hier haben die USA, anders als in früheren Konflikten, außenpolitisch sehr zurückhaltend agiert© AFP
Diese Politik des selektiven Engagements verlangt, dass, wenn die Vereinigten Staaten selber nicht reingehen möchten und die Probleme richten möchten, dann müssen sie die Ressourcen haben und die Bereitschaft haben, diplomatische Führung zu übernehmen, um eine internationale Koalition dazu zu bewegen, das Problem zu richten. Und wenn das nicht passiert, dann entstehen wirklich fürchterliche Sachen, wie wir gesehen haben.
Brink: Also Sie machen dann Obama auch dafür verantwortlich oder die Politik von Obama, dass das so eskaliert ist, so ein humanitäres Desaster ist?
Mallory: Ich glaube, es ist richtig, dass die Vereinigten Staaten sich nicht überall engagieren, dass sie nicht versuchen, eine dominierende Rolle zu spielen, und da hat der Herr Obama, glaube ich, eine richtige Wahl getroffen.
Brink: Wenn Sie die Diplomatie ansprechen und die Strategie, auch den langen Atem, dann kann man ja aber zwei Beispiele unter Obama schon zitieren, nämlich dass er es geschafft hat, einen Deal mit dem Iran hinzubekommen, was über Jahrzehnte nicht möglich war, und er ist auch nach Kuba gefahren, mit dem man ja jahrzehntelang im Streit lag. Also positiv doch?
Mallory: Persönlich habe ich die Initiative mit Iran immer unterstützt, und diejenigen, die ich auch beraten habe, dazu bewegt. Man kann fragen, ob die Einzeldetails dieses Vertrags mit Iran streng genug waren, ob die Verifizierungsmaßnahmen stark genug waren, aber im Prinzip, glaube ich, ist das schon eine Errungenschaft, und umso mehr, dass er das multilateral gemacht hat mit unseren europäischen und internationalen Partnern.
Also ja, da würde ich sagen, im Fall Iran hat er ein positives Zeichen gesetzt, allerdings muss sich noch herausstellen, ob es klappen wird. Wir haben diese Woche vom deutschen Bundesverfassungsschutz gehört, dass Iran nicht aufhört, nukleare Technologie, die für eine Waffe nötig wäre, zu kaufen oder zu versuchen zu kaufen sofort nach diesem Vertrag.
Brink: Was bleibt von Barack Obama, was wird denn seine Legende sein, wenn er geht?
Von Obama wird vor allem der Iran-Deal bleiben
Mallory: Ja, also ich glaube, auf der positiven Seite der Bilanz kann man bestimmt diesen Nuklearvertrag mit Iran im Moment nennen – ob es so bleibt, wird sich erst später herausstellen, aber ich bin da eher zuversichtlich.
Ich glaube, man wird kurzfristig sozusagen auf diese Konflikte gucken – wie Syrien, Irak, Afghanistan – und sich wundern, ob da wirklich es nur sich seitwärts bewegt hat oder sogar eher negativ.
Und man wird sich auch natürlich fragen, ob die Terrorbedrohung beim Ende seiner Amtszeit besser oder schlechter geworden ist. Einige würden vielleicht behaupten, dass man dafür argumentieren kann, dass es eigentlich schlechter wurde als am Anfang.
Aber ich glaube, im großen Gefüge wird eine positive Bilanz rauskommen, weil er sich wegbewegt hat von dieser Strategie der Dominanz in Richtung selektives Engagement, kollektive Verteidigung – was im Grunde genommen der Iran-Vertrag war – und da, glaube ich, hat er bestimmt die richtige Richtung eingeschlagen.
Brink: Charles King Mallory, ehemals Direktor des Aspen Institute in Deutschland. Schönen Dank, Herr Mallory, für das Gespräch!
Mallory: Gern geschehen, Frau Brink!
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandradio Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.