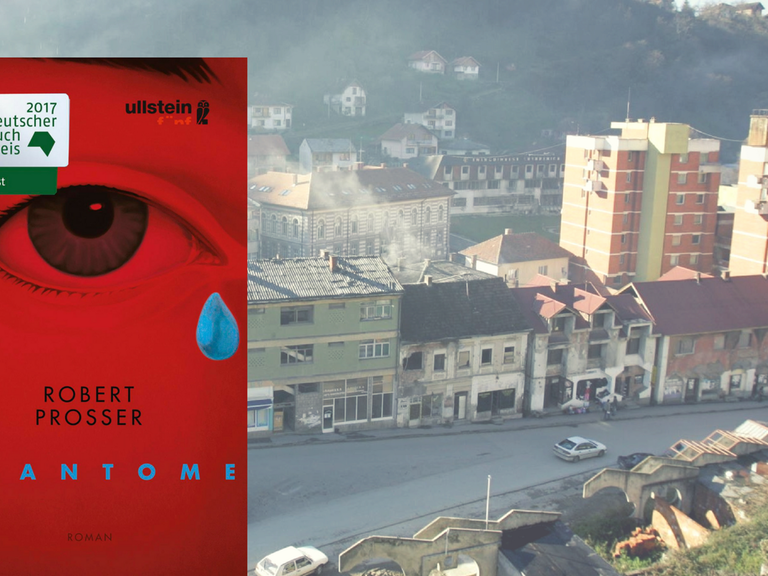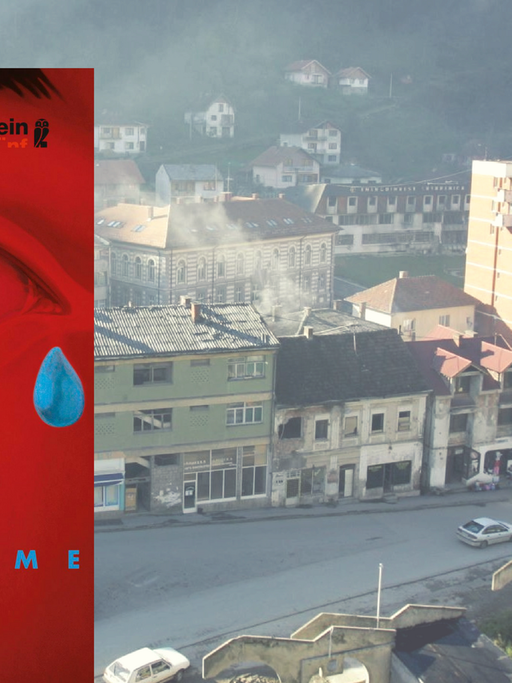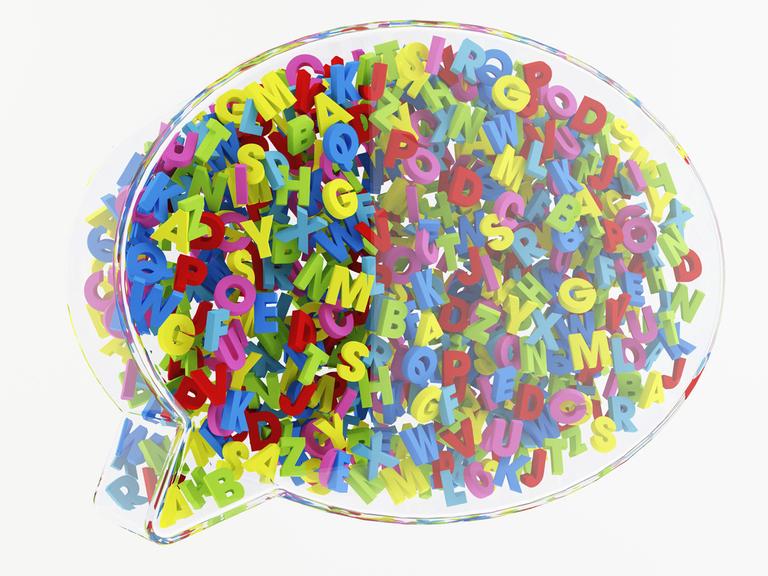"Im Kampfsport ist das Egalitäre interessant"
09:54 Minuten

Der Autor Robert Prosser steigt selbst in den Ring, um zu boxen. In seinem jüngsten Roman "Gemma Habibi" betrachtet er den Sport von seiner gesellschaftlichen Seite und fängt die damit verbundenen politischen Fragen ein.
Frank Meyer: Der neue Roman von Robert Prosser führt ins Boxtraining, zu Boxkämpfen und in den Körper eines Boxers. Er führt nach Wien, nach Syrien und nach Ghana in Westafrika. Robert Prosser ist Jahrgang 1983, sein letzter Roman "Phantome" stand auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Sein neues Buch hat es auf die Bestenliste des Österreichischen Rundfunks geschafft. Robert Prosser lebt in Wien.
Ihr neuer Roman heißt "Gemma Habibi". Sie müssen uns erst mal mit einer Übersetzung auf die Sprünge helfen. Was bedeutet das denn?
Prosser: Also Gemma wäre ein österreichischer Slang oder Dialekt und heißt so viel wie auf geht’s, los geht’s, geh’n wir. Habibi ist aus dem Arabischen für Schatzi oder Freund.
Meyer: Also: Los geht’s, Schatzi – ist das eine Wendung, die Sie irgendwo aufgeschnappt haben, reden Leute um Sie herum so, oder ist das Ihre Erfindung?
Prosser: Zumindest im Boxclub. Es ist natürlich auch im Alltagsleben in Wien. Aber für mich ist dieser Titel auch ein Beispiel für die Besonderheiten, auf die man im Boxen stößt; diese Vermischung verschiedenster Nationalitäten, was auch verschiedenster Sprachen heißt: Österreichischer Dialekt trifft auf Arabisch, auf Türkisch, auf Serbokroatisch, und das ergibt so einen ganz eigenen Lingo, der sehr prägnant und sehr kennzeichnend für das Boxen ist.
Über Lesbos zurück nach Wien
Meyer: Das ist einer der Vorteile Ihres Romans, dass man in diese Welt eines Boxclus, auch in die Internationalität hineingerät. Lassen Sie uns einen Schritt zurückgehen, an den Anfang Ihres Nachdenkens über dieses Romanprojekt. Sie erzählen in einem Essay, dass eine Reise auf die griechische Insel Lesbos für Sie wie ein Anstoß für diesen Roman war. Warum das?
Prosser: Ich hab mich sehr lang mit einem Zugang zum Boxen beschäftigt, wie man darüber schreiben kann, also auch wie sich das sprachlich umsetzen lässt. Es kam dann aber mehr oder weniger etwas dazwischen, ich hab mich mit einer anderen Thematik auseinandergesetzt, nämlich mit der der sogenannten Flüchtlingskrise, die in Österreich mit Herbst 2015 für ziemliche Aufregung gesorgt hat.
Meyer: Nicht nur bei Ihnen, kann ich Ihnen sagen.
Prosser: Stimmt. Aber in Wien das hautnah mitzuerleben, auch wie die Gesellschaft drauf reagiert. Erst ist diese Solidarität und Hilfsbereitschaft – das war wirklich eine Art von Euphorie, gerade in Wien im September 2015. Und wie sich das dann Schritt für Schritt verändert hat. Die Route über Ungarn wurde geschlossen, dann ging es über Slowenien. Es wurde immer ungreifbarer, auch im Alltagsleben, dass man auf diese Menschen trifft und irgendwie tätig sein kann.
Es rutschte aber immer mehr in den Medien in eine Art von Angstmache ab. Gerade auch in Österreich auch die Propaganda, die sehr gut funktioniert hat und auch politisch benutzt worden ist.
Im Versuch, das irgendwie zu verstehen, dachte ich mir, es wäre eine gute Idee, auch die europäischen Außengrenzen zu besuchen und zu schauen, was passiert zum Beispiel auf Lesbos, als einer jener Inseln, wo viele angekommen sind. Ich war dann im Juni 2017 dort, schon mit der Idee, das vielleicht irgendwie in einen Roman einzubinden oder darüber zu schreiben.
Boxen als Ausgleich und Hobby
Meyer: Da standen Sie auf dieser Insel im Angesicht auch der Flüchtlingslager mit Blick auf die türkische Küste. Dieser Sprung, jetzt zu sagen, die Flüchtlingsproblematik bewegt mich, was passiert in Österreich damit, das anhand eines Boxclubs zu erzählen, was ist da die Verbindung, warum ist der Boxclub der richtige Schauplatz?
Prosser: Auf der Suche nach einem Zugang ist mir schon bewusst geworden, dass es nicht funktioniert, wirklich über ein Camp, über ein Flüchtlingslager zu schreiben. Das ist so ein großes Thema, da steckt viel Leid dahinter, dachte ich. Da fehlt mir auch das Verständnis dazu und auch die Berechtigung.
Was mir aber auf Lesbos klargeworden ist oder in der Beschäftigung damit, war, dass es schon vor meinen Augen liegt, nämlich dass das auch etwas ist, was im Boxclub passiert – gerade im Boxclub, wo so viele Nationalitäten aufeinandertreffen. Das Boxen, Kampfsport, ist ein Anlaufhafen für sehr viele aus dem arabischen Raum, aus Tschetschenien, aus Afghanistan, die nach Europa kommen und dadurch wieder Anschluss finden. Es wird im Boxen im Kleinen durchgespielt, was die Gesellschaft im Großen bewegt.
Meyer: Man muss dazusagen, dass Sie das kennen, weil Sie selbst Boxer sind. Sie haben die Innenperspektive und haben auch die Erfahrung, um darüber schreiben zu können.
Prosser: Genau, Kampfsport begleitet mich schon seit 2011, wobei ich sagen muss, dass ich nicht sonderlich erfolgreich war und bin. Ich betreib es mittlerweile als Ausgleich und als Hobby.
Die Herkunft im Ring hinter sich lassen
Meyer: Die These – das ist interessant in Ihrem Buch und Ihr Erzähler äußert sie auch –, dass das Interessante beim Boxen ist, wenn man da reingeht, in einen Club und in diese Kämpfe und ins Training, dass eigentlich alles andere, was man mitbringt – die Herkunft, die Sprache, die Fluchtgeschichten, die Bildung, der finanzielle Hintergrund –, dass das alles draußen vor der Tür bleibt, weil im Kämpfen selbst nur die Präsenz in diesem Augenblick zählt, nur der Körper zählt. So ungefähr richtig wiedergegeben?
Prosser: Ja, stimmt. Ich glaube, was daran interessant ist, ist eine gewisse Ambivalenz, die im Kampfsport existiert, dieses Egalitäre, das gerade im Moment des Kampfes entsteht, also dass es vollkommen egal ist, von woher du kommst und was dich in den Ring gebracht hat. Da geht es in diesem Moment, in diesen drei Runden, da geht es um ganz was anderes. Da entsteht ein besonderer Moment.
Auf der anderen Seite werden natürlich im Boxclub auch bestimmte kulturelle Problematiken durchgearbeitet. Sehr viele sehr erfolgreiche und sehr gute Kämpfer sind Muslime, was die hiesigen Trainer schon vor Herausforderungen stellt. Wie geht man zum Beispiel damit um, dass ein Kämpfer oder eine Kämpferin Ramadan hält – was eigentlich ganz schlecht ist. Es ist gerade Turnierzeit und dann fastet der Sportler, wie findet man da einen Kompromiss.
Das finde ich sehr interessant. Es ist enorm in Bewegung, es gibt schon einen kulturellen Aufprall; zugleich wird das alles aufgehoben und es entsteht so ein Traum des Egalitären.
Meyer: Würden Sie so weit gehen und sagen, dieser Raum des Egalitären, das ist auch ein utopischer Raum, der zeigt, was möglich wäre, wenn man in der Tat alles außen vor lässt, was zufällig an uns ist, wie unsere Herkunft, und nur darauf schaut, was jemand in einem bestimmten Moment ist. Ist das eine Art Utopie, die Sie mit ihrem Buch zu fassen versuchen?
Prosser: Ja, auf jeden Fall. Sagen wir mal so, ein kurzzeitiges Wahrwerden von Utopie, dass es perverserweise im Kampf oder in diesem Aufprall möglich ist, diese Grenzen zu überwinden.
Die eigene Rhytmik des Boxkampfes
Meyer: Und haben Sie auch versucht, das sprachlich nachzubilden, also Ihre Sprache in dem Buch auch boxen zu lassen?
Prosser: Ja, das war eine besondere Herausforderung, diese Sprache zu finden. Ich hab 2011 mit Thaiboxen angefangen. Damals war schon früh dieses Interesse da, dies literarisch festzuhalten, weil die Szene, die Menschen, die Charaktere und Geschichten, auf die man trifft, geben einfach auch viel her. Das ist schon an sich guter Stoff. Es war aber schon sehr schwer, das irgendwie sprachlich umzusetzen. Zum einen, was im Kampf passiert, wie die Szene funktioniert – es ist auch sehr klischeebehaftet, auch wie man oft miteinander redet, diese Slogans, wie man es aus dem Boxen kennt – From Ghetto to Glory.
Das aber zu umschiffen und irgendwie hinzukommen und eine Sprache zu finden, die auch den Kampf ausdrückt oder was im Kämpfer während des Fights passiert, das sprachlich irgendwie anders aufzuarbeiten, auch diese Rhythmik auszudrücken, die im Boxen immer da ist. Sobald man in den Club geht, das Seilspringen, die Schläge auf die Sandsäcke, der Kampf selbst, das Atmen, das Schnaufen, das Stöhnen und Schreien – an sich ist das alles extrem durchrhythmisiert, ist eine ganz eigene Melodie.
Es hat schon gedauert und ich hoffe, ich hab das im Roman geschafft, das Sprachliche auch abzubilden. Diese Art von Rhythmik, die dahintersteckt, dass das wirklich eine dauernde Melodie, ein ganz besonderer Takt ist, der im Boxen existiert.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandfunk Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.