Prof. Dr. Philipp Sarasin, geboren 1956 in Basel, lehrt Geschichte der Neuzeit an der Universität Zürich, ist Mitbegründer und Mitglied des "Zentrums Geschichte des Wissens" in Zürich sowie unter anderem Mitherausgeber des Online-Magazins "Geschichte der Gegenwart". In seinen Büchern wie "Darwin und Foucault – Genealogie und Geschichte im Zeichen der Biologie" (2009) oder "Anthrax: Bioterror als Phantasma" (2004) setzt er sich immer wieder mit den historischen Voraussetzungen gegenwärtiger Phänomene auseinander.
'We the people' kann auch Ausgrenzung bedeuten

Sie sind gegen Eliten und geben vor, das Volk zu repräsentieren - Populisten von Donald Trump bis Marine Le Pen. Im Kern ihrer Botschaft entdeckt der Historiker Philipp Sarasin eine autoritäre Logik, die dazu neigt, nationalistische und sogar diktatorische Züge anzunehmen.
Sie sind gegen die Eliten, gegen das politische Establishment – Populisten von Donald Trump bis Marine Le Pen berufen sich stets darauf, das Volk zu repräsentieren, ihm eine Stimme und politische Herrschaft zu verschaffen. Doch welche Rolle kommt dem "populus" im Denken der politischen Moderne wirklich zu und wie konstituiert sich jene Herrschaft, auf die sich etwa Donald Trump beruft?
Stützte sich nicht gerade die amerikanische Verfassung bereits 1787 auf die Formel "We, the People"? Ohne Zweifel gibt es einen legitimen Kern des Populismus, der heute von den öffentlichen Formen und bürokratischen Institutionen der parlamentarischen, repräsentativen Demokratie für viele Wähler nicht mehr erfüllt werden kann. Doch im Kern derer, die dem Volk jene von den politischen Apparaten "entwendete" Macht wieder "zurückgeben" wollen, entdeckt der in Zürich lehrende Historiker Philipp Sarasin eine autoritäre Logik, die dazu neigt, nationalistische, militaristische und sogar diktatorische Züge anzunehmen.
Das Interview in voller Länge:
Deutschlandfunk Kultur: Herr Sarasin, der politische Paukenschlag dieser Woche, die Kündigung des Pariser Weltklimavertrags durch Donald Trump, das ist doch eigentlich – in Anführungszeichen – nur die Einhaltung eines Wahlversprechens. Der Mann, so konnte man das auch lesen, hält eben sein Wort. Hat sich Donald Trump also nicht nur als Populist wählen lassen, sondern sich auch entschlossen als Populist zu regieren?
Philipp Sarasin: Ja, das glaube ich schon. Das ist absolut richtig. Donald Trump ist ja angetreten unter anderem bring back coal jobs, also Jobs in der Kohleindustrie. Und er ist auch angetreten unter dem Titel: I alone can fix it. Ich alleine schaffe es und bin derjenige, der Amerika wieder groß macht. – Und beides ist populistisch. Also, die Idee, er schafft es, strukturelle Probleme zu lösen – Kohleindustrie, wo ganz viel Technologie auch dazu geführt hat, dass es diese vielen Jobs einfach nicht mehr gibt – er bringt sie zurück. Und populistisch ist natürlich die Vorstellung, er alleine ist es, der das schafft. Und wenn es sein muss, gegen die ganze Welt!
Deutschlandfunk Kultur: Die haben das Brechen politischer Regeln nicht nur als Schönheitsfehler – sagen wir – von exzentrischen Politikern wie Trump, Orban oder Erdogan beschrieben, sondern geradezu als Prinzip populistischer Politik, als Exzess des Politischen, so dass man sagen kann: Die populistischen Wähler verzeihen ihren Führern sogar den Missbrauch ihrer Macht. Denn viele in den USA sind ja eigentlich klimabewusst und sind auch dafür, dass Klimaziele eingehalten werden. Aber da geht es auch um die Zerschlagung eines bestimmten politischen Apparats, eines Establishments. Das, meine ich, zeigt sich auch in dieser Aufkündigung. Denn es ist ja eine Aufkündigung, die hier große Wellen schlägt, weltweit große Wellen schlägt, weil man sagt, das gibt’s doch nicht. Wie kann der ein solches Abkommen, hinter dem sich die halbe Welt versammelt hat, einfach aufkündigen?
Ein Schuss ins eigene Knie?
Philipp Sarasin: Ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein politisches Kalkül ist von ihm, bei dem der Schuss hinten rausgehen kann. Also, Klimaschutz ist populär durch die Wählerschaft beider Parteien hindurch in den USA. Auch die Industrie steht hinter diesem Abkommen, ich würde sagen, mehrheitlich, soweit ich das sehe. Und insofern kann es tatsächlich sein, dass Donald Trump sich damit ziemlich massiv ins Knie schießt, so wie auch die Republikaner und Trump sich ins Knie geschossen haben wahrscheinlich mit der Krankenversicherungsvorlage, die einfach schädlich ist für so viele Leute und ganz besonders für die Wähler von Donald Trump.
Also, ich glaube tatsächlich, diese Vorstellung I alone can fix it, und ich mache es gegen die ganze Welt und gegen die ganzen Apparate und gegen die ganzen Wissenschaftler, die Klimaforschung betreiben und schon lange sagen, es gibt menschheitsinduzierten Klimawandel, ja, das ist der populistische Versuch. Aber ich glaube, in dem Fall wird das wahrscheinlich nicht funktionieren.

Im Tacheles-Gespräch: Der Historiker und Autor Philipp Sarasin. © imago
Es gibt auch Leute, die sagen: Beruhigt euch, der Ausstieg aus diesem Parisabkommen dauert etwa vier Jahre. Bis dann ist Donald Trump schon lange im Gefängnis. Das habe ich heute auf Twitter so gelesen. Ich finde, das ist vielleicht ein wenig zugespitzt, aber ob diese Präsidentschaft Trump wirklich Erfolg hat im Sinne von vier oder acht Jahre dauert und nicht vorher abgebrochen werden muss, das steht ja noch in den Sternen.
Deutschlandfunk Kultur: Na ja, die Politiker in den Talkshows haben auch schon gesagt: Na ja, acht Jahre werden wir auch überstehen. Und diesen Klimawandel werden wir in acht Jahren auch weiter aufhalten können, selbst wenn Donald Trump dann nicht mehr Präsident ist.
Aber lassen Sie uns mal auf die populistische Figur Donald Trumps und auch auf den Populismus dahinter blicken. Wenn wir uns an die Inaugurationsrede von Donald Trump erinnern, dann hat er gesagt: Der 20. Januar 2017 wird als der Tag in Erinnerung bleiben, an dem das Volk wieder zu den Herrschern dieser Nation würde. – Da hat man jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass das Volk Herrscher ist, sondern dass Donald Trump Herrscher ist.
Populismus zwischen Autorität und Legitimität
Philipp Sarasin: Na ja, das ist natürlich im Zentrum dieser populistischen Rhetorik. Diese Inaugurationsrede ist geradezu ein Schulbuchbeispiel dafür, wie Populismus funktioniert.
Ich glaube, im Kern des populistischen Begehrens oder der populistischen Politikvorstellung steht die Idee, dass man das Volk direkt mit der Macht und mit dem Politischen kurzschließt, dass das Volk die Macht selbst in der Hand hat, und zwar in Umgehung aller vermittelnden Instanzen – also, wie staatlicher Bürokratie, Parlamente, Parteien, sogenannten Eliten, also Experten auch, in Umgehung all dieser Instanzen, die in komplexen Gesellschaften, in denen wir leben, notwendig sind, um diese komplexen Verhältnisse, die wir ja regeln müssen, und die komplexen Interessensausgleiche, die wir zustande bringen müssen, das alles gleichsam zu unterdrücken mit einer imaginären direkten Verbindung von Volk und dann nur noch einer Figur, dem Führer, dem Präsidenten, der eben – ich wiederhole mich – von sich sagt: Ich allein schaffe das – gegen die Eliten. Und ich gebe jetzt dem Volk die Macht zurück. Ich führe es einfach im Namen des Volkes aus.
Das heißt, dieser Populismus hat auch im Kern etwas sehr Autoritäres, ist nicht darauf aus auf demokratischem Interessenausgleich, vermittelt durch gewählte Parlamentarier, durch Parteien, durch eine staatliche Bürokratie, die hilft, diese Maschine in Gang zu halten.
Nein, der Präsident verspricht dem Volk: Ihr seid jetzt wieder direkt an der Macht – was natürlich komplett imaginär ist.

Populistisches Begehren: Die direkte Verbindung zwischen Volk und Führungsperson© AFP /
Deutschlandfunk Kultur: ... was aber zurückgeht auf die Verfassung der Vereinigten Staaten von 1787, wo es dann am Anfang heißt: "We, the People…"
Philipp Sarasin: Genau. Und das natürlich zeigt, dass der Populismus ein genuin modernes Phänomen ist. Weil: Gehen wir in die Situation in Frankreich Ende des 18. Jahrhunderts, also Ende Absolutismus: Der König von Gottes Gnaden herrscht über das Land. Es kommt zur Französischen Revolution. Und der Dritte Stand, gemeint ist das ganze Volk, gemeint sind die bürgerlichen Schichten, sagen: Wir sind die Repräsentanten dieses Volkes und wir sind die Basis der politischen Legitimation, jeder denkbaren politischen Legitimation.
Das heißt, die Moderne hat ein Politikverständnis etabliert in Amerika, in Frankreich und schrittweise dann auch anderswo, da kommt die Macht nicht von einem König, der von Gott letztlich legitimiert ist, sondern immer vom Volk. Also, dieser Bezug aufs Volk ist konstitutiv. Insofern hat der Populismus einen legitimen Kern.
Aber! Und das ist ganz wichtig: Dieser Begriff des Volkes ist seinerseits eine imaginäre Konstruktion.
Zuerst mal haben wir eine Bevölkerung, Menschen, die in einem Gebiet mit unklaren Grenzen leben. Und jetzt beginnt sich im Zuge der Nationenbildung in Europa, im Entstehen des Nationalstaates ein Homogenisierungsprozess durchzusetzen, wo man sagt: Das Volk hat eine bestimmte Sprache oder eine bestimmte Kultur, vielleicht sogar eine Rasse, wie auch oft gesagt wurde. Und es lebt in ganz bestimmten Grenzen. Und das nennen wir die Nation.
In Amerika sehen Sie die Paradoxie dieses Volksbegriffs, we the people, ganz deutlich daran, dass gleichzeitig die Urbevölkerung ausgerottet wurde und die Sklaverei ermöglicht wurde. Also, "we the people" kann auch heißen: Wir grenzen ganz hart andere aus.
Wer zählt zum Volk - und wer nicht
Deutschlandfunk Kultur: Der Populismus ist aber sozusagen, jetzt wiederum historisch gesehen, eigentlich sozusagen ein Phänomen der Moderne, das haben Sie gesagt, aber eben auch ein genuines Phänomen des 19. Jahrhunderts. Also, es gab in Russland im 19. Jahrhundert eine Bewegung, die hieß Narodniki. Das ist wörtlich übersetzt, könne man sagen, die Volkisten, das einfache Volk. Die haben die Bauern verherrlicht. Und zeitgleich gab es in den USA zwischen 1891 und 1908 die "People’s Party", die sich explizit auch Populisten nannten und ihre Anhänger vor allen Dingen bei den Farmern im Westen gefunden hatte, die gegen die Banken Sturm liefen.
Und da fragt man sich schon: Dieses einfache Volk, also nicht nur "Volk in Grenzen", sondern das einfache Volk ist eigentlich im Zentrum, könnte man auch wertneutral sagen: die sozialistischen Bewegungen, die einfachen Arbeiter, die eine Stimme in der Politik brauchen.
Sind da die heutigen Populisten Erben dieser Bewegung oder haben die einen anderen Volksbegriff?
Philipp Sarasin: Also, das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, dass die Macht populistischer Rhetorik deshalb auch so groß und so stark ist und heute so attraktiv, weil sie changiert zwischen diesen beiden Volksbegriffen. Die Linke hatte ganz stark seit Marx diese Vorstellung, das einfache Volk, also letztlich, es hieß dann: Die Formel war "Diktatur des Proletariats". Das einfache Volk soll die Macht haben, was eine klassisch-moderne Vorstellung ist.
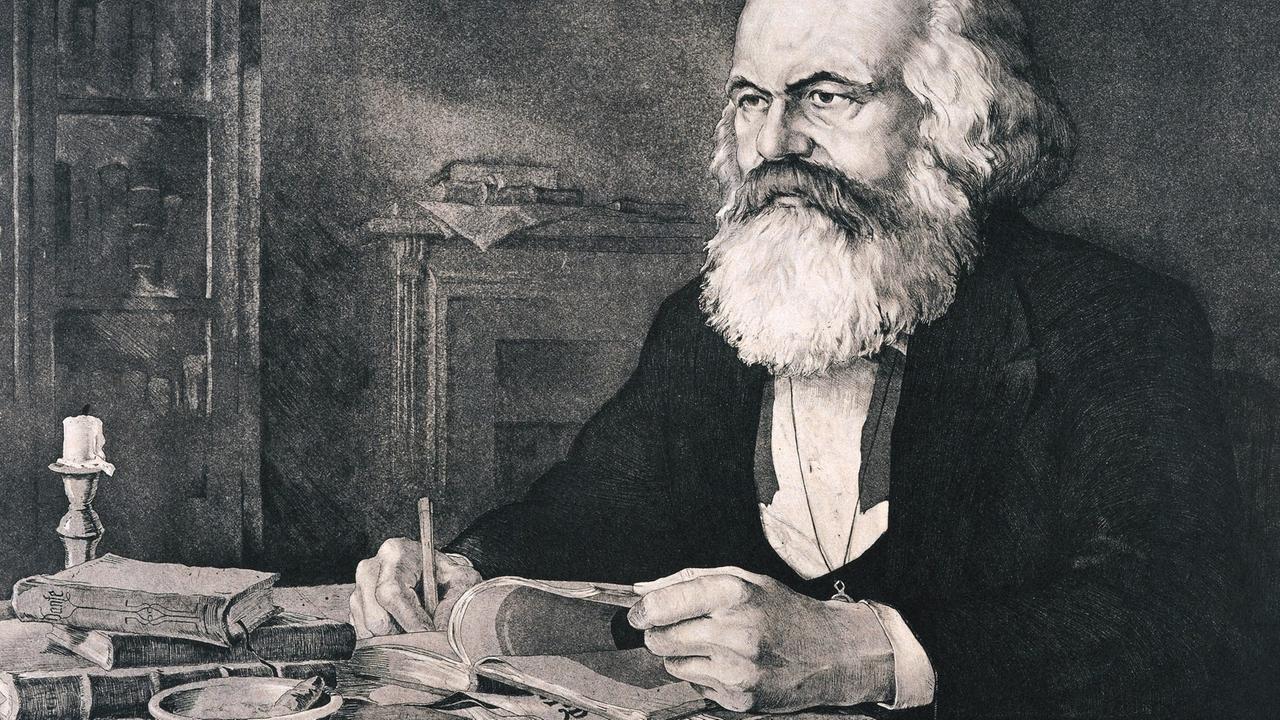
Früher Populist? Bei Karl Marx war das Volk de facto das Proletariat.© picture alliance / dpa
Die Frage ist immer: Was ist dieses Volk? Bei Marx war das Volk de facto das Proletariat. Im Sowjetsozialismus, der sich auch auf das Volk berief, waren zum Beispiel die Bauern Feinde, also die Kulaken, die sogenannten kleinen Landbesitzer waren Feinde, die man bekämpft hat, die man nicht zum Volk zählte, sondern der Industriearbeiter ist das Volk.
In den demokratischen Bewegungen des 19. Jahrhunderts, auch in der Schweiz, manifestiert sich die einfache Bevölkerung. Und auch die Linke um 68 hat diesen außerparlamentarischen Machtbegriff stark zu machen versucht und gesagt: Wir müssen das Volk wieder an der Macht beteiligen gegen die Parlamente, gegen die Presse, gegen die Apparate. – Also, Sie haben dieses Spiel zwischen Volk als Ethnie, vielleicht sogar mit einer rassischen Grundlage auf der einen Seite, und auf andererseits die einfache Bevölkerung mit ihren Anliegen. – Dieses Spiel haben Sie permanent.
Kampf gegen die Eliten
Deutschlandfunk Kultur: Wenn man das sich jetzt genauer anschaut, wogegen das einfache Volk opponiert oder in Stellung gebracht wird, dann sind das, wie Sie schon angedeutet haben, das Establishment, die Eliten. Und da könnte man ja zwei Dinge auseinanderhalten, nämlich die wirtschaftlichen Eliten und die politischen Eliten.
Ich habe ein Zitat aus den USA: "Die Wallstreet hat das Land übernommen. Wir haben es nicht länger mit einer Regierung des Volkes zu tun, sondern mit einer für die Wallstreet."
Das könnte jetzt wirklich ein Satz aus dem amerikanischen Wahlkampf gewesen sein oder auch einer der Occupy-Bewegung. Das ist eigentlich ideologisch gar nicht mehr einzuordnen. Tatsächlich stammt das Zitat aber von Mary Elizabeth Lease, einer Aktivistin eben dieser People’s Party, die das 1888 gesagt hatte. Das klingt verdammt heutig.

Die Macht der Wallstreet ist immer wieder Gegenstand demokratischer Debatten und populistischer Rhetorik© dpa/picture alliance/Daniel Karmann
Philipp Sarasin: Ja, absolut, natürlich. Und ich meine, wie soll man sagen? Man hat in einer Demokratie immer das Recht darüber zu klagen, dass gewisse Interessengruppen zu stark werden. Man hat das Recht, systematisch an der Macht der Mächtigen zu zweifeln. Das ist völlig legitim. Und daraus besteht auch Politik. Man soll die Macht derjenigen, die viel Einfluss haben, kritisieren. Und man kann selbstverständlich auch immer den Zweifel haben, dass hinter Politikern zu starke Geldgeber sehen. Das gehört zur Grundausstattung demokratischer Systeme.
Der entscheidende Punkt ist: Was ist jetzt die Lösung für so was? Ein demokratischer Politiker in einem Verständnis, wie es sich etabliert hat seit dem 19. Jahrhundert, wie es – glaube ich – auch in Europa so verstanden wird, ist einer der sagt: Ich setze mich im politischen Prozess, im Parlament, in all diesen politischen Auseinandersetzungen ein, damit die Stimme des Volkes, die Interessen der einfachen Bevölkerung Berücksichtigung finden. Ich schaue, dass die Wallstreet nicht zu viel Einfluss hat.
Der Unterschied zwischen "populär" und "populistisch"
Der Populist sagt: Ich streiche diese ganze Vermittlung und diese ganzen Apparate, das Parlament, all das streiche ich durch und versuche, ein Regime zu etablieren, was die Macht direkt, eben angeblich direkt dem Volk zurückgibt. Ich bin einfach selbst der Vertreter dieses Volkes. – Also, dieses Zurückziehen auf den populistischen Führer, der im Namen des Volkes dann gegen alle Apparate und Eliten vorgeht. Das ist der Unterschied zwischen einer populären Politik, die populäre Forderungen vertritt, und einer populistischen Politik.
Deutschlandfunk Kultur: Populistische Politik heißt auch, dass in Deutschland in der AfD zum Beispiel die Parteien als Altparteien beschrieben werden, die anderen als neue Parteien, also, vor allem die populistischen. Und zum Beispiel, wenn man sich das Grundsatzprogramm, das Parteiprogramm der AfD anschaut, da heißt es ganz am Anfang: "Heimlicher Souverän" in Deutschland und Europa sei "eine kleine Macht von einer politischen Führungsgruppe innerhalb der Parteien, ein politisches Kartell, das die Schalthebel der staatlichen Macht, soweit diese nicht ohnehin an die EU übertragen worden ist, die gesamte politische Bildung und große Teile der Versorgung der Bevölkerung mit politischen Informationen in den Händen hat".
Das klingt ein bisschen nach Verschwörungstheorie, aber zeigt eben, glaube ich, auch eine Kritik an der parlamentarischen repräsentativen Demokratie.
Philipp Sarasin: Ja, absolut, natürlich. Und es gibt das immer wieder auch. Es gibt von links und von rechts immer wieder dieses Verzweifeln an den Kompliziertheiten des politischen Betriebs. Ich meine, schauen Sie sich Rudi Dutschke an, 1967 und die ganzen Reden der außerparlamentarischen Opposition. Die Rhetorik war sehr, sehr, sehr ähnlich wie jetzt diejenige von rechts. Es ist immer wieder dieselbe. Man kann sie auch verstehen. Der politische Betrieb ist kompliziert. Die Apparate sind groß. Die Eliten sind aus verschiedenen Gründen zum Teil weit weg von den einfachen Leuten. – Das ist alles wahr.

Volk gegen Staat - auf einer Berliner Demonstration im Jahr 1968. Die damalige Rhetorik ähnelte in vielem der heutigen der Populisten.© dpa / picture alliance / Klaus Rose
Aber wir haben, glaube ich, kein besseres System als dieses parlamentarische Vermittlungssystem, so kompliziert es ist. Und wir haben auch deshalb kein besseres System, weil – ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt – der Volksbegriff immer suggeriert: es gibt ein einheitliches Interesse dieses Volkes im Singular.
De facto aber sind wir in einer Gesellschaft mit unterschiedlichen, vielleicht konträren Interessen. Und wir können nicht sagen, die seien illegitim. Die sind alle legitim, diese Interessen. Und wir suchen ja ein politisches System, das den Ausgleich, das Aushandeln, das mit Beteiligen von verschiedenen Gruppen, Klassen ermöglicht, so dass man sagen kann: Diese Gesellschaft und dieser Staat, das ist ein Raum, in dem möglichst viele anständig leben können.
Der Volksbegriff des Populismus aber sagt: Es gibt ein einheitliches Interesse des Volkes. – Und das ist ideologisch.
Zweifel am Begriff "Post-Demokratie"
Deutschlandfunk Kultur: Sie haben eben gesagt, dass es eben eine Frage der Komplexität von modernen Demokratien ist, dass es nicht einfach geht und dass die direkte Demokratie auch nicht so einfach möglich ist und der Volkswille auch nicht so einfach artikuliert werden kann. Aber ich wollte mit dem Krisenphänomen der Demokratie eben auch noch auf etwas anderes hinaus:
Die Demokratie wird ja heutzutage, also die repräsentative Demokratie, von allen Seiten kritisiert als "Post-Demokratie", so hat der Politikwissenschaftler Colin Crouch das genannt, in der vor allen Dingen Lobbygruppen und Medien Politik letztendlich machen und gar nicht mehr die Parlamente.
Wolfgang Streeck, ein Kritiker in Deutschland, sagt, es sei nur noch eine Fassadendemokratie. Chantal Mouffe, eine Politikwissenschaftlerin aus Belgien, sagt, Politik sei eine Maschine zur Produktion von Konsensen geworden, die die eigentlichen widerstreitenden Interessen nur noch überdeckt.
Und wenn man dann die Gegenbewegung sieht, Marc Jongen, Chef-Ideologe der AfD, sagt: Wir sind die Lobby des Volkes gegen die Lobby der Wirtschaft, gegen die Lobby der Politik – usw. usw.
Das heißt also, da scheint doch eine tiefgreifende Skepsis gegenüber unserer Form von Demokratie zu herrschen in ihrer gegenwärtigen Ausprägung.
Philipp Sarasin: Ja, und sicher nicht ohne Grund. Das ist ganz klar. Ich meine, wenn ich Amerika anschaue, die Medien, habe ich das Gefühl, die beiden Parteien sind riesige Apparate. Der Politikbetrieb ist unglaublich stark von Inszenierungen geprägt, wahnsinnig stark von Medien abhängig. – Das ist alles richtig.

Protest gegen Trumps Politik - für Sarasin ein Ausdruck der Lebendigkeit demokratischer Kultur.© dpa / picture alliance / Poblo Martinez Monsivais
Aber andererseits, wenn man jetzt schaut in Amerika, es gibt eine unglaublich starke aktive Bevölkerung, die sich politisch äußert, die Einfluss nimmt über Social Media oder über große Protestmärsche. Also, ich bin da nicht so skeptisch. Ich glaube tatsächlich, dass es in offenen Gesellschaften, ich würde jetzt den alten Westen immer noch als offene Gesellschaften beschreiben, viele Kanäle gibt, um die verschiedenen Willen und Plural von Bevölkerungen, von Teilen der Bevölkerung zum Ausdruck zu bringen.
Das ist mir schon klar. Das große Geld hat einen riesigen Einfluss auf demokratische Prozess und politische Prozesse. Aber schauen Sie sich in Frankreich an, der Zusammenbruch der traditionellen Parteien dieser fünften Republik, diese Parteien sind abgewirtschaftet. Aber es gab eine Wahl, in der ein Spektrum von Möglichkeiten zur Auswahl stand. Und dieses Land hat sich auf Macron geeinigt in einem zweistufigen Verfahren, das ich – bei allem, was man kritisieren kann – aber doch als demokratische Aushandlung bezeichnen wurde, in der sich ein Land wie Frankreich dann doch einigt. – Wir versuchen jetzt mit Macron unsere Werte zu verteidigen.
Ich habe nicht die Vorstellung, dass wir längst schon in einem postdemokratischen Zeitalter leben. Ich glaube, das ist eine ideologische Figur, die auch von der Linken immer wieder vorgebracht wird. Die Linke hat schon immer wieder gesagt: Na ja, diese demokratischen Institutionen, der ganze Rechtsstaat, das ist ja nur Fassade, um die Kapitalinteressen zu verbergen.
Ich glaube, das ist einfach nicht wahr.
Deutschlandfunk Kultur: Das wird sich noch zeigen. Gerade in Frankreich…
Philipp Sarasin: Ja, das wird sich zeigen, aber ich bin auch überzeugt, es ist ein Spiel mit dem Feuer, wenn man sagt, dieser Rechtsstaat und die demokratischen Formen, die wir haben, sind nur Fassade. Was ist denn die Alternative? Vielleicht braucht man auch Formen, Fassaden, um die offene autoritäre Herrschaft von wem auch immer zu vermeiden.
Deutschlandfunk Kultur: Ich würde Ihnen da voll zustimmen. Ich glaube auch, dass es die Zivilgesellschaft braucht und gibt und dass die gerade in den USA sich jetzt besonders zeigt. Und sie ist auch besonders herausgefordert, wie übrigens auch die Medien wie die Washington Post und die New York Times.
Philipp Sarasin: Absolut.
Der Populismusbegriff wird entstigmatisiert
Deutschlandfunk Kultur: Das ist einfach ein starkes Gegengewicht zu dem, was wir da auch eben wahrnehmen.
Ich wollte aber noch beim Populismusbegriff bleiben und eine – sagen wir – Diagnose scheint sich mir aufzudrängen, nämlich dass der Populismusbegriff ja im Grunde genommen einer ist, der im politischen Kampf verwendet wird. – Populisten, das sind die Bösen, die groben Vereinfacher usw., die Demagogen.
Zugleich findet aber im Augenblick so etwas statt wie eine Entstigmatisierung dieses Populismusbegriffs, weil zum Beispiel Heribert Prantl in einem Buch, in einem kleinen Essay sagt: Jeder demokratische Politiker sei doch eigentlich ein Populist. Und Gauland von der AfD wendet dann das Negative ins Positive und sagt: Wir sind eine populistische Partei und ich bin stolz darauf, Populist zu sein.

Stolzer Populist: Alexander Gauland (AfD) © dpa/picture alliance / Ralf Hirschberger
Geht es da auch um einen Kampf um die Deutungshoheit über die Stimme des Volkes?
Philipp Sarasin: Ja, zweifellos, wobei, ich möchte wirklich drauf beharren, es gibt einen Unterschied zwischen populistischer Politik und populärer Politik oder populären politischen Forderungen, Forderungen, die auf die Interessen mutmaßlich einer großen Mehrheit von Bevölkerung zielen.
Zum Beispiel wäre es eine populäre Forderung, in Amerika zu sagen: Wir haben eine Krankenversicherung – Obama-Care eingeführt. Das ist nicht populistisch. Das ist populär. Da kann man auch Umfragen herbeiziehen. Die Leute wollen das.
Populistisch wird’s erst dann, wenn wir sagen: Und wir setzen es durch in der Umgehung vom demokratischen Verfahren. Ich beharre drauf: Demokratie in einem nicht populistischen Sinn heißt: Ja, die Dinge sind kompliziert. Wir haben Apparate und wir können ohne diese Apparate und ohne diese rechtsstaatlichen Strukturen diese Gesellschaft nicht in einer vernünftigen Art und Weise führen und organisieren.
Aggressive Vereinheitlichung
Deutschlandfunk Kultur: Schauen wir nochmal auf die von Ihnen schon angesprochene, sagen wir, autoritäre Logik des Populismus. Und da wird es ja dann doch auch vielleicht für eine demokratische Gesellschaft bedrohlich, wenn der Führer sich sozusagen das Mandat einfach nimmt. Also, der Politikwissenschaftler Jan-Werner Müller spricht da von einem "imperativen Mandat", also sozusagen eine moralisch aufgeladene Haltung, die sagt: Nur ich kann das Volk repräsentieren.
Philipp Sarasin: I alone.
Deutschlandfunk Kultur: Genau – I alone. Die Populisten sagen nicht, wir sind das Volk, sondern die sagen: Nur wir können das Volk repräsentieren.
Philipp Sarasin: Ja. Richtig.
Deutschlandfunk Kultur: Was folgt daraus im Hinblick auf diese autoritäre Logik? Welche Rolle nimmt diese Führerfigur ein? Ist er die klassische Figur aus der Antike, die sich nennt "Volkstribun"?

Vorbild Volkstribun? Hier ein Bronzestandbild von Volkstribun Cola di Rienzo in Rom© imago/image broker
Philipp Sarasin: Ich meine, autoritär wird das – ich glaube – aus zwei Gründen, weil man einerseits, wie ich schon sagte, dieses Volk homogenisiert, dass man die Differenzen innerhalb dieses Volkes mit diesem Begriff zudeckt und sagt: Das Volk hat insgesamt gemeinsame Interessen. Bei Ernesto Laclau und Chantal Mouffe ist das ein großer Antagonismus, der dieses Volk einigt gegen zum Beispiel die Eliten.
Deutschlandfunk Kultur: Das ist der linke Populismus.
Philipp Sarasin: Da ist es der linke Populismus. Das sagt aber auch Trump. Das ist natürlich eine genuin populistische Denkfigur zu sagen: Das Volk einheitlich hat letztlich einheitliche Interessen.
Auf der anderen Seite gegen außen: Dieser Volksbegriff ruht auf Homogenisierungsvorstellungen kultureller, ethnischer Art bis hin zu rassischer, rassistischer Art seit dem 18. Jahrhundert.
Das heißt, vom Volk reden in diesem populistischen Sinn bedeutet auch immer eine starke Demarkation, eine Abgrenzung gegen außen. Das wird uns heute in den Medien dauernd vorgeführt, die Auseinandersetzung um die Flüchtlinge. Also: Abgrenzung gegen außen. Und das kann bis hin zu einem aggressiven politischen Handeln und aggressiven Militarismus gehen, wie man das bei Trump schon beobachten kann. Also, der Militarismus ist da natürlich eine Möglichkeit, diese Einheit des Volkes auch herzustellen.
Deutschlandfunk Kultur: Ist das ein genuines Merkmal des Populismus Ihrer Meinung nach? Oder ist das nicht, ich sage, eine besondere schändliche Ausprägung der Politik von Donald Trump?
Philipp Sarasin: Nein, ich glaube, das ist genuin. Auch im 19. Jahrhundert, die Herstellung von Nationen, schon nur als sprachlicher Art, war ein aggressiver Akt, zum Beispiel gegen Dialekte oder Regionalsprachen. Also, Einheit herstellen in einer komplexen vielfältigen Situation, in der Bevölkerungen auf einem Gebiet leben, diese Einheit herstellen ist ein aggressiver Akt.
Einbezug der Bevölkerung im parlamentarischen Rahmen
Deutschlandfunk Kultur: Da macht sich jetzt aber doch, sagen wir, ein Widerspruch kenntlich. Auf der einen Seite, Sie haben es vorhin den "legitimen Kern des Populismus" genannt. Also, man könnte sagen, die Graswurzelbewegung der Demokratie. Mainstreet gegen Wallstreet, das ist ein Schlagwort aus den USA, also, vielleicht auch mit der Idee der Volkssouveränität, mit der Idee der direkten Demokratie, Volksabstimmungen. - Die AfD hat auch in ihrem Parteiprogramm die Forderung, viel mehr Volksabstimmungen durchzuführen.
Und auf der anderen Seite sagen Sie: Durch die inhärente Figur der Abgrenzung neigt der Populist zum starken autoritären Führungsstil, zu Militarismus und im schlimmsten Falle sogar zur Diktatur. Das beißt sich doch eigentlich.

"Weiß Gott alle drei Monate eine Volksabstimmung" - Aufruf zur Stimmabgabe in der Schweiz© FABRICE COFFRINI / AFP
Philipp Sarasin: Nein, ich meine, wir haben in der Schweiz ja weiß Gott alle drei Monate eine Volksabstimmung über X Sachthemen. Das ist ein etabliertes System, manchmal mit problematischen Effekten, manchmal eigentlich ist es ganz harmlos. Man stimmt im Grunde darüber ab, wo jetzt die Turnhalle gebaut werden soll – links oder rechts – und wie viel sie kosten soll. In der Schweiz, die so klein ist, kann man quasi die Bevölkerung, die stimmberechtigte Bevölkerung an solchen Entscheidungen mit beteiligen. Das bedeutet aber immer, es ist ein Entscheidungsrahmen eines dann doch auch von Parlamenten und der Verwaltung mitgestalteten politischen Prozesses. Das ist entscheidend.
Und auch, wenn Sie "Mainstreet versus Wallstreet" ansprechen, selbstverständlich gibt es breite Interessen und gibt es populäre Forderungen und gibt es Bedürfnisse breiter Bevölkerungskreise, die jetzt nicht so reich sind wie die Wallstreet. Und die zu artikulieren kann dann scheinbar populistisch sein. Das ist aber kein Populismus. Sonst wäre die Linke in ihrem Einstehen für die lohnabhängige Bevölkerung immer schon populistisch gewesen. Das stimmt so nicht.
Sie ist nur dann populistisch, wenn sie sagt: Wir nehmen uns die Macht oder möchten uns die Macht so nehmen, dass es keine Parlamente und keine Gerichte und keine unabhängigen Instanzen mehr braucht.
Kampf gegen die Experten
Deutschlandfunk Kultur: Na ja, wenn man nach Europa schaut und in Ungarn mal schaut oder in Polen schaut, wo tatsächlich zum Beispiel die Freiheit der Wissenschaft bedroht ist oder die Verfassungsgerichtsbarkeit in Polen einfach eingeschränkt wird, hat dann das für die Demokratie bedrohliche Figuren angenommen.
Philipp Sarasin: Genau. Oder der Kampf gegen Experten: Also, diese Auseinandersetzung um den Klimawandel, wo einfach von der populistischen Rechten gesagt wird, ja, das sind einfach Eierköpfe, das sind die Experten, die streiten sich untereinander sowieso. Denen müssen wir gar nicht glauben. Wir streichen das einfach durch. Wir referieren nicht mehr und beziehen uns nicht mehr auf Wissenschaft und Experten. – Das ist verheerend.

10 bis 15 Prozent populistisches Potenzial in Europa? In manchen europäischen Ländern richten sich Populisten ein - hier Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orbán.© picture-alliance / dpa / Alexey Vitvitsky
Deutschlandfunk Kultur: Glaubt man der Empirie, weil Sie eben gerade die Experten angesprochen haben, empirische Politikwissenschaftler gehen davon aus, also, zum Beispiel wie Pippa Noris und Ronald Engelhart, gehen davon aus, dass es in Europa ein beständiges Potenzial von zehn bis 15 Prozent für populistische Bewegungen gibt. In der nächsten Woche, am nächsten Wochenende beginnen die Parlamentswahlen in Frankreich. Und, Sie haben das eben schon angesprochen, da war man froh, dass Macron gewählt worden ist, aber wenn man sich da die Lage genauer anschaut, dann sind es ja vierzig Prozent der Wähler, die im ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen populistische Kandidaten gewählt haben, nämlich Marine Le Pen auf der einen Seite und Mélenchon auf der anderen Seite. Da ist doch mehr als ein Zehnprozent- bis 15-Prozent-Potential für populistische Parteien.
Da muss man sich dann vielleicht doch Sorge um die Demokratie machen, wenn man das, was Sie gesagt haben, nämlich autoritäre Strukturen, in Anschlag bringt. – Muss man sich um die Grande Nation sorgen?
Populistische Parolen können an Attraktivität rasch verlieren
Philipp Sarasin: Ich sorge mich jetzt gerade noch nicht. Ich glaube, die politische Mehrheit in Frankreich, die sich neu konfiguriert, aber insgesamt: Die Mehrheit steht hinter dieser Demokratie. Ich glaube, diese Dinge sind auch recht volatil. Das sieht man ja auch in den USA, wo jetzt eben die Unterstützung für Trump am Sinken ist, obwohl er knapp Präsident geworden ist, Popular Votes zwar verloren, aber bekanntlich das Electoral College gewonnen. Populistische Parolen in unserer Social Media vermittelten politischen Welt haben wahrscheinlich schnelle große Ausschläge, können aber auch wieder zurückgehen, können an Attraktivität verlieren. Die Leute sehen plötzlich: Trump macht Politik, die eigentlich gegen unsere Interessen ist. Das kann sehr schnell umschlagen.
Ich würde daran zweifeln, dass jetzt in den USA oder in Europa sich langfristig und dauerhaft und stabil eine Mehrheit ausbilden würde, die eigentlich von einer autoritären Regierung träumt. Das glaube ich nicht, dass das der Fall sein wird.
In Ungarn oder in Polen kenne ich die Situation zu wenig gut. Dort scheint es in diese Richtung zu gehen. Aber es ist auch noch nicht ausgemacht, ob diese Tendenzen sich dann langfristig wirklich durchsetzen.
Deutschlandfunk Kultur: Sie haben in unserem Gespräch immer wieder auf der Unterscheidung zwischen populistischer Politik und populärer Politik beharrt. – Könnte man sagen, dass jetzt eine jüngere Politikergeneration aus den populistischen Bewegungen gelernt hat. Ich denke an Sebastian Kurz in Österreich oder an Emmanuel Macron in Frankreich, die ja tatsächlich versuchen, so etwas zu suggerieren, obwohl sie total aus dem Establishment und aus dem politischen System heraus geboren worden sind, aber doch so was versuchen wie eine Volksbewegung hinzubekommen.
"République en Marche!" zum Beispiel, es soll ja mehr oder weniger nicht nur eine Partei sein, sondern eben auch eine Volksbewegung.

Hoffnungsträger Emmanuel Macron - doch auch er nutzt rhetorische Strategien des Populismus.© imago stock&people / Gesa Wicke
Philipp Sarasin: Ja. Ich meine Macron braucht einfach eine parlamentarische Mehrheit. Das ist völlig klar. Er brauchte zuerst mal einen Apparat und eine gewisse Basis, um überhaupt die Wahl zu gewinnen.
Selbstverständlich gibt es in der Moderne, im politischen System der Moderne auch immer wieder die Vorstellung: Wir müssen eine politische Basis bilden, die quasi Bewegungscharakter hat. Das kann auch sehr schlimm sein. Der Nationalsozialismus hat sich bekanntlich als Bewegung verstanden und wollte sich eben nicht verfestigen zu einer Partei, in diesem parlamentarischen System, das der NS verachtet hat, eben wieder feststecken. – Die Betonung der Bewegung.
Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass – wenn Macron sagt, die neue Partei ist "En Marche!" – das ein Zeichen dafür ist, dass Macron eigentlich ein Populist ist, überhaupt nicht. Er braucht einfach eine parlamentarische Mehrheit, muss eine Partei gründen.
Deutschlandfunk Kultur: Herzlichen Dank, Herr Sarasin, für das Gespräch.
Philipp Sarasin: Dankeschön.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandfunk Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.






