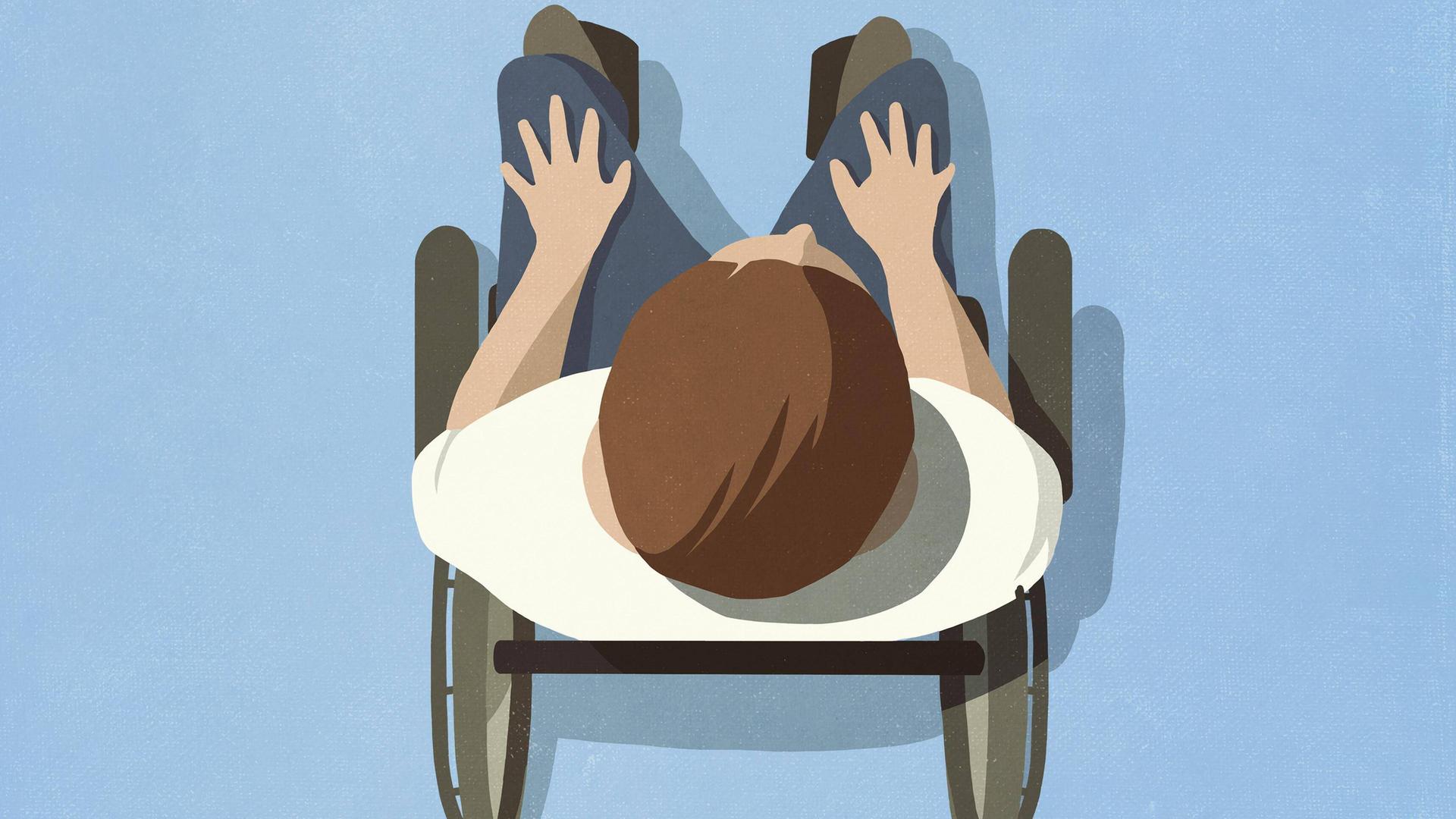Verena erblickt vor 34 Jahren das Licht der Welt. Das Glück der kleinen Familie scheint perfekt.
Früher sind Kinder mit Behinderung oder schweren Erkrankungen oft vor dem 18. Geburtstag verstorben. Dank des medizinischen Fortschritts hat sich das geändert. Doch der 18. Geburtstag bedeutet den Abschied von vertrauten Kinderärzt:innen. In Deutschland sind bis zu 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen mit sogenanntem "speziellen Versorgungsbedarf" betroffen.
„Verena, Du auch ein bissel? Das nennt sich saftiger Kaba-Kuchen. Ich habe gestern meinen Mann gefragt, was möchtest du für´n Kuchen? Und er: Schokoladenkuchen. Brauchen sie Zucker?“
Besuch bei Familie Wick im fränkischen Pettensiedel, einem kleinen Dorf in der Nähe von Nürnberg. Andrea Wick schneidet selbstgebackenen Kuchen auf, legt dicke Stücke auf die Teller, ehe sie in der Küche frischen Kaffee holt. Ihr Mann Ottmar packt währenddessen den Rucksack von Tochter Verena aus. Sie ist gerade nach Hause gekommen; aus ihrer Wohngruppe, wo sie die Woche über betreut wird.
„Hier hat es das Hausaufgabenheft. Mathe fünf minus, deutsch sechs plus, okay… Nein, Quatsch. Da steht eigentlich bloß drin, was sonst gewesen ist die letzten Tage. Oh ja, das ist gut. Verena, du bist gut.“
Ottmar Wick, ein Mann, dem der Schalk im Nacken sitzt, freut sich. Nicht über einen Witz, nein. Verena hat heute schon genug getrunken, steht in dem kleinen Begleitheft, das der Vater nun zurück in den Rucksack steckt. Trinken, sagt Mutter Andrea, dauert bei ihrer Tochter lange, sehr lange. Für ein Glas Wasser braucht die 34-Jährige manchmal bis zu einer Stunde.
„Die Verena wird zeitlebens immer im Kleinkindalter bleiben. Wir versorgen die Verena wie einen Säugling: Wir füttern sie, wir geben ihr mit der Flasche zu trinken, wir wickeln sie – also wir müssen ja alles für sie tun.“
„Verena ist als gesundes Mädchen zur Welt gekommen und wir haben dann eigentlich kurz nach der Entbindung schon gemerkt, dass irgendetwas mit ihr nicht stimmt. Verena hat zunehmend schriller geschrien.“
Erkrankung während der Schwangerschaft
Unerkannt war Mutter Andrea an Toxoplasmose erkrankt: eine durch Parasiten ausgelöste Infektion. Diese Parasiten können unbemerkt auf das Ungeborene übergehen und zu schweren Missbildungen und Schäden am Zentralnervensystem führen.
„Die Verena hat einen ziemlichen Hirnschaden erlitten und auch im Augenhintergrund haben diese Toxoplasmen ihr Unwesen getrieben.“
Im Alter von neun Monaten entwickelte sich bei der mehrfach behinderten, blinden Verena noch ein Anfallsleiden, eine spezielle Form der Epilepsie.
Seit diesem ersten Anfall wurde Verena in der Kinderklinik Fürth von Spezialist:innen für Anfallsleiden behandelt, unter anderen vom Kinderneuropädiater Friedrich Bosch.
„Ich behandle hauptsächlich Epilepsiepatienten, die meistens auch eine schwere Entwicklungsstörung haben, nicht alle, aber ein Teil davon.“
„Verena hat eine so massive Hirnschädigung, dass wir eigentlich ein buntes Bild an Anfällen sehen und wir werden es eigentlich nie richtig in den Griff kriegen“, ergänzt Andrea Wick.
Verena, hier mit Mutter Andrea Wick, reagiert vor allem auf psychischer Ebene auf Veränderungen. © Deutschlandradio / Dorothea Brummerloh
Mithilfe von Medikamenten lassen sich Verenas Anfälle einigermaßen behandeln. Ändert sich das Wetter oder wechseln die Jahreszeiten, treten die Anfälle häufiger und viel, viel stärker auf, erzählt Andrea Wick. In solchen Notsituationen riefen sie bis zu Verenas Volljährigkeit bei Friedrich Bosch an.
Wenn er die Situation nicht am Telefon klären konnte, fuhr Familie Wick mit ihrer Tochter in die Klinik. Dort leitete Dr. Bosch ein EEG ab – eine Elektroenzephalografie –, gab entsprechend Medikamente. Die Regeln des deutschen Gesundheitssystems veränderten den vertrauensvollen Umgang per Gesetz.
„Man hat einen Weg gefunden und es passt alles. Dem Kind geht es gut, und dann heißt es auf einmal, so, Kind ist jetzt 18, und Kinderarzt ist eigentlich nicht mehr zuständig. Und dann hängt man da etwas in der Luft, weil man ja doch eine Beziehung zu dem Arzt aufgebaut hat“, sagt Andrea Wick.
Kinderneuropädiater Bosch durfte Verena, die er bis zur Volljährigkeit behandelt hatte, nicht weiter betreuen.
„18 Jahre ist das Ende der somatischen Entwicklung und bis dahin darf der Kinderarzt behandeln, aber danach nicht mehr.“
Ein Wechsel ist vorgeschrieben
So steht es in der Weiterbildungsordnung, die die Fachgebietsgrenzen für Ärzt:innen gesetzlich regelt. Junge Erwachsene, egal, ob sie auf dem Niveau eines Kleinstkindes sind oder nicht, müssen in die Erwachsenenmedizin wechseln.
Dieser Wechsel steht für alle Jugendlichen kurz vor oder nach dem Erreichen der Volljährigkeit an und ist für die meisten kein Problem. Mindestens 14 Prozent von Ihnen, also zwei Millionen betroffene Kinder und Jugendliche, haben aber einen „speziellen Versorgungsbedarf“. So nennt es der Kinder- und Jugendgesundheitssurvey des Robert-Koch-Instituts, kurz: KiGGS.
„Transition in der Medizin bedeutet, dass wir Kinder und Jugendliche, die krank sind und medizinische Unterstützung brauchen, dass wir die in die Erwachsenenmedizin übernehmen“, sagt Britta Siegmund, die Gastroenterologin an der Berliner Charité ist.
Und das klingt erst mal so ganz einfach. Aber dieser Übergang ist auf vielen Ebenen schwieriger, als man vermuten möchte.
Britta Siegmund
Unter Britta Siegmunds Leitung haben die Deutschen Gesellschaften für Innere Medizin und für Kinder- und Jugendmedizin eine „Task Force Transition“ ins Leben gerufen. Hier erarbeiten Kinder- und Jugendärzte und Erwachsenenmediziner fachübergreifende und einheitliche Transitionskonzepte. Denn die Probleme können schon im Wartezimmer beginnen; in einer Kinderarztpraxis freundlich und hell, mit Bildern und Spielzeug ausgestattet...
„Wenn man dann in die Erwachsenenmedizin kommt, ist meistens alles sehr viel kühler, steriler und das ist etwas, was schon sehr viel ausmacht für Kinder und Jugendliche. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, die Erwachsenenmedizin ist häufig in sehr kurzen Takten durchorganisiert, die diesen Bedarf meistens nicht leisten kann.“
Was die Kinder- und Jugendmedizin ausmacht
Die Kinder- und Jugendmedizin ist einer der wenigen Bereiche der Medizin, der wirklich ganzheitlich vorgeht oder den Anspruch hat, ganzheitlich vorzugehen.
Berthold Koletzko ist Kinder- und Jugendmediziner am Dr. von Haunerschen Kinderspital der Ludwig-Maximilians-Universität München und spezialisiert auf Stoffwechselerkrankungen.
„Das heißt, wenn ein Kind kommt mit einer Darmerkrankung, mit einer Nierenerkrankung, dann behandeln wir nicht den Darm und die Niere, sondern behandeln das Kind mit seinen sozialen Bezügen. Wir denken an die Schule, an die Ausbildung und an die Interaktion mit den Gleichaltrigen. Und wir laufen auch den Patienten hinterher. Wenn der Patient nicht kommt, dann rufen wir die Familie an und sagen, was ist los? Wie schicken Sozialarbeiter raus, und in der Erwachsenenmedizin liegt die Verantwortung beim Patienten.“
Außerdem gibt es Erkrankungen, mit denen Menschen früher gar nicht bis zum Erwachsenenalter überlebt haben. Dank medizinischen Fortschritts hat sich das geändert, sagt Gundula Ernst, Vorsitzende der Gesellschaft für Transitionsmedizin.
„Dazu gehören viele seltene Stoffwechselerkrankungen, wo die Lebenserwartung leider heute auch noch sehr limitiert ist. Aber dazu gehören auch angeborene Herzfehler beispielsweise. Oder Mukoviszidose, wo sich in der Erwachsenenmedizin gar kein Versorgungssystem etablieren konnte und die Spezialisten gefehlt haben und teilweise eben auch noch weiterhin fehlen.“
Die schwierige Suche nach Spezialisten
Viele dieser Schwer- oder Chronisch- oder Mehrfacherkrankten werden mit guter Lebensqualität erwachsen. Doch die Arztsuche, die Suche nach einem Spezialisten, der ihre speziellen Krankheitsbilder adäquat versorgen kann, ist schwierig, weiß Ute Thyen, Neuropädiaterin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Lübeck. In Großstädten habe man weniger Probleme, weil die Kinder in Spezialambulanzen der Krankenhäuser oder Universitätskliniken betreut werden.
„Und da gibt es wahrscheinlich schon Übergangssprechstunden. Wenn die Familie in kleineren Orten oder in ländlichen Gebieten wohnt, dann sind noch weite Fahrwege in Kauf zu nehmen. Denn die Angebote für chronisch Kranke, vor allen Dingen behinderte junge Erwachsene, sind überhaupt nicht so weit gestreut“, sagt Ute Thyen.
Und uns muss klar sein, das sind eben keine Patienten, die sich selbst in ihr Auto setzen und dahin fahren. Sondern das sind Patienten, die häufig schwer beeinträchtigt sind, selbst keinesfalls Autofahren können und das heißt, es muss irgendjemand mit ihnen dorthin fahren.
Gundula Ernst
Diese zusätzlichen Belastungen können bei Erkrankungen, die engmaschig betreut werden müssen, Probleme bereiten; etwa, wenn es darum geht, die medikamentöse Therapie anzupassen. Britta Siegmund betreut als Gastroenterologin junge Erwachsene mit Morbus Crohn, aber auch Patient:innen nach Transplantationen.
„Wenn die eine Lücke haben zwischen 16 und 20, wo sie dann keinen Arzt haben, keine Ärztin haben, der sie versorgt, kann das erhebliche Langzeitschäden verursachen, bei den Transplantierten sogar zu einer früheren Re-Transplantation von Organen führen.“
Was sich mit der Volljährigkeit ändert
Bei allen Risiken – der Wechsel in die Erwachsenenmedizin ist dennoch sinnvoll, sagt die Ärztin und befürwortet ihn. Es müssen erwachsenenspezifische Themen mitversorgt werden, für die der Kinderarzt nicht ausgebildet ist. Hinzukommt, dass sich auch Eltern daran gewöhnen müssen, dass nicht mehr für ihre „Kinder“ zu sprechen, sie einige Dinge auch nichts angehen.
Dazu gehören natürlich Sexualität, Verhütung, Risikoverhalten, wo aber die Jugendlichen merken, sie dürfen solche Fragen stellen und die unter Umständen ziemlich wichtig sind bei so einer Erkrankung.
Britta Siegmund
Transition sei nicht nur der Wechsel in die Erwachsenensprechstunde, sagt Ute Thyen, Neuropädiaterin und Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin.
„Die Jugend ist eine Entwicklungsphase, wo viele Transitionen anstehen: Erste Partnerschaften, Liebesbeziehungen, die Peergruppe, der Freundeskreis wird deutlich wichtiger als das Elternhaus, und die Jugendlichen müssen sich davon ablösen. Und das ist natürlich, wenn gleichzeitig eine Erkrankung besteht, sehr viel schwieriger – einerseits für die Eltern loszulassen und andererseits für die Jugendlichen selbst, ihr risikobereites Verhalten mit dem Management einer chronischen Erkrankung übereinzubringen.“
Deswegen ist ein geplanter, organisierter Übergang der jungen Patient:innen in die nächste medizinische Instanz extrem wichtig, um das in der Pädiatrie Erreichte nicht zu gefährden.
Der Einrichtungswechsel war für Leon schwer
Auf dem Weg zu Familie Emrich in Schwaig bei Nürnberg. Mutter Anita und Sohn Leon leben – nachdem die ältere Tochter ausgezogen ist – im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses.
Nach der Begrüßung bittet Anita Emrich herein, führt ins Wohnzimmer, wo ihr Sohn Leon schon wartet. Rollstuhl, Gehwagen, Pflegeutensilien und Hilfsmittel füllen einen großen Teil des Zimmers aus. Bei der Geburt hat der heute 19-Jährige zu wenig Sauerstoff bekommen, ist seitdem schwerst körperlich und geistig behindert, fast blind, leidet an Epilepsie. Mit 18 standen für den jungen Mann, der sich nur mit Mimik, unterschiedlichen Lauten und Hustengeräuschen ausdrücken kann, die altersbedingten Wechsel an.
„Leon, wie hast du das verkraftet … Er schimpft … Ja, wir sind immer noch am verkraften.“
Leon ging bis zum 18. Lebensjahr in eine Tagesstätte für schwerstbehinderte Kinder, erzählt seine alleinerziehende Mutter. Mit der Volljährigkeit endete die Betreuung in der Einrichtung.
„Und jetzt komplett neue Einrichtung, komplett neuer Betreuer, die ihn nicht kennen und auch nicht die Chance mir gegeben wird, dass ich mal vorbeikomme, um meinen Sohn zu dolmetschen, also zu erklären, wie er was und wann meint. Keine Therapien mehr, also nicht mehr so wie vorher. Zweimal in der Woche Krankengymnastik zu Hause und einmal in der Woche Ergo in der Einrichtung, aber Logopädie auch keine mehr, und das ist alles schwierig.“
Die neue Erwachsenenförderstätte hat ein anderes Hebesystem als die Emrichs, weshalb Leon nicht mehr zwischen Rollstuhl und Gehwagen wechseln kann. Wie früher selbstständig hin- und herrollern ist nun nicht mehr möglich. Leidtragender ist Leon, der sich dazu nicht äußern kann.
Mutter Anita bekommt Arbeitslosengeld 2 und deshalb auch Wohngeld. Seit Leon volljährig ist, wird die Bedarfsgemeinschaft der beiden anders berechnet. Die Miete für die behindertengerechte Wohnung ist 200 Euro zu hoch. Auch mit der Krankenkasse kämpft Anita Emrich: Leons Windeln sind jetzt zu teuer. Es gibt dafür eine geringere Pauschale.
Leon, hier mit seiner Mutter Anita Emrich, wäre wohl gerne in seiner alten Einrichtung geblieben.© Deutschlandradio / Dorothea Brummerloh
Diese Auseinandersetzungen machen mürbe, sagt sie. Auch an Leon sind die Turbulenzen im letzten Jahr nicht spurlos vorübergegangen: Seit er in die Erwachsenenförderstätte geht, hatte er mehrmals heftige epileptische Anfälle.
„Zu all den Widrigkeiten kam dazu, dass wir nicht mehr zu unserem Neurologen gehen konnten, wo wir eigentlich seit fast 20 Jahren sind, und wo wir uns auch in guten Händen uns gefühlt haben. Ja, das sagt Leon auch… und der immer für einen da war.“
Leons Kinderärztin hat bei der Krankenkasse beantragt, den 19-Jährigen noch bis zum 24. Lebensjahr in ihrer Praxis weiter zu betreuen. Dem wurde stattgegeben. Anita Emrich ging davon aus, dass auch Neuropädiater Friedrich Bosch Leons Epilepsie und Spastik weiterbehandeln darf an der Kinder- und Jugendklinik in Fürth. Doch in der Regel endet die pädiatrische Betreuung – je nach Kostenträger – hier zwischen dem 18. und 21. Lebensjahr. Friedrich Bosch wollte das für seine geistig behinderten Patienten ändern, zog für diese wenigen Ausnahmefälle vor das Münchner Landessozialgericht – und scheiterte.
„Es sind ja Patienten, die den Entwicklungsstand von einem Säugling oder Kleinkind behalten, ihr ganzes Leben lang auf diesem Stand bleiben oder geringfügig Fortschritte zeigen. Und die kriegen ja auch ihr Leben lang vom Staat Kindergeld und sind familienkrankenversichert, was eigentlich auch dafür spricht, dass sie weiterhin Kinder bleiben und dadurch eigentlich auch der Kinderarzt derjenige ist, der sie am besten versorgen kann. Von daher ist es nicht nachvollziehbar, warum das für diese speziellen Kinder nicht möglich ist.“
Die Lasten tragen die Eltern
Leidtragende solch bürokratischer Entscheidungen sind Mütter wie Anita Emrich, die sich verzweifelt um eine Weiterversorgung von Leon bemüht, der neben einem Neurologen auch einen Orthopäden, Venenarzt und Kardiologen braucht. Für jede Facharztpraxis braucht Leon einen extra Termin.
Patienten mit einer chronischen, körperlichen oder geistigen Krankheit oder einer Mehrfachbehinderung werden im Kindesalter meist in einem der rund 130 sozialpädiatrischen Zentren in Deutschland interdisziplinär und multiprofessionell betreut, erklärt Gundula Ernst, Vorsitzende der Gesellschaft für Transitionsmedizin.
Diese Zentren haben meistens nicht nur Ärzte verschiedener Fachdisziplinen, sondern auch Psychologen und Sozialarbeiter und können eben der Familie ein Gesamtpaket anbieten. Und das war ein ganz großes Problem, weil es nichts Vergleichbares für Erwachsene gab.
Gundula Ernst
Mit dem Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung wurde 2015 die Möglichkeit geschaffen, spezielle Behandlungszentren für Erwachsene mit Behinderung zu errichten: die MZEBs, die Medizinischen Behandlungszentren für Erwachsene mit geistiger oder schwerer Mehrfachbehinderung. Diese MZEBs sollen, in Analogie zu den sozialpädiatrischen Zentren, Menschen mit schwerer geistiger und mehrfacher Behinderung multidisziplinär und multiprofessionell versorgen, erklärt Ute Thyen, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin.
„Das, was wir in der Kinder- und Jugendmedizin haben, dass der Kinder- und Jugendarzt doch sehr ganzheitlich behandeln kann, ist beim Internisten, Chirurgen, Urologen, Orthopäden nicht so. Das heißt, diese MZEBs müssen für eine sehr starke interdisziplinäre Integration aller Fachdisziplinen sorgen, sehr viel mehr soziale Beratung machen. Das heißt, die Pauschalen sind nicht kostendeckend und das ist einer der Hauptgründe dafür, warum die nicht so häufig sind.“
Der Notfall kam schon nach einem Vierteljahr
Zurzeit gibt es mehr als 60 Medizinische Behandlungszentren für Erwachsene mit geistiger oder schwerer Mehrfachbehinderung. Im MZEB Rummelsberg im Nürnberger Land hat Andrea Wick ihre mehrfach behinderte, blinde Tochter Verena vorgestellt. Mit einer 34 Jahre umfassenden Krankenakte fuhren die Wicks dorthin. Trotzdem mussten sie unzählige Fragebögen ausfüllen, erzählt Andrea Wick.
„… über die Verena, über die Vorgeschichte, wie sie behandelt wird, wo sie ist, Krankengymnastik und was alles so läuft… und waren da den ganzen Tag dort. Wir hatten auch ein psychologisches Gespräch dort. Also warum ist mir immer noch nicht richtig klar… und dann Blutentnahme und dann kam ein Ergotherapeut, ein Krankengymnast… also es wurde das volle Programm gemacht. Hat eigentlich am Anfang auch einen guten Eindruck gemacht und am Schluss, kurz bevor wir gegangen sind, ist erst das EEG abgeleitet worden.“
Beim Kinderneurologen war das Elektro-Enzephalogramm immer die erste Untersuchung, um direkt auf Veränderungen zu reagieren. Die Wicks nahmen die neue Praxis hin, um künftig zuverlässig Hilfe und Unterstützung im Medizinischen Behandlungszentrum für Erwachsene zu erhalten; vor allem im Notfall. Schon ein Vierteljahr später war es soweit:
„Da hat die Verena auch wieder Anfälle ohne Ende gehabt und dann habe ich dort angerufen und habe gesagt, wir sind jetzt in Not. Wir bräuchten euch bitte. Und dann hat es geheißen, wir sind jetzt so überbelegt, wir können euch jetzt nicht aufnehmen. Ich kann Ihnen keinen Termin anbieten. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, warum heißt es denn dann, wir möchten dahin kommen und die Verena vorstellen, weil wenn dann ein Notfall ist, dann haben die alle Unterlagen, und sie kennen sie. So wurde uns das damals eben angeboten das Ganze. Und dann sind wir in Not, und dann heißt es: ja, geht in eine andere Klinik.“
Familie Wick rief den bisherigen Kinderneuropädiater Friedrich Bosch an. Der leitete ein EEG ab und veränderte Verenas Medikation.
„Was man bei einem schwerstbehinderten jungen Menschen nie, nie unterschätzen darf, ist die Psyche... Sie können jetzt nicht sagen, mir stinkt es jetzt und ich will das nicht. Das läuft alles auf der emotionalen Schiene ab und wenn man die Verena gut kennt, dann sieht man ihr auch an, dass es Situationen gibt, unter denen sie leidet und in denen es ihr nicht gut geht.“
Vertrauen aufzubauen, braucht lange
Familie Wick weiß, dass es nicht ewig so weiter gehen kann, denn auch ihr bisheriger Neuropädiater wird älter, wird bald in Rente gehen. Spätestens dann müssen sie einen neuen Versuch starten und hoffen, dass die Kooperation und Kommunikation aller Beteiligten besser klappt und die Transition dann gelingt. Darin bestärkt sie auch Friedrich Bosch.
„Wenn es äußere Rahmenbedingungen erforderlich machen, dass eine Transition notwendig ist, dann ist es notwendig. Dann muss es halt irgendwie passieren. Aber man muss den Eltern nicht die Pistole auf die Brust setzen zu einem Zeitpunkt, wo sie einfach nicht in der Lage sind oder nicht Möglichkeit sehen, die Weiterbehandlung woanders fortzuführen. Und das braucht zum einen Zeit und das sollte nicht mit dem 18. Lebensjahr festgelegt sein.“
Gundula Ernst rät Betroffenen, neuen Ärztinnen und Ärzten eine Chance zu geben. Dass zu Beginn nicht alle Informationen vorliegen, man sich nicht so gut aufgehoben fühlt, sei normal. Ein Vertrauensverhältnis baue sich langsam auf. Die Vorsitzende der Gesellschaft für Transitionsmedizin plädiert aber auch für individuelle Regelungen im Sinne der jungen Patient:innen. Dass Kinderärzte in Ausnahmefällen über das 18. Lebensjahr hinaus betreuen dürfen, findet die Psychologin richtig.
„Es ermöglicht auch, solche besonderen Fälle, wo es aus individuellen oder gesundheitlichen Gründen eben keine andere Möglichkeit gibt, diese weiter zu betreuen und das ohne so einen riesigen bürokratischen Aufwand.“
"Berliner TransitionsProgramm" als Vorreiter?
Ansonsten sieht das Sozialgesetzbuch den Arztwechsel für Jugendliche ohne Ausnahme vor, wenn diese sozialrechtlich Erwachsene geworden sind. 2009 wies der Sachverständigenrat für das Gesundheitswesen auf die mangelhafte Betreuung in der Übergangsphase hin. Wenige Einzelinitiativen und Projekte reichten nicht aus, um eine einheitliche Regelung und die finanzielle Absicherung transitionsmedizinischer Angebote zu gewährleisten, erklärt Silvia Müther, Kinder- und Jugendärztin und Diabetologin.
An diesen Punkten haben wir mit dem „Berliner TransitionsProgramm“ angesetzt. Wir wollten ein Programm starten, was indikationsübergreifend ist, also was letztendlich eine Struktur bietet, die auch finanziell hinterlegt ist, wo spezifische Leistungen definiert sind und dann können viele diese Strukturen nutzen.
Silvia Müther
Die Erste Vorsitzendes des „Berliner TransitionsProgramms“, kurz BTP, erklärt das Programm als eine Art „Fahrplan“ für den Wechsel, der von den Krankenkassen finanziert wird. 2008 startete das BTP für Jugendliche zwischen 16 und 21 Jahren mit Diabetes und Epilepsie. Inzwischen unterstützt es auch junge Patient:innen mit neuro-muskulären und onkologischen Erkrankungen, chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen und weiteren Diagnosen. Erster Schritt des „Berliner TransitionsProgramms: ein sogenanntes „Assessment“, eine Lageeinschätzung.
„Man nimmt sich einmal Zeit im Rahmen der Sprechstunde in einem sogenannten Transition-Gespräch und guckt, wo stehen wir? Wie sicher fühlen sich Patienten über ihre Erkrankung informiert? Was gibt es ansonsten noch für Themen, wo die Erkrankung eine Rolle spielt, also beispielsweise Berufswahl, Führerschein usw.?“
Letztendlich geht es um die Frage: Was muss noch erledigt werden, damit die Jugendlichen gut vorbereitet in die Erwachsenenmedizin wechseln können? Das Programm fördert die Selbstständigkeit der Kinder und Jugendlichen ...
„…, dass sie gute Kenntnisse haben über ihre Erkrankung. Und letztendlich geht es darum, auch zu gucken, ob diese Dinge, ob Termine auch wirklich gemacht werden, dass man eine gute Unterstützung schaffen kann.“
Evaluierung ist Bestandteil des Programms
Steht der Wechsel, die Transition, unmittelbar bevor, schreiben die bis dato zuständigen Kinder- und Jugendärzt:innen einen abschließenden Bericht. Darin wird die Krankengeschichte zusammengefasst, damit keine relevanten Daten verlorengehen. Die Erfahrung zeigt: An mangelnder Kommunikation zwischen den Beteiligten kann eine Transition leicht scheitern. Ein Jahr nach dem Wechsel organisiert das „Berliner TransitionsProgramm“ ein Gespräch zwischen Patient:in und Erwachsenenmediziner:in zur Evaluierung. Ein weiteres zentrales Werkzeug des Programms: das individuelle Fall-Management, erklärt Silvia Müther.
„Dass es eine übergeordnete Stelle gibt, die letztendlich die Fäden in der Hand behält, auch nach einem Transfer und guckt: Passieren denn all diese Dinge, die passieren sollen?“
Das Fallmanagement – also Fachleute aus dem Bereich der Medizin, Pflege oder Sozialarbeit – prüft: Nehmen die Jugendlichen ihre Termine wahr? Lösen sie Überweisungen und Rezepte ein? Haben sie Probleme mit der Krankenkasse? Sind Patient:innen umgezogen und brauchen nun einen neuen Arzt?
Bis zu 40 Prozent der jugendlichen Patient:innen verlieren beim Übergang in die Erwachsenenmedizin den Anschluss an eine Spezialversorgung – mit weitreichenden, unter Umständen lebensgefährlichen, Folgen. Bei nierentransplantierten Jugendlichen etwa erhöht sich die Rate an Transplantatverlusten und erneuter Dialyse. Bei jungen Patienten mit Typ-1-Diabetes steigt die Rate der Stoffwechselentgleisungen durch Insulinmangel, schwerer Unterzuckerung oder wegen Komplikationen, die die kleinsten Blutgefäße betreffen.
Um solche negativen Konsequenzen zu vermeiden, haben Fachgesellschaften und Patientenvertretungen 2021 wissenschaftliche Studien ausgewertet und damit Standards für die Transition festgelegt. Das Ergebnis, die sogenannte S3-Leitlinie, empfiehlt – wie das BTP – zu Beginn einer Transition ein Assessment, erklärt Leitlinien-Koordinatorin Gundula Ernst.
Und da sind z.B. solche Sachen drin, dass wir sagen, dass wir jedem Patienten eine Schulung anraten. Und da empfehlen wir auch andere Dinge, z.B. dass verschiedene Maßnahmen kombiniert werden, dass Eltern miteingebunden werden sollten, dass dieser Prozess frühzeitig beginnen sollte oder auch Thema Selbsthilfe; dass wir sagen: Jeder Patient sollte zumindest informiert werden über die Möglichkeiten, die die Selbsthilfe bietet.
Gundula Ernst
Die Leitlinienautor:innen raten auch, den Transfer nicht starr an den 18. Geburtstag zu koppeln, sondern Besonderheiten der Erkrankung oder die individuelle Reife zu berücksichtigen. Das gilt besonders für Jugendliche mit Mehrfachbehinderung. Diese jungen Menschen haben zusätzliche Bedarfe, die in der aktuellen Leitlinie nicht ausreichend abgebildet werden, weiß Gundula Ernst. Eine Spezifizierung wird für diese Patientengruppe noch erfolgen. Der Kinder- und Jugendmediziner Berthold Koltezko, Erster Vorsitzender der Stiftung Kindergesundheit, sagt: An Wissen über eine gelungene Transition mangele es nicht.
„Woran es hapert, ist die Umsetzung: Dass sowohl in der Kinderheilkunde als auch in der spezialisierten Erwachsenenmedizin zu wenig Ressourcen da sind, um das gut zu bewältigen. Es gibt zu wenig Behandlungszentren im Erwachsenenalter, die die Ressourcen haben, um diese Patienten weiter zu betreuen. Es gibt zu wenig Unterstützung für den eigentlichen Prozess der Transition, der Ressourcen braucht, der Arbeitszeit braucht, der Menschen braucht, die das gut begleiten. Und das müssen wir strukturiert besser hinbekommen, und dazu brauchen wir die Unterstützung der Krankenkassen, der Gesundheitspolitik, die sagt: Das ist ein wichtiges Thema im Interesse dieser Menschen, die besondere Bedürfnisse haben und die ein Recht haben auf gute Unterstützung.“
Autorin: Dorothea Brummerloh
Redaktion: Franziska Rattei
Regie: Cordula Dickmeiß
Technik: Christoph Richter
Dieses Feature wurde zum ersten Mal am 16. Mai 2022 ausgestrahlt.