"Bei ihm ging es nur um die Musik"
Genie oder Gehilfe der Nazis - Wilhelm Furtwängler zählt zu den berühmtesten Dirigenten und Komponisten, doch seine unkritische Haltung gegenüber dem Nazi-Regime wird ihm bis heute vorgeworfen. Der Autor Klaus Lang hat mit Elisabeth Furtwängler, der Frau des Musikers, gesprochen und ihre Erinnerungen an die Nazizeit, ihren Mann und seine Musik in dem Buch "Elisabeth Furtwängler" festgehalten.
Nach dem Sturz der Diktaturen kommen die Säuberungen. Das war 1945 nach dem Untergang des Nazi-Regimes nicht anders. Auch vielen Künstlern, die sich aus Überzeugung, Opportunismus oder einfach nur aus Naivität den Braunen Herren zur Verfügung gestellt hatten, wurde damals der Prozess gemacht. Bis heute umstritten ist dabei der Fall Furtwängler. Der Vorzeige-Deutsche aus der deutschesten der Künste, der Musik, war fast während der gesamten Dauer des sogenannten Tausendjährigen Reiches in Deutschland geblieben.
Als Leiter der Berliner Philharmoniker, anfangs auch noch in anderen Ämtern, die er allerdings 1934 niederlegte, als man ihm verbot, die als "entartet" geltende Oper "Mathis der Maler" von Hindemith aufzuführen, als Chef eines, wenn nicht des führenden Orchesters der Welt also, hatte Furtwängler ganz besonders unter Beobachtung gestanden. Bis in unsere Tage hinein wird an seinem Beispiel die Frage diskutiert: "Wie unpolitisch darf ein Künstler sein?" Denn darauf, dass er unpolitisch sei, hat sich Furtwängler immer gestützt - während des Dritten Reiches, wenn er von den Emigranten kritisiert wurde, und danach, als er vor den Amerikanern im sogenannten Spruchkammerverfahren Rede und Antwort stehen musste.
Er selbst sah sich als Feind des Regimes. Andere erblickten in ihm ein Aushängeschild der Nazis. Und selbst einer seiner frühesten Verteidiger nach 1945, der große jüdische Geiger Yehudi Menuhin, schrieb in seinen Lebenserinnerungen "Unvollendete Reise" von 1976:
"Weil er ein so großer Künstler war, zog er den Hass auf sich. Ich glaube, nicht völlig zu unrecht: denn wem viel gegeben ist, von dem wird man viel fordern. Sehr viel kompromissbereitere Musiker als er, die sich mit Hilfe der Parteizugehörigkeit und durch ihre Haltungen den Nazis gegenüber ihre Karrieren ebneten, sind inzwischen längst wieder wohlgelitten und geachtet, und kein Makel ist ihnen zurückgeblieben. Furtwängler jedoch stand sichtbar in aller Öffentlichkeit, Zielscheibe jeder Verleumdung. Ohne ihn wäre es dem berühmten Geiger Carl Flesch gewiss nicht gelungen, aus dem besetzten Holland in die Schweiz zu fliehen; eine Reihe jüdischer Musiker, die gesund und glücklich in Amerika saßen, bezeugten seine Bemühungen, sie vor der Deportation zu bewahren. Aber er hatte eben im NS-Staat ein hohes Amt innegehabt."
Neues Material zum Fall Furtwängler präsentiert jetzt ein Buch des Berliner Musikjournalisten Klaus Lang. Es ist ein etwas kurioses Mixtum Kompositum zum Ruhme der von Lang offenkundig heftig verehrten, heute 97 Jahre alten Furtwängler-Witwe Elisabeth. Knapp 200 Seiten bestehen aus Interview-Aufzeichnungen. Weitere 200 Seiten bringen eine vom Autor kommentierte Auswahl der über 500 Briefe, die sich Wilhelm und Elisabeth Furtwängler zwischen 1942 und 1954 schrieben.
Elisabeth, die zum Zeitpunkt der Gespräche 95 Jahre alt war, ist anscheinend eine temperamentvolle, eigenwillige Dame, bei der das Scharfsinnige in Sachen Menschen und Musik neben hanebüchener politischer Kenntnislosigkeit steht. So behauptet sie allen Ernstes, ihr erster Mann, Hans Ackermann, der 1940 in Frankreich fiel, sei "ja frankophil" gewesen und darum "in den Frankreich-Feldzug gegangen", als habe es sich dabei um einen Freundschaftsbesuch gehandelt. Dann vertritt sie die Ansicht, Furtwängler, der sich weigerte, im besetzten Frankreich aufzutreten, habe nie in den von Deutschen okkupierten Ländern musiziert, obwohl sie ausdrücklich seine Gastspiele in Kopenhagen, Prag und Wien erwähnt. Offenbar ist sowohl ihr als auch Furtwängler selber, der sich mit dem gleichen Argument zu entlasten versuchte, verborgen geblieben, dass die Nazis sich erst Österreichs und dann der Tschechoslowakei und dann auch Dänemarks bemächtigt haben.
Wenn das Buch dennoch als aufschlussreich und interessant gelten kann, dann weil es sehr anschaulich belegt, wie viele Bildungsbürger dem Dritten Reich begegnet sind, nämlich mit einer Mischung aus unpolitischer Naivität im Allgemeinen, grenzenloser Unterschätzung der Nazis im Besonderen und einer Art Bildungshochmut, der in den Nazis mehr die "Braunen Proleten" als die gerissenen Verbrecher mit der ungeheuren kriminellen Energie wahrnahm. Im Hinblick auf Furtwänglers Verhältnis zu den Machthabern hört sich das beispielsweise so an:
"Er war einfach ein Deutscher und unglücklich darüber, dass die Nazis Deutschland beherrschten. Furtwängler war ein Tragiker. Schon allein sein Verhältnis vom Komponieren zum Dirigieren war tragisch. Wir hatten aber immer auch politische Gespräche, weil es durch die Borniertheit der Nazis dauernd Ärger gab. Er hat auch einmal für Hitlers Geburtstag dirigiert, das stimmt. Aber meist wurde er krank, wenn er eine solche Sache kommen sah. Die damaligen Musikfilme wären so wunderbar, wenn da nicht diese blöden Hakenkreuze herumstehen würden. Aber die hingen da immer herum, anders ging es nicht. Ich weiß es, einmal, bei den Wiener Philharmonikern, als schon alles für eine andere Feierlichkeit mit Fahnen dekoriert war, sagte Wilhelm: 'Abräumen, bitte alles abräumen.’ Später ging das nicht mehr. Es war furchtbar qualvoll, was für überflüssige Gedankengänge man machen musste, um ungestört Musik machen zu können. Bei ihm ging es immer nur um die Musik."
Ganz sicher waren Furtwänglers keine Nazis. Und es geht auch aus den überwiegend privat gehaltenen Briefen des Dirigenten klar hervor, dass ihn die Verhältnisse im Dritten Reich zunehmend bedrückten. So weit wie seine Frau Elisabeth geht er allerdings nicht, die ihrem Mann zum Beispiel nach der berühmt-berüchtigten Sportpalast-Rede von Goebbels Anfang 1943 schrieb: "Jetzt heißt es wirklich durchhalten und deren Suppe mit auslöffeln." Im Sommer desselben Jahres spricht sie von den Machthabern als "diese Bande". Keine Frage, Furtwänglers standen auf der anderen Seite. Und wahrscheinlich kann man ihnen nicht einmal aus ihrer politischen Blindheit einen Vorwurf machen. Damit teilten sie das Schicksal ihrer Schicht und der Mehrheit der Deutschen. In unserer "verspäteten Nation", das hat der große Politologe Hellmuth Plessner eindrucksvoll beschrieben, war nach 1871 alles Mögliche größer geworden. Nur das politische Bewusstsein war nicht mitgewachsen. Das wurde Deutschland 1933 zum Verhängnis - einem Verhängnis, das einen Weltenbrand auslöste.
Klaus Lang: Elisabeth Furtwängler. Mädchen mit 95 Jahren?
Novum Verlag, Wien und München, 2007
Als Leiter der Berliner Philharmoniker, anfangs auch noch in anderen Ämtern, die er allerdings 1934 niederlegte, als man ihm verbot, die als "entartet" geltende Oper "Mathis der Maler" von Hindemith aufzuführen, als Chef eines, wenn nicht des führenden Orchesters der Welt also, hatte Furtwängler ganz besonders unter Beobachtung gestanden. Bis in unsere Tage hinein wird an seinem Beispiel die Frage diskutiert: "Wie unpolitisch darf ein Künstler sein?" Denn darauf, dass er unpolitisch sei, hat sich Furtwängler immer gestützt - während des Dritten Reiches, wenn er von den Emigranten kritisiert wurde, und danach, als er vor den Amerikanern im sogenannten Spruchkammerverfahren Rede und Antwort stehen musste.
Er selbst sah sich als Feind des Regimes. Andere erblickten in ihm ein Aushängeschild der Nazis. Und selbst einer seiner frühesten Verteidiger nach 1945, der große jüdische Geiger Yehudi Menuhin, schrieb in seinen Lebenserinnerungen "Unvollendete Reise" von 1976:
"Weil er ein so großer Künstler war, zog er den Hass auf sich. Ich glaube, nicht völlig zu unrecht: denn wem viel gegeben ist, von dem wird man viel fordern. Sehr viel kompromissbereitere Musiker als er, die sich mit Hilfe der Parteizugehörigkeit und durch ihre Haltungen den Nazis gegenüber ihre Karrieren ebneten, sind inzwischen längst wieder wohlgelitten und geachtet, und kein Makel ist ihnen zurückgeblieben. Furtwängler jedoch stand sichtbar in aller Öffentlichkeit, Zielscheibe jeder Verleumdung. Ohne ihn wäre es dem berühmten Geiger Carl Flesch gewiss nicht gelungen, aus dem besetzten Holland in die Schweiz zu fliehen; eine Reihe jüdischer Musiker, die gesund und glücklich in Amerika saßen, bezeugten seine Bemühungen, sie vor der Deportation zu bewahren. Aber er hatte eben im NS-Staat ein hohes Amt innegehabt."
Neues Material zum Fall Furtwängler präsentiert jetzt ein Buch des Berliner Musikjournalisten Klaus Lang. Es ist ein etwas kurioses Mixtum Kompositum zum Ruhme der von Lang offenkundig heftig verehrten, heute 97 Jahre alten Furtwängler-Witwe Elisabeth. Knapp 200 Seiten bestehen aus Interview-Aufzeichnungen. Weitere 200 Seiten bringen eine vom Autor kommentierte Auswahl der über 500 Briefe, die sich Wilhelm und Elisabeth Furtwängler zwischen 1942 und 1954 schrieben.
Elisabeth, die zum Zeitpunkt der Gespräche 95 Jahre alt war, ist anscheinend eine temperamentvolle, eigenwillige Dame, bei der das Scharfsinnige in Sachen Menschen und Musik neben hanebüchener politischer Kenntnislosigkeit steht. So behauptet sie allen Ernstes, ihr erster Mann, Hans Ackermann, der 1940 in Frankreich fiel, sei "ja frankophil" gewesen und darum "in den Frankreich-Feldzug gegangen", als habe es sich dabei um einen Freundschaftsbesuch gehandelt. Dann vertritt sie die Ansicht, Furtwängler, der sich weigerte, im besetzten Frankreich aufzutreten, habe nie in den von Deutschen okkupierten Ländern musiziert, obwohl sie ausdrücklich seine Gastspiele in Kopenhagen, Prag und Wien erwähnt. Offenbar ist sowohl ihr als auch Furtwängler selber, der sich mit dem gleichen Argument zu entlasten versuchte, verborgen geblieben, dass die Nazis sich erst Österreichs und dann der Tschechoslowakei und dann auch Dänemarks bemächtigt haben.
Wenn das Buch dennoch als aufschlussreich und interessant gelten kann, dann weil es sehr anschaulich belegt, wie viele Bildungsbürger dem Dritten Reich begegnet sind, nämlich mit einer Mischung aus unpolitischer Naivität im Allgemeinen, grenzenloser Unterschätzung der Nazis im Besonderen und einer Art Bildungshochmut, der in den Nazis mehr die "Braunen Proleten" als die gerissenen Verbrecher mit der ungeheuren kriminellen Energie wahrnahm. Im Hinblick auf Furtwänglers Verhältnis zu den Machthabern hört sich das beispielsweise so an:
"Er war einfach ein Deutscher und unglücklich darüber, dass die Nazis Deutschland beherrschten. Furtwängler war ein Tragiker. Schon allein sein Verhältnis vom Komponieren zum Dirigieren war tragisch. Wir hatten aber immer auch politische Gespräche, weil es durch die Borniertheit der Nazis dauernd Ärger gab. Er hat auch einmal für Hitlers Geburtstag dirigiert, das stimmt. Aber meist wurde er krank, wenn er eine solche Sache kommen sah. Die damaligen Musikfilme wären so wunderbar, wenn da nicht diese blöden Hakenkreuze herumstehen würden. Aber die hingen da immer herum, anders ging es nicht. Ich weiß es, einmal, bei den Wiener Philharmonikern, als schon alles für eine andere Feierlichkeit mit Fahnen dekoriert war, sagte Wilhelm: 'Abräumen, bitte alles abräumen.’ Später ging das nicht mehr. Es war furchtbar qualvoll, was für überflüssige Gedankengänge man machen musste, um ungestört Musik machen zu können. Bei ihm ging es immer nur um die Musik."
Ganz sicher waren Furtwänglers keine Nazis. Und es geht auch aus den überwiegend privat gehaltenen Briefen des Dirigenten klar hervor, dass ihn die Verhältnisse im Dritten Reich zunehmend bedrückten. So weit wie seine Frau Elisabeth geht er allerdings nicht, die ihrem Mann zum Beispiel nach der berühmt-berüchtigten Sportpalast-Rede von Goebbels Anfang 1943 schrieb: "Jetzt heißt es wirklich durchhalten und deren Suppe mit auslöffeln." Im Sommer desselben Jahres spricht sie von den Machthabern als "diese Bande". Keine Frage, Furtwänglers standen auf der anderen Seite. Und wahrscheinlich kann man ihnen nicht einmal aus ihrer politischen Blindheit einen Vorwurf machen. Damit teilten sie das Schicksal ihrer Schicht und der Mehrheit der Deutschen. In unserer "verspäteten Nation", das hat der große Politologe Hellmuth Plessner eindrucksvoll beschrieben, war nach 1871 alles Mögliche größer geworden. Nur das politische Bewusstsein war nicht mitgewachsen. Das wurde Deutschland 1933 zum Verhängnis - einem Verhängnis, das einen Weltenbrand auslöste.
Klaus Lang: Elisabeth Furtwängler. Mädchen mit 95 Jahren?
Novum Verlag, Wien und München, 2007
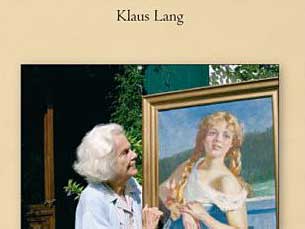
Klaus Lang: Elisabeth Furtwängler.© Novum Verlag
