Beklemmende Charakterstudie
Jonathan Steinberg hat eine quellenbasierte, solide und zugleich romanhafte Biografie geschaffen. Bismarks Verhältnis zur Macht wird deutlich, wie schlecht er sie abgeben konnte, wie kompromisslos er sie einsetzte.
Bismarck, ein Genie? Unbedingt. Und mehr noch:
Er ist der "berühmteste Staatsmann seiner Zeit und vielleicht aller Zeiten".
Der amerikanische Historiker Jonathan Steinberg hat wenig Angst vor Superlativen, wenn es um Bismarck geht. Es ist der Held, über den er eine umfangreiche Biographie verfasst hat. Doch, um einem Missverständnis gleich vorzubeugen: Es ist kein strahlender Held.
Der Kult von Gewalt und Selbstherrschertum, den Bismarck begründete, da duldet Steinberg keinen Zweifel, habe die deutsche Geschichte vergiftet.
"Insofern führe "eine gerade, direkte Linie von Bismarck zu Hitler"
– und man möchte hinzufügen, dass Verbindungslinien keine Gleichheitszeichen sind.
Keine Bejubelung des großen Mannes also, aber doch ein ungeteiltes Interesse an ihm, dem "souveränen Selbst", wie Steinberg es nennt. Bismarck ist der Mann, der die Geschicke Europas bestimmt hat, doch aus welchen Kräften, welchen Ideen und Interessen heraus?
Jeden und jedes hat er instrumentell behandelt. Und als er 1890 aus dem Amt gedrängt wurde, hatte er es sich mit allen verdorben, auch mit dem Militär und den Konservativen.
Schon die Reichseinigung war mit einem Verstoß gegen geheiligte konservative Prinzipien verbunden. Alte Souveränitäten mussten weichen, um die Einigung möglich zu machen. Hannover, Kurhessen, Nassau und, in besonders brutaler Form, die alte Reichsstadt Frankfurt wurden nach dem Sieg über Österreich 1866 annektiert. Mit diesem Erfolg gewann Bismarck an Ansehen, erst recht nach der Reichsgründung.
Die Sympathie für solche Machtpolitik breitete sich in weite Kreise aus und stützte den Kanzler. Andere graute es. Der Kronprinz und spätere Kaiser Friedrich III., selbst Heerführer in den Einigungskriegen, schrieb Silvester 1870 über Bismarck, als dieser die Beschießung von Paris fordert:
"Was nützt uns alle Macht, aller kriegerischer Ruhm und Glanz, wenn Hass und Misstrauen uns überall begegnen? (…) Bismarck hat uns groß und mächtig gemacht, aber er raubte uns unsere Freunde, die Sympathien der Welt und - unser gutes Gewissen."
Und ähnlich verhält es sich mit dem Kulturkampf gegen die katholische Kirche. Viele Protestanten begrüßten ihn, erhofften den Sieg fortschrittlicher Potenzen gegen die römische Rückständigkeit. Aber es gab auch Beobachter, die nicht nur das Anti-liberale darin sahen, sondern ein spezifisches Bismarcksches Machtverständnis.
1872 schrieb Heinrich von Mühler zur Erklärung seines Rücktritts als preußischer Kultusminister, es zeige sich im Kulturkampf …
"… die ganze, der Bismarckschen Politik zugrundeliegende mehr als realistische – ich darf wohl sagen – materialistische Anschauungsweise. Bismarck verachtet die geistigen und moralischen Hebel der Politik. Blut und Eisen – materielle Machtmittel sind die Faktoren, mit denen er rechnet."
Das zu den Mitteln. Welches sind die Ziele? Jonathan Steinberg lässt sein Buch mit der selbstgewählten Grabinschrift Bismarcks enden:
"Ein treuer deutscher Diener seines Kaisers Wilhelm I."
Die Reichseinigung war ihm sicher ein Anliegen, dazu die Wahrung der deutschen Machtstellung. Was noch? Hier bleibt der amerikanische Historiker blass. Er interessiert sich für die Persönlichkeit, die Psyche seiner Hauptfigur, weniger für die Umstände, unter denen er wirkte.
Industrie, Finanzwesen, aufkommender Welthandel und Kolonialismus, die Arbeiterfrage, Wissenschaft, Technik, die Rolle des Adels, das alles tritt nicht klar hervor. "Bismarck. Magier der Macht" ist sein Buch betitelt, Bismarck und seine Zeit dürfte es wirklich nicht heißen. Wer ein solches Buch lesen will, der ist mit den alten Darstellungen von Ernst Engelberg, Lothar Gall oder Otto Pflanze besser bedient.
Das ist ein Einwand. Aber dem stehen Stärken gegenüber. Denn die Person des Reichskanzlers erregt ja zu Recht Interesse. Zu beobachten ist eine ungeheuerliche Fixierung auf die Macht. Ob es um die Stempelsteuer geht oder den Leiter eines Lehrerseminars in Schlesien - Bismarck kümmert sich um alles, er ist völlig unfähig, anderen eine Entscheidung zu überlassen.
Seine Untergebenen, von den Beamten bis zu den Ministern behandelt er - so der Graf von Limburg-Styrum, wie Don Juan seine Geliebten, erst werbend, dann wegwerfend. Erlebt er Widerstand, tobt er vor Wut und Hass, bis zum Ausbruch manifester Krankheiten.
Er gilt als der große Realist seiner Zeit, das ist auch nicht ganz falsch. Er war sich auch über die Gebrechlichkeit aller politischen Dinge unbedingt im Klaren:
"'Die Politik ist ein undankbares Geschäft, namentlich deshalb, weil alles auf Vermutungen und Zufälligkeiten beruht.' Bei anderer Gelegenheit stellte er fest, 'dass man so klug sein kann wie die Klugen dieser Welt und doch jederzeit in die nächste Minute geht wie ein Kind ins Dunkle'."
Man sollte meinen, dass jemand, der so denkt, eine natürliche Neigung zum Kompromiss habe. Das galt für Bismarck nur in der Außenpolitik. In der Innenpolitik kannte er allein Kampf und Siegen-Wollen. Das führte zu Niederlagen etwa gegen Katholizismus und Sozialdemokratie, wie er sie im auswärtigen Geschäft nicht einstecken musste. In dem Hass auf alles, was anders denkt und fühlt, liegt etwas Pathologisches, ja Kleinliches, Schäbiges.
Das alles ist nicht neu. Jonathan Steinberg hat keine unbekannten Quellen aufgetan, er erzählt an Hand des bekannten veröffentlichten Materials. Aber die Zuspitzung auf die Persönlichkeit Bismarck macht einen tiefen Eindruck. Alles ist diesem Mann zugefallen, Macht, Ehre, die Gunst seines Königs, der sich bei Lebzeiten abzeichnende historische Rang. Und nichts davon stellt ihn zufrieden, macht ihn großzügig.
Die Biographie ist als Epochenbild nicht sehr stark. Aber als Charakterstudie eines Menschen unter der Wirkung der Macht ist sie beklemmend. Quellenbasiert und solide hat sie zugleich eine geradezu romanhafte Qualität.
Jonathan Steinberg: "Bismarck - Magier der Macht"
Aus dem Amerikanischen von Klaus-Dieter Schmidt
Propyläen Verlag, Berlin 2012
752 Seiten
Er ist der "berühmteste Staatsmann seiner Zeit und vielleicht aller Zeiten".
Der amerikanische Historiker Jonathan Steinberg hat wenig Angst vor Superlativen, wenn es um Bismarck geht. Es ist der Held, über den er eine umfangreiche Biographie verfasst hat. Doch, um einem Missverständnis gleich vorzubeugen: Es ist kein strahlender Held.
Der Kult von Gewalt und Selbstherrschertum, den Bismarck begründete, da duldet Steinberg keinen Zweifel, habe die deutsche Geschichte vergiftet.
"Insofern führe "eine gerade, direkte Linie von Bismarck zu Hitler"
– und man möchte hinzufügen, dass Verbindungslinien keine Gleichheitszeichen sind.
Keine Bejubelung des großen Mannes also, aber doch ein ungeteiltes Interesse an ihm, dem "souveränen Selbst", wie Steinberg es nennt. Bismarck ist der Mann, der die Geschicke Europas bestimmt hat, doch aus welchen Kräften, welchen Ideen und Interessen heraus?
Jeden und jedes hat er instrumentell behandelt. Und als er 1890 aus dem Amt gedrängt wurde, hatte er es sich mit allen verdorben, auch mit dem Militär und den Konservativen.
Schon die Reichseinigung war mit einem Verstoß gegen geheiligte konservative Prinzipien verbunden. Alte Souveränitäten mussten weichen, um die Einigung möglich zu machen. Hannover, Kurhessen, Nassau und, in besonders brutaler Form, die alte Reichsstadt Frankfurt wurden nach dem Sieg über Österreich 1866 annektiert. Mit diesem Erfolg gewann Bismarck an Ansehen, erst recht nach der Reichsgründung.
Die Sympathie für solche Machtpolitik breitete sich in weite Kreise aus und stützte den Kanzler. Andere graute es. Der Kronprinz und spätere Kaiser Friedrich III., selbst Heerführer in den Einigungskriegen, schrieb Silvester 1870 über Bismarck, als dieser die Beschießung von Paris fordert:
"Was nützt uns alle Macht, aller kriegerischer Ruhm und Glanz, wenn Hass und Misstrauen uns überall begegnen? (…) Bismarck hat uns groß und mächtig gemacht, aber er raubte uns unsere Freunde, die Sympathien der Welt und - unser gutes Gewissen."
Und ähnlich verhält es sich mit dem Kulturkampf gegen die katholische Kirche. Viele Protestanten begrüßten ihn, erhofften den Sieg fortschrittlicher Potenzen gegen die römische Rückständigkeit. Aber es gab auch Beobachter, die nicht nur das Anti-liberale darin sahen, sondern ein spezifisches Bismarcksches Machtverständnis.
1872 schrieb Heinrich von Mühler zur Erklärung seines Rücktritts als preußischer Kultusminister, es zeige sich im Kulturkampf …
"… die ganze, der Bismarckschen Politik zugrundeliegende mehr als realistische – ich darf wohl sagen – materialistische Anschauungsweise. Bismarck verachtet die geistigen und moralischen Hebel der Politik. Blut und Eisen – materielle Machtmittel sind die Faktoren, mit denen er rechnet."
Das zu den Mitteln. Welches sind die Ziele? Jonathan Steinberg lässt sein Buch mit der selbstgewählten Grabinschrift Bismarcks enden:
"Ein treuer deutscher Diener seines Kaisers Wilhelm I."
Die Reichseinigung war ihm sicher ein Anliegen, dazu die Wahrung der deutschen Machtstellung. Was noch? Hier bleibt der amerikanische Historiker blass. Er interessiert sich für die Persönlichkeit, die Psyche seiner Hauptfigur, weniger für die Umstände, unter denen er wirkte.
Industrie, Finanzwesen, aufkommender Welthandel und Kolonialismus, die Arbeiterfrage, Wissenschaft, Technik, die Rolle des Adels, das alles tritt nicht klar hervor. "Bismarck. Magier der Macht" ist sein Buch betitelt, Bismarck und seine Zeit dürfte es wirklich nicht heißen. Wer ein solches Buch lesen will, der ist mit den alten Darstellungen von Ernst Engelberg, Lothar Gall oder Otto Pflanze besser bedient.
Das ist ein Einwand. Aber dem stehen Stärken gegenüber. Denn die Person des Reichskanzlers erregt ja zu Recht Interesse. Zu beobachten ist eine ungeheuerliche Fixierung auf die Macht. Ob es um die Stempelsteuer geht oder den Leiter eines Lehrerseminars in Schlesien - Bismarck kümmert sich um alles, er ist völlig unfähig, anderen eine Entscheidung zu überlassen.
Seine Untergebenen, von den Beamten bis zu den Ministern behandelt er - so der Graf von Limburg-Styrum, wie Don Juan seine Geliebten, erst werbend, dann wegwerfend. Erlebt er Widerstand, tobt er vor Wut und Hass, bis zum Ausbruch manifester Krankheiten.
Er gilt als der große Realist seiner Zeit, das ist auch nicht ganz falsch. Er war sich auch über die Gebrechlichkeit aller politischen Dinge unbedingt im Klaren:
"'Die Politik ist ein undankbares Geschäft, namentlich deshalb, weil alles auf Vermutungen und Zufälligkeiten beruht.' Bei anderer Gelegenheit stellte er fest, 'dass man so klug sein kann wie die Klugen dieser Welt und doch jederzeit in die nächste Minute geht wie ein Kind ins Dunkle'."
Man sollte meinen, dass jemand, der so denkt, eine natürliche Neigung zum Kompromiss habe. Das galt für Bismarck nur in der Außenpolitik. In der Innenpolitik kannte er allein Kampf und Siegen-Wollen. Das führte zu Niederlagen etwa gegen Katholizismus und Sozialdemokratie, wie er sie im auswärtigen Geschäft nicht einstecken musste. In dem Hass auf alles, was anders denkt und fühlt, liegt etwas Pathologisches, ja Kleinliches, Schäbiges.
Das alles ist nicht neu. Jonathan Steinberg hat keine unbekannten Quellen aufgetan, er erzählt an Hand des bekannten veröffentlichten Materials. Aber die Zuspitzung auf die Persönlichkeit Bismarck macht einen tiefen Eindruck. Alles ist diesem Mann zugefallen, Macht, Ehre, die Gunst seines Königs, der sich bei Lebzeiten abzeichnende historische Rang. Und nichts davon stellt ihn zufrieden, macht ihn großzügig.
Die Biographie ist als Epochenbild nicht sehr stark. Aber als Charakterstudie eines Menschen unter der Wirkung der Macht ist sie beklemmend. Quellenbasiert und solide hat sie zugleich eine geradezu romanhafte Qualität.
Jonathan Steinberg: "Bismarck - Magier der Macht"
Aus dem Amerikanischen von Klaus-Dieter Schmidt
Propyläen Verlag, Berlin 2012
752 Seiten
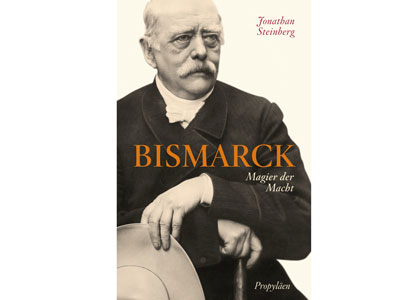
"Jonathan Steinberg: Bismarck"© Propyläen Verlag

Erlebt Bismarck Widerstand, tobt er vor Wut und Hass.© AP Archiv
