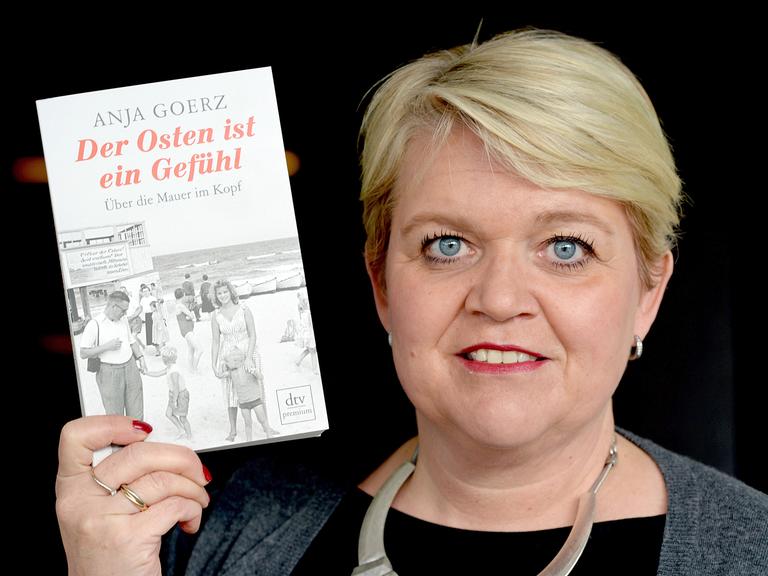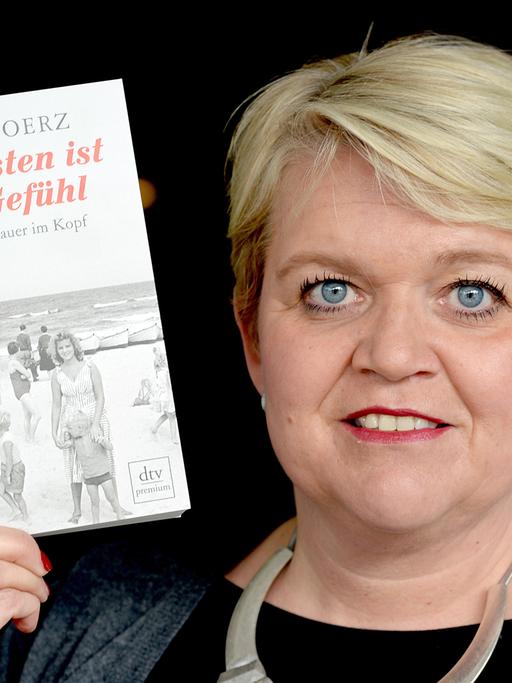Die Stadt ist auch ohne Mauer geteilt

Eine Stadt brauche keine Mauer, um geteilt zu sein, meint der Politologe Martin Huyn. Oft gebe es unsichtbare Mauern zwischen Menschen - wie in den Berliner Bezirken Wedding und Pankow.
Das Dort war einst das Drüben. Heute ist es das neue Hier. Und das Hier ist nun das neue Drüben. Einst von der Laune der Politik geteilt - in zwei Windrichtungen, Ost und West. Heute hält nur ein kleiner Grenzstreifen die Erinnerung an diese Geschichte wach.
Die massiven Betonklötze sind längst zu Souvenirs verarbeitet - zu einem Kunstwerk umfunktioniert, als Symbole der Freiheit an befreundete Länder verschenkt, wie an Korea, das vom 38. Breitengrad noch immer durchschnitten ist.
Als die Sehnsucht nach Freiheit die Mauer zum Fall brachte, waren viele schon hier, im alten Hier, und dennoch Fremde. In kurzer Zeit jedoch wurde aus Drüben das neue Hier und Hier wurde zum alten Drüben. Ohne umgezogen zu sein, wohne ich jetzt nicht mehr hier, sondern drüben.
Zwischen drüben und hier existiert unverändert eine Mauer. Sie ist omnipräsent, teilt in soziale Schichten, in Gewinner und Verlierer, in multikulturelle Vielfalt und homogene Einfalt, in Lebensentwürfe, die unterschiedlicher nicht sein können, und in Lebenswege, die ungeschriebene Gesetze trennen.
Im Drüben lebt die Unterschicht, begegnen sich Wahlabstinenzler, Leergut-Aufstocker, Edelreservisten des ersten Arbeitsmarktes, Menschen, die zu wenig zum Leben, aber zu viel zum Sterben haben. Und wenn sie gehen, dann im Stillen. Niemand vermisst sie, kein Straßenschild, kein Denkmal erinnert an die, die einen sozialen Brennpunkt ausmachen.
Im neuen Hier, das einmal das Drüben war, hat sich die Mittelschicht gefunden, Bildschirmtaugliche, Bildungsbürger, die das Wählerpotenzial stellen und das Rückgrat der sozialen Marktwirtschaft bilden. Das Hier ist - wie überall - der Hip-District.
Das Hier hat sich verändert
Im Hier sehe ich wohlbehütete Kinder, die mit einem Cello eine private Musikschule besuchen, an Kunstgalerien vorbeigehen und hervorragende Angebote zur Ausbildung genießen. Im Drüben sehe ich Kinder, die mit dem türkischen Saiteninstrument Saz zur Moschee in den Islamunterricht gehen, vorbei an Wettbüros, Casinos und Dönerbuden. Nur das Läuten der Kirchenglocken erinnert, dass dies nicht das Land von Kemal Atatürk ist, dessen Konterfei die Heckfenster der Autos ziert.
Hier der Bioladen, die private Schule für Yoga und Feng Shui zum Ausgleich für Körper und Geist, die Geschäfte mit Spezialitäten zu exquisiten Preisen, wie die gute Flasche Wein ab 10 Euro. Drüben der Billigdiscounter, die Berliner Tafel, die Suppenküche, die Eckkneipe, aus der Bonnie Tyler Musik ertönt, wo es Bier bereits ab 1,20 Euro gibt.
Drüben begegnet mir ein Schwarm Frauen mit Kopftüchern, auch Roma und Sinti, deren Kinder den Vorplatz der Kirche zum Spielen nutzen, der vietnamesische Kleinunternehmer, der für seine vorwiegend muslimischen Kunden Kopftücher verkauft.
Keiner sorgt sich, welche Krawatte er tragen soll, keine, ob sich ein Pailletten besticktes Kleid besser macht. Ich schaue auf das überdimensionale Wandgemälde über dem Matratzen-Laden, das die berühmten Fußballbrüder Boateng darstellt. Sie haben den Sprung ins "Hier" geschafft, der nur wenigen Menschen von "Drüben" gelingt.

Ein Sportartikelhersteller wirbt mit den Konterfeis der Brüder Jerome, George und Kevin-Prince Boateng (von links nach rechts) an einer Hauswand im Berliner Stadtteil Wedding© picture alliance / dpa / Daniel Naupold
Drüben war nie anders, aber das Hier hat sich verändert. Zwei Welten, die nur einen Katzensprung voneinander entfernt liegen, durchzogen von einer unsichtbaren Mauer, Grenzen und Checkpoints. Auch wenn niemand sie mehr unter Lebensgefahr überquert, sind doch Begegnungen selten. So nah, so frei und doch so unendlich fern, wie vor 25 Jahren.
Martin Hyun wurde 1979 in der nordrhein-westfälischen Samt- und Seidenstadt Krefeld geboren. Er ist Sohn koreanischer Gastarbeiter und studierte Politik sowie International Relations in den USA und Belgien. Er war der erste koreanischstämmige Bundesliga-Profi in der Deutschen Eishockey Liga sowie Junioren Nationalspieler Deutschlands. Seit 1993 ist er glücklicher deutscher Staatsbürger und lebt in Berlin.