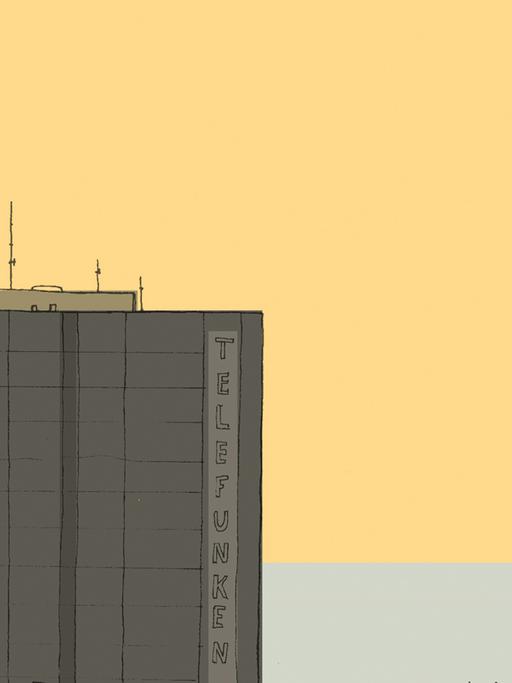"Mit dieser Biografie altert man schwieriger als ein Beamter"
09:29 Minuten
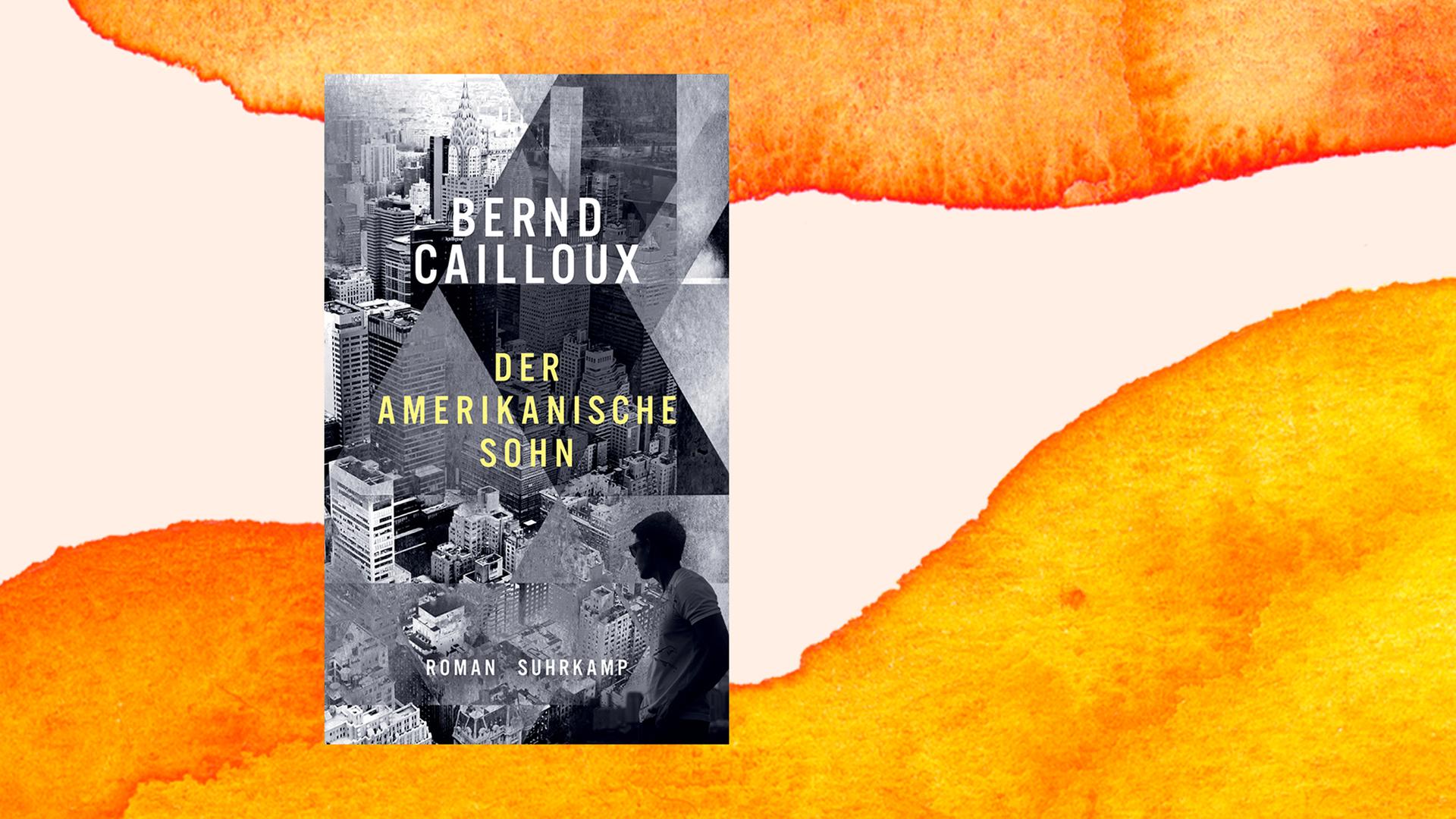
Auf der Suche nach dem verlorenen Sohn reist der namenlose Ich-Erzähler in Bernd Cailloux' neuem Roman durch die USA. Ein ewiger Hippie mit Prostataproblemen, dessen Verhältnis zum Kapitalismus eine "über Jahrzehnte gewachsene Vertrauenskrise" ist.
Florian Felix Weyh: Bernd Cailloux ist vieles, ganz sicher aber kein linker Biedermensch. Das lässt sich mit Bestimmtheit sagen, wenn man seine Bücher gelesen hat, Essays nämlich, Romane und Erzählungen, oft entlang der eigenen Biografie geführt und nicht selten mit 1968 und den Folgen verknüpft.
"Das Geschäftsjahr 1968/69", ein Roman, verblüffte vor 15 Jahren mit einer frühen Startup-Story rund um Discokugeln, Stroboskope und Drogen. Im Roman "Gutgeschriebene Verluste" setzte derselbe Erzähler 2012 seinen Lebensweg fort. Und nun, 2020, berichtet er uns von Kinderlosigkeit als 68er-Freiheitsidee und von der überraschenden Erkenntnis des Helden, doch nicht kinderlos geblieben zu sein. Bernd Cailloux ist nun bei mir im Studio. Guten Tag!
Bernd Cailloux: Guten Tag!
Weyh: Es gibt immer diese Fragen: "Haben Sie eigentlich Kinder?", wenn einen jemand kennenlernt.
Cailloux: Ja, zum Beispiel. Das ist ja eine beliebte Dinnerfrage, und wenn man Leute neu kennenlernt, dann kommt die Frage, weil sie selber Kinder haben: "Und Sie, haben Sie Kinder?" Und aus diesem Mangel heraus, der doch erst in einem fortgeschrittenen Alter deutlich wird, ergibt sich eben dann die gesamte Romanerzählung.
Ohne Familie ist ein alternder Mann "fast so was wie Hitler"
Weyh: Die Romanerzählung, das ist derselbe Held wie in den früheren Büchern.
Cailloux: Merkwürdigerweise ein namenloser Ich-Erzähler, den man natürlich nicht unbedingt mit dem Autor so eins zu eins setzen soll.
Weyh: Namenloser Ich-Erzähler, sagen wir mal 80 zu 20, aber es spielt tatsächlich keine so große …
Cailloux: Es ist, glaube ich, 70 zu 30 diesmal.
Weyh: 70, 30 diesmal. "Ohne Familie und kinderlos war ein alternder Mann", schreiben Sie, "schon fast so was wie Hitler." Ganz schön böse.
Cailloux: Wie der späte Hitler, diese berühmten Bilder, diese Tätschel-Bilder. Und das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die Melancholie sitzt trotzdem auch in dieser Übertreibung.
Weyh: Es ist ein Roman über Vaterschaft, ein Roman über New York, weil weite Teile in New York spielen bei einem Besuch, nach vielen Jahrzehnten wieder da hinzugehen, und es ist auch, ich sage es mal ganz bewusst, ein Essay eigentlich eingestreut über das Altwerden. Wie altert dieser Held, der eigentlich in seiner Erinnerung ja auch immer jung geblieben ist oder zumindest das Leben eines Jungen geführt hat als ewiger Hippie?
Cailloux: Ja, das muss man da nachlesen. Also, man altert mit dieser Biografie vielleicht ein bisschen schwieriger als ein Beamter, der 30 Jahre irgendwo gearbeitet hat. Der Weg war ja ziemlich lang, den ich da gegangen bin oder der Ich-Erzähler. Und es fällt schwer, es ist ganz klar, also, muss man nicht zitieren, Philip Roth, das Altern, ein Massaker, und da gibt es ja endlose Beschweren anderer Autoren schon.
Mit einem Prostataleiden erlebt man die Welt anders
Weyh: Bei Ihnen ist es aber auch, auf sich selbst oder auf den Helden bezogen, ganz schön schonungslos. Also, es gibt eine wunderbare Episode, wo er sich überlegt, dass er einen Toilettenführer für New York schreiben müsste, weil er eben ein Problem mit der Prostata hat und es in New York keine Möglichkeit gibt, sich da zu erleichtern.
Cailloux: Na, ja, gibt es schon, aber schwierig. Also, man muss dann halt in ein Restaurant gehen und muss was verzehren, sonst darf man nicht auf die Toiletten, und die Parks, das ist ja eine kleine Episode, die Parks haben nur ab einer bestimmten Größe eine Toilette, die aber dann um 18 Uhr schließt. Es ist alles nicht so einfach für fremde andere. Also, in Berlin selber habe ich so einen Prostata-Atlas, Prostatiker-Atlas.
Weyh: Das gibt es wirklich?
Cailloux: Na ja, es gibt halt Stellen, man geht in die Bank, man geht in die Post, das ist hier etwas humaner. Also, ich fand das in New York doch schon, diese Entdeckung fand ich dann doch schon unangenehm, weil es geht natürlich nicht, man kann sich nicht irgendwo im Freien da…
Weyh: Es gibt einen brutalen Satz, nämlich: "New York ist eine gerontophobe Stadt, dämmerte mir. Wenn du hier alt bist, fühlt es sich an, als wärst du schmutzig."
Cailloux: Ja, klar, das gehört zum Altern dazu. Mir ist aufgefallen, dass eben auf den Straßen ab 15 Uhr eigentlich kaum noch ältere Menschen sind, die erledigen ihre Dinge vorher. Auch das Tempo ist ein bisschen zu schnell in den etwas wichtigeren Straßen. Es gibt natürlich vollkommen verlassene, ruhige, wenn man die Avenues runtergeht bis A, B, C, also nicht zum Hudson, sondern zum anderen Ufer, zum East River, da gilt das nicht.
Eine über Jahrzehnte gewachsene Vertrauenskrise
Weyh: Im Alter werden ja viele Menschen mild, resignativ, ich nenne es mal so. Ihr Held ist ein alter Linker und der kommt dann so in Szenen rein in Kalifornien, wo er mit so jungen Businessleuten redet, und die sagen dann, ach, dieses alt-linke Weltbild, geh weg mit dem, und dann sagt der Held: "Na, ja, ich nenne mein Verhältnis zum Kapitalismus eine über Jahrzehnte gewachsene Vertrauenskrise." Schöner Begriff. Haben Sie die immer noch, die Vertrauenskrise?
Cailloux: Im Moment wird ja alles abgelöst durch dieses Drama, das sich da abzeichnet. Insofern muss man im Moment eher sozusagen beten für die Industrie. Das war ja auch das Seltsame, der Roman kommt raus, natürlich ist der in den letzten drei Jahren geschrieben, und plötzlich geht die Realität, die wir bisher kannten, in die Knie, und da gelten einige Dinge vielleicht nicht so scharf, also, wie meine Kritik an dem Hyperkonsum, der einen in New York also nun wirklich überwältigt. Das sieht man also auf Schritt und Tritt, und jetzt sehen wir andere Bilder. Da wandelt sich die Kritik in Empathie, also, wie gesagt, sogar für VW oder andere Unternehmen.
Weyh: Nun sind Sie aber ein Autor, man muss es fast sagen, der ein bisschen von Pech verfolgt wird. Also, Sie haben relativ spät debütiert als Romanautor, ich glaube, mit 60. War ein fulminantes Debüt, dieses "Geschäftsjahr 1968/69", tolle Kritiken gekriegt, aber irgendwie nicht so richtig das Shooting, das man sich hätte erwarten müssen. Als Sie 70 wurden, schrieb die SZ ein Porträt, und da stand drin: "Kaum jemand schreibt so präzise und bitter witzig über die ökonomische Seite des Autoren-Daseins, ohne das Kleingedruckte des Armenrechts zu scheuen." Jetzt kommen Sie wieder in so eine blöde Situation: Das Buch ist seit drei Monaten quasi raus – und wieder zum falschen Zeitpunkt.
Cailloux: Nein, es ist jetzt einen Monat verspätet.
Weyh: Verspätet, ja, aber als E-Book ist es, glaube ich, schon …
Cailloux: Das gibt es die ganze Zeit, wird auch benutzt.
"Ich bin Fatalist"
Weyh: Haben Sie so ein bisschen einen melancholischen Blick auf das eigene Autoren-Dasein – es hätte auch besser laufen können?
Cailloux: Ich bin Fatalist. Also man hat ja diese neue Situation innerhalb von Sekunden begriffen. Wir waren am 14. März... und der Verlag fragt dann natürlich, ob es nicht besser ist, das Buch zu verschieben, dann stimmt man natürlich zu, weil die Buchhandlungen ja geschlossen waren in der BRD, also in Berlin waren sie so einen Spalt geöffnet, aber sonst geschlossen. Dann macht es ja keinen Sinn, das Buch auszuliefern. Das war also gedruckt und fertig und wird jetzt eben in dieser Woche ausgeliefert, wo halt die Buchläden überall wieder auf haben.
Wenn Sie sagen, Pech, also Glück oder Pech, ich nenne es lieber – ich glaube, das ist von Benn – mit Glück und Gegenglück, und das Gegenglück war natürlich schon das eine oder andere Mal festzustellen. Zum Beispiel das zweite Buch, das kam Ende Oktober 1989 raus: Eine Woche später fiel die Mauer, da war natürlich das Interesse vollkommen anders gelagert, neu eingestellt. Und das ist eigentlich jetzt so ähnlich. Aber Corona hin oder her: Ein Buch ist ein Buch und das wird halt länger da sein, und dann werden es halt Leute irgendwann entdecken, meinetwegen im August oder im Dezember, zu Weihnachten.
Weyh: An einer Formulierung hat man gemerkt, dass Sie ein wirklicher Westberliner Autor sind, nämlich Sie haben gerade von der BRD gesprochen im Gegensatz zu Berlin.
Cailloux: Ja, das habe ich extra für Sie gemacht.
Weyh: Vielen Dank, Bernd Cailloux! Ihr Roman "Der amerikanische Sohn" war bis heute nur als E-Book bei Suhrkamp erhältlich für 18,99 Euro, ab Montag gibt es das Buch in Papierform, da kostet es dann 22 Euro, das sind dann konventionell gerechnet 224 Seiten, die man lesen kann – und sollte, füge ich hinzu.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandfunk Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.