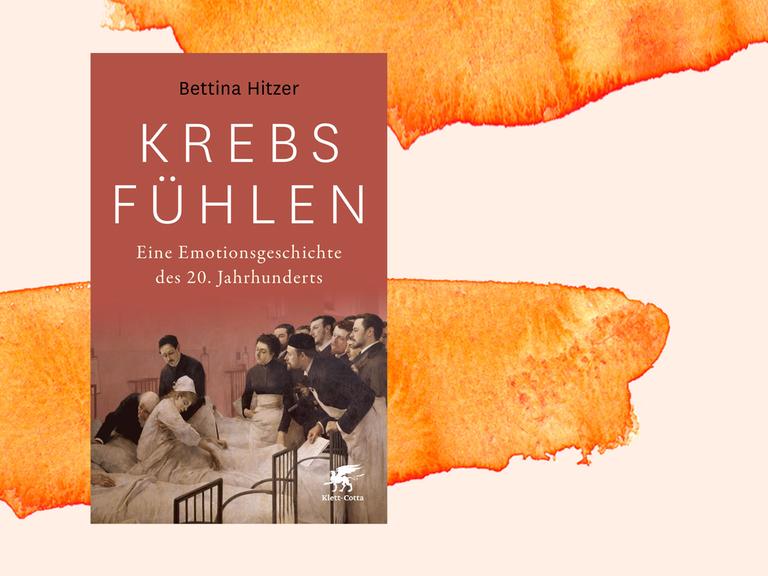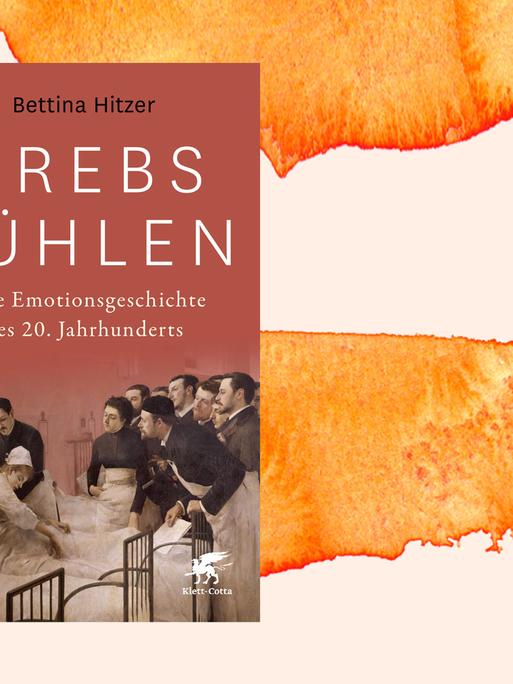Bettina Hitzer "Krebs fühlen - Eine Emotionsgeschichte des 20. Jahrhunderts"
Klett-Cotta, Stuttgart 2020
540 Seiten, 28 Euro
Angst und Hoffnung: Revolution der Gefühle
09:55 Minuten

Die Diagnose Krebs löst bei Patienten Schrecken, Angst und Hoffnung aus. Die Wahrnehmung dieser Gefühle habe sich aber stark verändert, erzählt die Historikerin Bettina Hitzer. Für ihr Buch wertete sie viele Quellen aus und sprach mit Betroffenen.
Joachim Scholl: Eine halbe Million Menschen trifft es jedes Jahr in Deutschland: sie haben Krebs. Trotz der inzwischen sehr viel besseren Heilungschancen löst diese Krankheit immer noch bei den meisten Schrecken aus. Das ist das eine Gefühl, das man mit Krebs verbindet, und die Historikerin Bettina Hitzer hat in ihrem Buch "Krebs fühlen" nun eine Vielzahl von Gefühlen in den Blick genommen. Jetzt ist die Autorin bei uns zu Gast. Eine "Emotionsgeschichte des 20. Jahrhunderts", so untertiteln Sie Ihr Buch. Wie schreibt man denn die Geschichte von Gefühlen?
Hitzer: Zunächst denkt man natürlich, das sei sehr schwer, und das ist natürlich auch anspruchsvoll, aber es ist nicht so schwer, wie ich das ursprünglich gedacht habe, denn tatsächlich findet man in Quellen, in historischen Dokumenten sehr viel mehr über Gefühle, als ich das zunächst angenommen habe.
Bei der Emotionsgeschichte geht es ja nicht nur um die Gefühle, die dieser oder jener Mensch gefühlt hat, sondern es geht auch darum, etwas darüber herauszufinden, welche Einschätzung von Gefühlen man in der Gesellschaft hatte, mit welchen moralischen Bewertungen bestimmte Gefühle belegt worden sind, wie sich aber auch in der Wissenschaft, Psychologie, Medizin, Physiologie die Funktionsweise von Gefühlen vorgestellt hat.
Darüber findet man sehr viel in historischen Dokumenten, in Fachzeitschriften, in Patientenakten, in den Archiven, sowohl in Krankenhausarchiven als auch in politischen Archiven im Bundesarchiv. Man findet natürlich auch über diese ganz persönlichen Gefühle einige Quellen, Briefe, die ebenfalls in Patientenakten abgelegt worden sind, Selbsterzählungen, die publiziert worden sind, Selbsterzählungen, die aber auch in Tagebucharchiven archiviert worden sind, und nicht zuletzt gibt es auch die Möglichkeit, Interviews zu führen, also oral history zu machen.
Vielfältig und berührend
Scholl: Sie beschäftigen sich ja schon länger mit dem Thema, Frau Hitzer. Ihr Buch ist jetzt die überarbeitete Fassung einer Habilitationsschrift. Wie sind Sie als Historikerin denn überhaupt auf dieses Thema gekommen, die Gefühlsgeschichte einer Krankheit zu schreiben?
Hitzer: Ursprünglich war das gar nicht meine Absicht, sondern mein ursprünglicher Plan war es, eine Geschichte der Versehrtheit im 20. Jahrhundert zu schreiben und da auch eine emotionshistorische Perspektive mit hineinzubringen.
Ich habe dann aber fast ein wenig zufällig angefangen mit der Krankheit Krebs als eine Versehrtheit im 20. Jahrhundert und habe dann festgestellt, dass dieses Thema so vielfältig ist. Das hat mich auch so fasziniert und berührt, dass ich dann gesagt habe, das ist die Geschichte, die ich schreiben möchte.
Scholl: Sie schreiben im Grunde sogar vier Emotionsgeschichten, wie man den Krebs erklärt und erforscht, wie man ihn erkennt, wie man über ihn spricht und wie man ihn erfährt. Das sind ganze Kränze von verschiedenen Gefühlen. Ich würde gerne mal bei zwei Gefühlen bleiben, die jeder Patient und Angehörige durchleidet, das ist zunächst die Angst. Wie hat sich denn dieses Gefühl historisch verändert?
Hitzer: Also meine Geschichte fängt im späten 19. Jahrhundert an. Man kann feststellen, dass es dort einerseits so eine physiologische Vorstellung von Angst gab, also die Frage, wie reagiert der Körper, wenn ich Angst habe. Und dieses Gefühl wurde von Ärzten durchaus als problematisch angesehen, weil sie gesehen haben, der Stoffwechsel ändert sich, wenn ich Angst empfinde. Das muss ich berücksichtigen, wenn ich zum Beispiel operiere, dann brauche ich mehr Schmerzmittel, mehr Narkosemittel, wenn der Mensch Angst hat. Also muss ich versuchen, den Patienten so vorzubereiten, dass er möglichst keine Angst empfindet.
Ein Weltkrieg verändert die Sichtweise auf Ängste
Das traf sich dann auch mit der Vorstellung, dass man dem Patienten nicht sagen sollte, dass er Krebs hat. Insofern war die Angst Anfang des 20. Jahrhunderts schon auch ein problematisches Gefühl. Aber als psychologisches Gefühl, als Alltagsgefühl war die Angst eher unproblematisch. Also man hatte die Vorstellung, Menschen empfinden Angst, aber wenn sie ordentlich erzogen worden sind, wenn ihr Charakter ordentlich gebildet worden ist, dann wissen sie auch, wie sie mit dieser Angst umzugehen haben. Sie werden durch Mut diese Angst bewältigen können.
Diese relativ unproblematische Sicht auf Angst änderte sich mit dem Ersten Weltkrieg und der Feststellung, dass Angst Menschen nachhaltig verstören kann, auch zu psychischen und möglicherweise auch körperlichen Störungen führen kann. Das ist dann eine Frage, die in den 20er-Jahren unter Psychosomatikern sehr viel diskutiert worden ist. Gibt es Krankheiten, die durch Angst ausgelöst werden? Sind nicht vielleicht alle Krankheiten Angstkrankheiten?
Diese Lesart setzte sich dann eigentlich erst in den 50er-, 60er-Jahren durch, auch durch die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Durch die Annahme, der Nationalsozialismus sei ganz besonders durch die Manipulation von Gefühlen zustande gekommen, verkomplizierte sich die Sicht auf Angst. Angst wurde doch deutlich mehr auch mit Panik, mit Irrationalität gleichgesetzt, und damit wurden die Bemühungen noch stärker als zuvor, Angst möglichst zu vermeiden, nicht über angsterregende Phänomene, wie zum Beispiel Krebs zu sprechen.
Angst ist auch ein Gefühl der Erkenntnis
Man kann dann wiederum einen Wandel feststellen in den 60er-, 70er-Jahren im Zusammenhang mit der Studentenbewegung, den neuen Bürgerbewegungen, die so eine Kultur der emotionalen Expressivität neu eingeführt haben. Die Vorstellung, man muss über Gefühle sprechen, damit man sie bewältigen kann einerseits – da ist also das psychoanalytische, psychotherapeutische Modell im Hintergrund –, zum anderen aber auch, Angst ist ein zutiefst menschliches Gefühl und auch ein Gefühl der Erkenntnis. Hans Jonas sprach von der Heuristik der Furcht. Angst gibt mir die Möglichkeit, die Welt, so wie sie ist, zu erkennen.
Scholl: Diese mittlerweile starke Akzeptanz von Gefühlen, Sie sprechen auch von einem "emotional turn", der sich auch in den Gesellschaften vollzogen hat, das heißt also, man enttabuisiert Gefühle, man spricht offen darüber. Hat das auch zu einer neuen Sichtbarkeit der Krankheit geführt? Früher versteckte man sogar die Krankheit vor den Kranken, heute muss sich niemand verstecken, und sie wird auch nicht von anderen versteckt wie früher.
Hitzer: Ja, das kann man schon so sagen. Also wenn man den "emotional turn" nicht erst um 2000 ansetzt, sondern eigentlich auch schon in den 60er-, 70er-Jahren, als die Psychologie, die Neurowissenschaften die Emotionen als Thema immer mehr entdeckten, dann trifft das in jedem Fall zu. Diese Feststellung oder diese Annahme, man soll über Gefühle sprechen, insbesondere über negative Gefühle – Gespräche helfen gegen die Angst –, hat dazu geführt, auch über eine Krankheit zu sprechen, die sehr viel auch mit diesen negativen Gefühlen zu tun hat. Da gibt es noch eine andere Entwicklung, die dazugehört, das ist die Veränderung der Hoffnung, die dabei auch eine Rolle spielt.
Chemotherapie als neues Regime der Hoffnung
Scholl: Ich wollte Sie gerade drauf ansprechen, sozusagen diese Entsprechung von der Angst zur Hoffnung. Bei der Hoffnung denkt man ja immer, dadurch, dass viele Krebserkrankungen heute heilbar sind oder der Krankheitsverlauf sich doch sehr positiv verlangsamen oder steuern lässt, dass dieser eindrucksvolle medizinische Fortschritt sich dann doch, sagen wir mal, auf die Hoffnungen der Patienten sehr gut ausgewirkt hat. Eigentlich hofft man heute weitaus positiver als noch vor 100 Jahren.
Hitzer: Das ist sicherlich richtig. Die Heilungschancen haben sich, zumindest für eine ganze Reihe von Krebserkrankungen stark verbessert und damit natürlich auch der Grund zu hoffen. Aber man kann beobachten, dass auch schon in den 50er-, 60er-Jahren eine sehr intensive Diskussion über Hoffnung einsetzt, über die Frage, was bedeutet Hoffnung? Kann ich weiterleben, wenn mir die Hoffnung zu überleben genommen ist? Gibt es auch kleine Hoffnungen? Die Hoffnung auf den nächsten Tag, auf einen nächsten guten Moment. Kann mir das helfen zu leben, selbst wenn ich weiß, ich muss bald sterben? Das ist eine sehr wichtige Entwicklung, was die Hoffnung betrifft.
Auf der anderen Seite gibt es auch einen Zusammenhang zur Chemotherapie, die in den 60er-, 70er-Jahren eingeführt worden ist und heute mittlerweile zur Standardtherapie geworden ist, die ein neues, könnte man sagen, Regime der Hoffnung mit sich gebracht hat. Dadurch, dass es nun eine Vielzahl von Möglichkeiten gab, eine Krankheit wie Krebs zu behandeln, war auch dieser Moment, wir können nichts mehr tun, immer weiter in die Zukunft hinausgeschoben worden. Es gab immer noch eine Möglichkeit, ein neues Chemotherapeutikum auszuprobieren, eine neue Kombination.
Dadurch kann man auch feststellen, dass die Entscheidung gegen die Chemotherapie und damit auch die Entscheidung gegen die Überlebenshoffnung ein ganz neues Phänomen gewesen ist, dass man diese Entscheidung bewusst treffen muss und sagen muss, ich will mich von dieser Art von Hoffnung, immer wieder neuer Hoffnung, verabschieden, um ein Leben bis zu meinem Tod zu führen, das dann vielleicht von einer anderen Art von Hoffnung getragen ist.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandfunk Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.