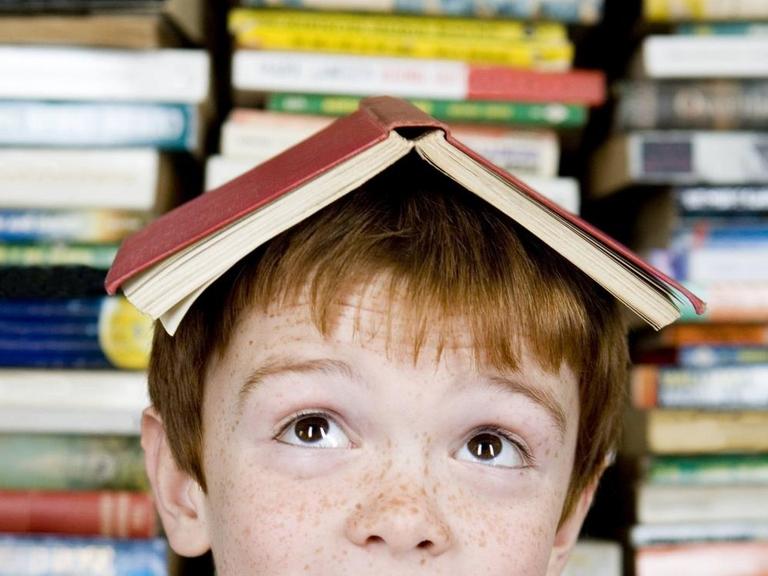Andrea Roedig ist Philosophin und Publizistin. Sie ist Mitherausgeberin der österreichischen Kultur- und Literaturzeitschrift "Wespennest". 2015 erschien ihr gemeinsam mit Sandra Lehmann verfasster Interviewband "Bestandsaufnahme Kopfarbeit" und kürzlich ihr Essayband "Schluss mit dem Sex" beide im Klever Verlag.
Bedrohte Biotope sozialer Vielfalt
04:02 Minuten

Was geht wieder, was noch nicht? In der Diskussion um die Coronamaßnahmen vergessen wir die öffentlichen Lesesäle. Dabei sind sie besonders schützenswerte Räume, findet die Philosophin Andrea Roedig.
Nicht nur für Wissenschaftlerinnen, für viele Menschen sind Büchereien und Bibliotheken ein zentrales Arbeitsmittel und ein Arbeitsraum. Der war in den vergangenen beiden Monaten und bleibt auch jetzt noch weitgehend verschlossen, ohne dass man sich in der Öffentlichkeit laut beklagte.
Um die Büchereien und Bibliotheken blieb es, wie es ihrem Wesen entspricht: ruhig und still. Natürlich sind mittlerweile viele wissenschaftliche Aufsätze und viel Literatur aller Art online zu erhalten und auch die Bibliotheken machten kräftig mit beim lockdownbedingten Digitalschub: "Besuchen Sie unseren digitalen Lesesaal", heißt es auf diversen Hompages. Aber dieser Lesesaal enthält, wie man recht schnell bemerkt, bei weitem nicht alles, was die Bibliothek sonst noch zu bieten hätte.
Letzte Oasen der Gemeinschaftlichkeit
Bibliotheken sind Sammlungen. Die Idee eines World Wide Web existierte in ihnen schon zweieinhalb Jahrtausende vor der Digitalisierung. Später entwickelte sich am Buch und der Bibliothek auch die Utopie eines sich immer weiter öffnenden Zugangs zu Wissen und die geniale Idee des Gemeinschaftsguts.
Die Ausleihe verspricht uns: Bücher, Zeitschriften, DVDs haben zu können, ohne sie besitzen zu müssen; das Glück auch, durch Regalreihen gehen und mitnehmen zu können, so viel man will: ausprobieren, verwerfen, hineinlesen.

Andrea Roedig© Elfie Miklautz
Darüber hinaus sind Bibliotheken einzigartige soziale Orte. Wer oft hingeht, kennt bald die Bibliothekare als vertraute Gestalten und die Mitbenutzerinnen im Lesesaal. Sartre beschreibt in seinem Roman "Der Ekel" wunderbar eine typische Bibliotheksgestalt: den Autodidakten, der sich Tag um Tag in den Lesesaal begibt, um die dort aufgestellten Werke der Reihe nach von A bis Z durchzuarbeiten.
Egal wie unterschiedlich die Leseplätze gestaltet sind, ob als riesige wissenschaftlichen Ernst ausstrahlende Studierhallen, oder ob sie nur aus in engen Gängen aufgestellten Tischchen bestehen, sie alle verbinden die einsame Tätigkeit des Lesens mit Gemeinschaftlichkeit. Der Lesesaal ist – paradoxerweise – ein öffentlicher Rückzugsort, und für viele auch Versicherung beim Studieren: Ich mache das nicht allein. Wenn uns die Coronakrise eines lehrt, dann, wie unerhört vieles online möglich ist, aber auch, wie viel verloren geht, wenn wir gewohnt physische Begegnung digital abhandeln müssen.
Stärkung gesellschaftlichen Wohlseins
Das gilt auch für Bibliotheken und noch viel mehr für ihre öffentlicheren Schwestern: die städtischen Büchereien. Sie sind mehr als nur ein Ausleihbetrieb. Sie sind neben den Kirchen die letzten nicht-kommerziellen öffentlichen Aufenthaltsräume. Gerade die Stadtteilbüchereien wissen das. Nirgends sonst findet sich ein so gemischtes Publikum: Obdachlose, die Zeitung lesen, Jugendliche, die lernen wollen, Journalistinnen, die recherchieren.
Im Grunde ist die Bibliothek kein Arbeits-, sondern ein Lebensraum, ein Biotop für allerlei Geschöpfe. Wer einmal die Warteschlangen gesehen hat, die sich täglich am Pariser Centre Pompidou bildeten, weil Menschen in die Bibliothèque publique d'information wollten, weiß, wie groß die Nachfrage ist.
Systemrelevant? Bibliotheken und Büchereien tragen wesentlich zur geistigen, psychischen und sozialen Gesundheit einer Gesellschaft bei. Es sollte viel lauter um diese Orte werden.