Börse und Höhenflug der Linken
Welch ein Abstieg. Um 15 Prozent ist der deutsche Aktienindex seit Jahresanfang gefallen. Der Sturzflug wird noch vom Dow Jones und vom Nikkei überflügelt - was für sein Ende nichts Gutes verheißt. Und er wird, wenn die Auguren Recht behalten, die deutsche Wirtschaft mit sich hinunterziehen.
Welch ein Aufstieg. Mit sieben und fünf Prozent ist die Linkspartei in Niedersachsen und in Hessen in die Landtage eingezogen. Um knapp acht Prozent hat Andrea Ypsilanti den Wählerzuspruch zur SPD in Hessen gesteigert. Für eine Partei, die in den letzten Jahren Siege vornehmlich an der Leichtigkeit der Verluste maß, ist das ein fulminantes Ergebnis. Der Erfolg ist umso strahlender, als er von einem politisch recht kleinen Licht bewerkstelligt wurde.
Die Ypsilantis, das war zu Gerhard Schröders Zeiten noch ein Schmähwort für alle linkskonservativen Widersacher in der Partei. Durch das Wahlergebnis wurde es zum Yps-Faktor geadelt, zur Zauberformel auch künftiger sozialdemokratischer Erfolge. Mit links will man sie nun erzielen, denn links weiß man sich in Einklang mit einer gesellschaftlichen Grundströmung, die schon seit Längerem in die gleiche Richtung driftet.
Der Aufstieg der politischen Linken und der Niedergang der Börse – auf den ersten Blick stehen diese beiden aktuellen Bewegungen in keinem erkennbaren Zusammenhang.
Das eine vollzieht sich in den Sphären der Ökonomie, auf den virtueller Märkten der globalisierten Finanzen, orientiert am Gewinn und das andere in der nationalen Sphäre der Politik, orientiert an Werten und ausgetragen in den überschaubaren Räumen des Parteienwettbewerbs. Es lässt sich keine ursächliche Verbindungslinie ziehen.
Und doch besteht zwischen den Amplituden der Börsen, den Konjunkturen der Wirtschaft und den Schwenks der Politik eine eigentümliche asymmetrische Einflussbeziehung. Die wird spätestens dann wieder zum Tragen kommen, wenn der derzeitige Börsencrash auf die Realwirtschaft niederschlägt, wenn das Wachstum sich verlangsamt und die Zahl der Entlassenen die der Eingestellten übersteigt. Dann kommt wieder ein Kreislauf in Gang, der den Optionsraum der Politik einengt. Finanziell, aber vor allem mental. Die Zuversicht wird der Skepsis Platz machen. Die Angst vor einer Rezession wird einhergehen mit sinkender Konsumlaune. Das Vertrauen auf die Stärke des Standortes wird wieder der Sorge um ihn weichen und das Wort Reform wird den bitteren Beigeschmack bekommen, den viele gerade erst runtergeschluckt haben.
Das sind keine guten Zeiten für eine linke Politik, die eine Umverteilung der Einkommen, eine Umschichtung der Staatseinnahmen und -ausgaben und eine stärkere Regulierung der Wirtschaft in den Blick nimmt. Denn eine solche Politik kann nur gelingen, wenn das kapitalistische System, dessen Mängel sie beheben will, prosperiert. Ignoriert sie diesen Zusammenhang, erfährt sie den hinhaltenden Widerstand der Wirtschaft, sinkt ihre gesellschaftliche Akzeptanz und damit letztlich Gestaltungsmacht.
Schon mehrfach ließ sich diese Dynamik beobachten. In ihrer zweiten Amtszeit verlor die Regierung Brandt den gesellschaftlichen Rückhalt, als sich das Reformprogramm nicht mehr auf eine entsprechende Wirtschaftskraft stützen konnte. Exorbitante Lohnforderungen der ÖTV und Protestrücktritte der zuständigen Minister leiteten das Ende der Ära Brandt ein.
Auch mit der neuen Leichtigkeit rot-grünen Regierens war es schnell vorbei, als im Jahr 2000 die Börse kollabierte und in Folge die Wirtschaft stagnierte. Erst mit dreijähriger Verspätung folgte dem die Politik, indem sie das Sozialsystem reformierte.
Es ist eine ironische Wendung der jüngsten sozialdemokratischer Geschichte, dass sie diesen Reformkurs nun wiederum revidierte, als er erste Früchte trug. Der Linksschwenk nahm Gestalt an, als die exorbitanten Gehälter der Vorstände und die miserablen Löhne vieler Beschäftigter der alten Verteilungsfrage neue Nahrung gaben und das Wachstum der Wirtschaft eine positive Antwort ermöglichte. Doch dieser Trend scheint nun abzuebben, noch bevor die Linke die Mehrheit für diese Antwort gefunden hat.
Das "window of opportunity" für ihre Politik beginnt sich zu schließen. Die Linke wird versuchen, es offen zu halten. Sie wird auf dem Primat der Politik gegenüber der Wirtschaft bestehen. Dabei hat doch die Schließung des Nokia-Werkes in Bochum gerade wieder deutlich gemacht, wie wenig dieser Primat die Wirtschaft beeindruckt. Nicht wer Wahlen gewinnt, sondern wer den Standort wählen kann, hat die Macht. Gegen dieses materialistische Credo der Wirtschaft erklingt das idealistische Crescendo der Linken, dass nichts so mächtig sei, wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Doch Viktor Hugo, den Oskar Lafontaine gerne damit zitiert, musste schon zu seiner Zeit erleben, wie der Elan der Linken regelmäßig an den ökonomischen Fakten zerbrach. Bis sie diese im Revisionismusstreit anerkannte. Es wäre an der Zeit für eine dem 21. Jahrhundert angemessene Idee, wie das politische Wollen sich so mit den ökonomischen Konjunkturen synchronisiert, das es nicht immer den Kürzeren zieht.
Dieter Rulff, Journalist, Jahrgang 1953, studierte Politikwissenschaft in Berlin und arbeitete zunächst in der Heroinberatung in Berlin. Danach wurde er freier Journalist und arbeitete im Hörfunk. Weitere Stationen waren die "taz" und die Ressortleitung Innenpolitik bei der Hamburger "Woche". Vom März 2002 bis Ende 2005 arbeitete Rulff als freier Journalist in Berlin. Er schreibt für überregionale Zeitungen und die Neue Gesellschaft/ Frankfurter Hefte. Ab 1. Januar 2006 Redakteur der Zeitschrift "Vorgänge".
Die Ypsilantis, das war zu Gerhard Schröders Zeiten noch ein Schmähwort für alle linkskonservativen Widersacher in der Partei. Durch das Wahlergebnis wurde es zum Yps-Faktor geadelt, zur Zauberformel auch künftiger sozialdemokratischer Erfolge. Mit links will man sie nun erzielen, denn links weiß man sich in Einklang mit einer gesellschaftlichen Grundströmung, die schon seit Längerem in die gleiche Richtung driftet.
Der Aufstieg der politischen Linken und der Niedergang der Börse – auf den ersten Blick stehen diese beiden aktuellen Bewegungen in keinem erkennbaren Zusammenhang.
Das eine vollzieht sich in den Sphären der Ökonomie, auf den virtueller Märkten der globalisierten Finanzen, orientiert am Gewinn und das andere in der nationalen Sphäre der Politik, orientiert an Werten und ausgetragen in den überschaubaren Räumen des Parteienwettbewerbs. Es lässt sich keine ursächliche Verbindungslinie ziehen.
Und doch besteht zwischen den Amplituden der Börsen, den Konjunkturen der Wirtschaft und den Schwenks der Politik eine eigentümliche asymmetrische Einflussbeziehung. Die wird spätestens dann wieder zum Tragen kommen, wenn der derzeitige Börsencrash auf die Realwirtschaft niederschlägt, wenn das Wachstum sich verlangsamt und die Zahl der Entlassenen die der Eingestellten übersteigt. Dann kommt wieder ein Kreislauf in Gang, der den Optionsraum der Politik einengt. Finanziell, aber vor allem mental. Die Zuversicht wird der Skepsis Platz machen. Die Angst vor einer Rezession wird einhergehen mit sinkender Konsumlaune. Das Vertrauen auf die Stärke des Standortes wird wieder der Sorge um ihn weichen und das Wort Reform wird den bitteren Beigeschmack bekommen, den viele gerade erst runtergeschluckt haben.
Das sind keine guten Zeiten für eine linke Politik, die eine Umverteilung der Einkommen, eine Umschichtung der Staatseinnahmen und -ausgaben und eine stärkere Regulierung der Wirtschaft in den Blick nimmt. Denn eine solche Politik kann nur gelingen, wenn das kapitalistische System, dessen Mängel sie beheben will, prosperiert. Ignoriert sie diesen Zusammenhang, erfährt sie den hinhaltenden Widerstand der Wirtschaft, sinkt ihre gesellschaftliche Akzeptanz und damit letztlich Gestaltungsmacht.
Schon mehrfach ließ sich diese Dynamik beobachten. In ihrer zweiten Amtszeit verlor die Regierung Brandt den gesellschaftlichen Rückhalt, als sich das Reformprogramm nicht mehr auf eine entsprechende Wirtschaftskraft stützen konnte. Exorbitante Lohnforderungen der ÖTV und Protestrücktritte der zuständigen Minister leiteten das Ende der Ära Brandt ein.
Auch mit der neuen Leichtigkeit rot-grünen Regierens war es schnell vorbei, als im Jahr 2000 die Börse kollabierte und in Folge die Wirtschaft stagnierte. Erst mit dreijähriger Verspätung folgte dem die Politik, indem sie das Sozialsystem reformierte.
Es ist eine ironische Wendung der jüngsten sozialdemokratischer Geschichte, dass sie diesen Reformkurs nun wiederum revidierte, als er erste Früchte trug. Der Linksschwenk nahm Gestalt an, als die exorbitanten Gehälter der Vorstände und die miserablen Löhne vieler Beschäftigter der alten Verteilungsfrage neue Nahrung gaben und das Wachstum der Wirtschaft eine positive Antwort ermöglichte. Doch dieser Trend scheint nun abzuebben, noch bevor die Linke die Mehrheit für diese Antwort gefunden hat.
Das "window of opportunity" für ihre Politik beginnt sich zu schließen. Die Linke wird versuchen, es offen zu halten. Sie wird auf dem Primat der Politik gegenüber der Wirtschaft bestehen. Dabei hat doch die Schließung des Nokia-Werkes in Bochum gerade wieder deutlich gemacht, wie wenig dieser Primat die Wirtschaft beeindruckt. Nicht wer Wahlen gewinnt, sondern wer den Standort wählen kann, hat die Macht. Gegen dieses materialistische Credo der Wirtschaft erklingt das idealistische Crescendo der Linken, dass nichts so mächtig sei, wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Doch Viktor Hugo, den Oskar Lafontaine gerne damit zitiert, musste schon zu seiner Zeit erleben, wie der Elan der Linken regelmäßig an den ökonomischen Fakten zerbrach. Bis sie diese im Revisionismusstreit anerkannte. Es wäre an der Zeit für eine dem 21. Jahrhundert angemessene Idee, wie das politische Wollen sich so mit den ökonomischen Konjunkturen synchronisiert, das es nicht immer den Kürzeren zieht.
Dieter Rulff, Journalist, Jahrgang 1953, studierte Politikwissenschaft in Berlin und arbeitete zunächst in der Heroinberatung in Berlin. Danach wurde er freier Journalist und arbeitete im Hörfunk. Weitere Stationen waren die "taz" und die Ressortleitung Innenpolitik bei der Hamburger "Woche". Vom März 2002 bis Ende 2005 arbeitete Rulff als freier Journalist in Berlin. Er schreibt für überregionale Zeitungen und die Neue Gesellschaft/ Frankfurter Hefte. Ab 1. Januar 2006 Redakteur der Zeitschrift "Vorgänge".
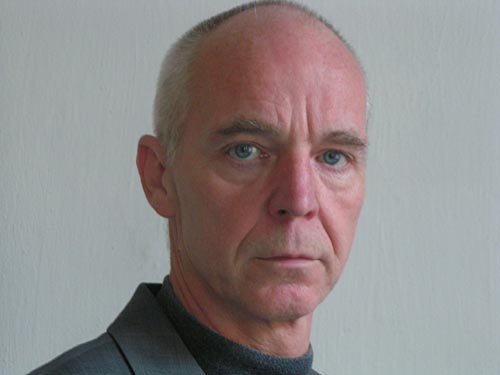
Dieter Rulff© privat