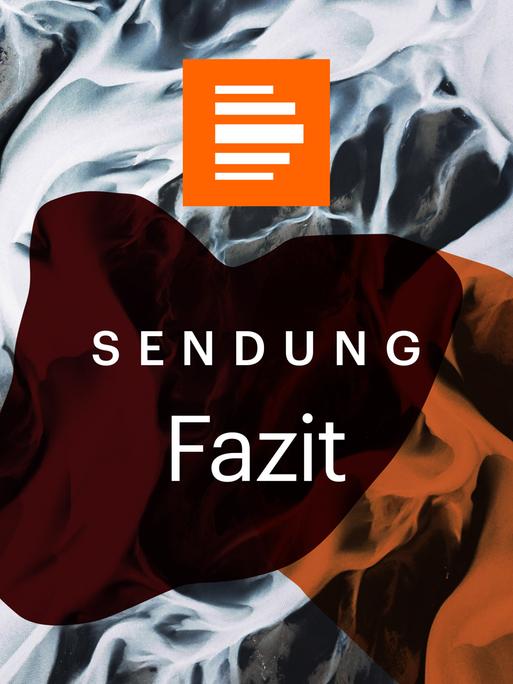Brasilien und die Welt
Mit ihrem Sammelband zeigen die Herausgeber, wie sehr Geschichte, Kultur und Selbstverständnis Brasiliens mit globalen Strömungen verflochten sind - etwa mit dem Interesse an fremden Kulturen, aber auch der Kehrseite, dem Rassismus.
Brasilien hat seit jeher eine Sonderstellung auf dem amerikanischen Subkontinent inne: Das größte Land Lateinamerikas spricht nicht nur eine andere Sprache, seine historische Entwicklung ist auch deutlich anders verlaufen als die seiner lateinamerikanischen Nachbarn. Das lässt sich anhand der weitgehend unblutigen Entkolonisierung und der nachfolgenden staatlichen Konsolidierung belegen.
Wie sehr dennoch Geschichte, Kultur, Wissenschaft und Selbstverständnis Brasiliens mit weltweiten Strömungen im Zusammenhang stehen, versuchen die vier Herausgeber dieses Sammelbandes aufzuzeigen.
Der Zeitraum, den sie sich vorgenommen haben, erstreckt sich von etwa 1870, der Zeit sich etablierender wissenschaftlicher Institutionen und der Entstehung einer neuen republikanischen politischen Ordnung in Brasilien, bis 1945, als der Kalte Krieg begann, die Geopolitik zu verändern und neue ideologische Fronten aufzubauen.
Diese zeitliche Einschränkung hat vor allem dann ihren Sinn, wenn man, was die Herausgeber explizit wollen, die Globalgeschichte im Blick hat, wie Stefan Rinke, Historiker an der Freien Universität Berlin, schreibt:
"Die Geschichte Lateinamerikas im hier interessierenden Zeitraum kann in der Tat als Prozess wachsender Verflechtungen mit der Welt gelesen werden. Die moderne Historiografie interpretiert die Jahre von 1870 bis 1914 als Phase intensiver Globalisierung, während die Jahre von 1914 meist als Bruch verstanden werden."
Zu den globalen Strömungen, die mit Brasiliens Entwicklung korrespondieren, gehört das Interesse an fremden Kulturen ebenso wie deren Kehrseite, der Rassismus. Gleich mehrere Aufsätze in diesem Band verweisen auf die deutsch-brasilianischen Beziehungen und zeigen, wie sehr die wilhelminische "Deutschtumspolitik", die sich über Siedler in Übersee weltweiten Einfluss sichern wollte, dem damals vorherrschenden Rassendenken entsprach.
Debora Gerstenberg würdigt den bekannten Sozialwissenschaftler Gilberto Freyre, der den Klassiker "Herrenhaus und Sklavenhütte" von 1933 verfasste. Er sah in der spezifisch brasilianischen Vermischung von Nachfahren afrikanischer Sklaven, portugiesischer Kolonialherren, Indigener und europäischer Siedler eine "Rassendemokratie" und widersprach damit der Vorstellung von Nationalstaatlichkeit auf der Grundlage der Abstammung.
In diesem Zusammenhang meint auch der Lateinamerikanist Sergio Costa, der die prägenden Selbsterzählungen Brasiliens im frühen 20. Jahrhundert untersucht:
"Die Unvereinbarkeit der aus Europa rezipierten Rassentheorien mit der Absicht, das Projekt einer 'modernen' Nation aufzubauen, war offensichtlich. Schließlich wurde das Land überwiegend von jenem Teil der Menschheit bewohnt, der nach den Rassentheoremen als unterlegen betrachtet wurde. Eine wörtliche Übernahme der aus Europa kommenden Theorien hätte das nationale Programm für unrealistisch erklären müssen."
Brasilien blieb – im Gegensatz zu den spanisch kolonisierten Gebieten Südamerikas – nach seiner Unabhängigkeit 1822 eine politische Einheit, trotz aller regionalen Verschiedenheiten. Mit der Abschaffung der Sklaverei 1888 und dem Sturz der Monarchie wurde die Frage wesentlich, was dieses multiethnische Gebilde eigentlich zusammenhielt.
Die Auseinandersetzung mit dem Begriff der "Nation" nahm hier, befindet Costa, bestimmte Denkfiguren des 20. Jahrhunderts wie Postkolonialismus oder Multikulturalismus bereits vorweg. In der Praxis ging es dabei um Rassismus in der Einwanderungspolitik. Sehr detailliert untersucht der US-Amerikaner Jeffrey Lesser die Auswirkungen der 'mesticagem branqueadora', der "Aufweißung durch Vermischung".
Mit dem "Harlem Revival" in den 1920er-Jahren begannen sich schwarze US-Amerikaner für das Einwanderungsland Brasilien zu interessieren – ein Land, das offener und liberaler als die USA seiner schwarzen Bevölkerung mehr Chancen zu bieten schien.
Da die offizielle Einwanderungspolitik zwar zugegebenermaßen keine Chinesen und Afrikaner im Land haben wollte, Amerikaner aber selbstverständlich willkommen hieß, begann mit dem Einwanderungsersuchen dunkelhäutiger US-Bürger ein mehrjähriger diplomatischer Eiertanz des brasilianischen Außenministeriums.
"Das Bild einer 'Rassenharmonie' war nach Meinung der brasilianischen Politik wichtig, um ‚weiße’ Einwanderer und ausländische, meist US-amerikanische Investoren anzuziehen. (...) Der erste Versuch, das Problem zu lösen, war einfach: Es verweigerte einfach die Visa, ohne einen Grund zu nennen."
Diese unausgesprochene und ungesetzliche Praxis blieb auch in den Jahren des "Estado Novo" von 1937 bis 1945 unter dem populistischen Diktator Getulio Vargas üblich. Zu dieser Zeit lebte der Österreicher Stefan Zweig im brasilianischen Exil und schrieb kurz vor seinem Selbstmord 1942, das Buch "Brasilien, ein Land der Zukunft".
Brasilien "… hat erkannt, dass Raum Kraft ist und Kräfte erzeugt. (...) Und Raum ist nicht nur bloße Materie. Raum ist auch seelische Kraft. Er erweitert den Blick und erweitert die Seele (...); wo Raum ist, da ist nicht nur Zeit, sondern auch Zukunft."
Bemerkenswert unkritisch setzt sich die Brasilianerin Karen M. Lisboa in ihrem Aufsatz mit dieser europäisch geprägten Perspektive auseinander.
Daneben befassen sich die Beiträge auch mit kulturellen und eher randständigen Themen: Etwa mit der Geschichte des Capoeira, der brasilianischen Kampfkunst, mit neuen Großstadtkrankheiten wie der Neurasthenie in Sao Paulo oder mit der Propagierung des Milchtrinkens in den 1930er Jahren, das mangelndem Arbeitseifer, Unterentwicklung und Krankheiten vorbeugen sollte.
Dieser Band bündelt sein Thema nicht, sondern sammelt disparate Aspekte dazu in einem akademischen Lesebuch. Vollständig ist es nicht: Über die Stadtentwicklung, die zur Entstehung der Favelas führte, findet man darin nichts, auch nichts über die Lebensbedingungen der brasilianischen Indigenen, die der französische Ethnologe Levi-Strauss in den 1930er Jahren untersuchte und in seinem Buch "Traurige Tropen" in einen weltweiten Zusammenhang stellte. Beides hätte in der globalgeschichtlichen Betrachtung Brasiliens seinen Platz gehabt.
Zitat 1: Stefan Rinke, Deutschland und Brasilien 1871 bis 1945
Zitat 2: Sergio Costa, Nationalismus aus transnationaler Sicht
Zitat 3: Jeffrey Lesser, Sind Afroamerikaner Afrikaner oder Amerikaner?
Zitat 4: Stefan Zweig, zitiert nach Karen Macknow Lisboa, Europa und Brasilien im Blick zweier Reisender
Wie sehr dennoch Geschichte, Kultur, Wissenschaft und Selbstverständnis Brasiliens mit weltweiten Strömungen im Zusammenhang stehen, versuchen die vier Herausgeber dieses Sammelbandes aufzuzeigen.
Der Zeitraum, den sie sich vorgenommen haben, erstreckt sich von etwa 1870, der Zeit sich etablierender wissenschaftlicher Institutionen und der Entstehung einer neuen republikanischen politischen Ordnung in Brasilien, bis 1945, als der Kalte Krieg begann, die Geopolitik zu verändern und neue ideologische Fronten aufzubauen.
Diese zeitliche Einschränkung hat vor allem dann ihren Sinn, wenn man, was die Herausgeber explizit wollen, die Globalgeschichte im Blick hat, wie Stefan Rinke, Historiker an der Freien Universität Berlin, schreibt:
"Die Geschichte Lateinamerikas im hier interessierenden Zeitraum kann in der Tat als Prozess wachsender Verflechtungen mit der Welt gelesen werden. Die moderne Historiografie interpretiert die Jahre von 1870 bis 1914 als Phase intensiver Globalisierung, während die Jahre von 1914 meist als Bruch verstanden werden."
Zu den globalen Strömungen, die mit Brasiliens Entwicklung korrespondieren, gehört das Interesse an fremden Kulturen ebenso wie deren Kehrseite, der Rassismus. Gleich mehrere Aufsätze in diesem Band verweisen auf die deutsch-brasilianischen Beziehungen und zeigen, wie sehr die wilhelminische "Deutschtumspolitik", die sich über Siedler in Übersee weltweiten Einfluss sichern wollte, dem damals vorherrschenden Rassendenken entsprach.
Debora Gerstenberg würdigt den bekannten Sozialwissenschaftler Gilberto Freyre, der den Klassiker "Herrenhaus und Sklavenhütte" von 1933 verfasste. Er sah in der spezifisch brasilianischen Vermischung von Nachfahren afrikanischer Sklaven, portugiesischer Kolonialherren, Indigener und europäischer Siedler eine "Rassendemokratie" und widersprach damit der Vorstellung von Nationalstaatlichkeit auf der Grundlage der Abstammung.
In diesem Zusammenhang meint auch der Lateinamerikanist Sergio Costa, der die prägenden Selbsterzählungen Brasiliens im frühen 20. Jahrhundert untersucht:
"Die Unvereinbarkeit der aus Europa rezipierten Rassentheorien mit der Absicht, das Projekt einer 'modernen' Nation aufzubauen, war offensichtlich. Schließlich wurde das Land überwiegend von jenem Teil der Menschheit bewohnt, der nach den Rassentheoremen als unterlegen betrachtet wurde. Eine wörtliche Übernahme der aus Europa kommenden Theorien hätte das nationale Programm für unrealistisch erklären müssen."
Brasilien blieb – im Gegensatz zu den spanisch kolonisierten Gebieten Südamerikas – nach seiner Unabhängigkeit 1822 eine politische Einheit, trotz aller regionalen Verschiedenheiten. Mit der Abschaffung der Sklaverei 1888 und dem Sturz der Monarchie wurde die Frage wesentlich, was dieses multiethnische Gebilde eigentlich zusammenhielt.
Die Auseinandersetzung mit dem Begriff der "Nation" nahm hier, befindet Costa, bestimmte Denkfiguren des 20. Jahrhunderts wie Postkolonialismus oder Multikulturalismus bereits vorweg. In der Praxis ging es dabei um Rassismus in der Einwanderungspolitik. Sehr detailliert untersucht der US-Amerikaner Jeffrey Lesser die Auswirkungen der 'mesticagem branqueadora', der "Aufweißung durch Vermischung".
Mit dem "Harlem Revival" in den 1920er-Jahren begannen sich schwarze US-Amerikaner für das Einwanderungsland Brasilien zu interessieren – ein Land, das offener und liberaler als die USA seiner schwarzen Bevölkerung mehr Chancen zu bieten schien.
Da die offizielle Einwanderungspolitik zwar zugegebenermaßen keine Chinesen und Afrikaner im Land haben wollte, Amerikaner aber selbstverständlich willkommen hieß, begann mit dem Einwanderungsersuchen dunkelhäutiger US-Bürger ein mehrjähriger diplomatischer Eiertanz des brasilianischen Außenministeriums.
"Das Bild einer 'Rassenharmonie' war nach Meinung der brasilianischen Politik wichtig, um ‚weiße’ Einwanderer und ausländische, meist US-amerikanische Investoren anzuziehen. (...) Der erste Versuch, das Problem zu lösen, war einfach: Es verweigerte einfach die Visa, ohne einen Grund zu nennen."
Diese unausgesprochene und ungesetzliche Praxis blieb auch in den Jahren des "Estado Novo" von 1937 bis 1945 unter dem populistischen Diktator Getulio Vargas üblich. Zu dieser Zeit lebte der Österreicher Stefan Zweig im brasilianischen Exil und schrieb kurz vor seinem Selbstmord 1942, das Buch "Brasilien, ein Land der Zukunft".
Brasilien "… hat erkannt, dass Raum Kraft ist und Kräfte erzeugt. (...) Und Raum ist nicht nur bloße Materie. Raum ist auch seelische Kraft. Er erweitert den Blick und erweitert die Seele (...); wo Raum ist, da ist nicht nur Zeit, sondern auch Zukunft."
Bemerkenswert unkritisch setzt sich die Brasilianerin Karen M. Lisboa in ihrem Aufsatz mit dieser europäisch geprägten Perspektive auseinander.
Daneben befassen sich die Beiträge auch mit kulturellen und eher randständigen Themen: Etwa mit der Geschichte des Capoeira, der brasilianischen Kampfkunst, mit neuen Großstadtkrankheiten wie der Neurasthenie in Sao Paulo oder mit der Propagierung des Milchtrinkens in den 1930er Jahren, das mangelndem Arbeitseifer, Unterentwicklung und Krankheiten vorbeugen sollte.
Dieser Band bündelt sein Thema nicht, sondern sammelt disparate Aspekte dazu in einem akademischen Lesebuch. Vollständig ist es nicht: Über die Stadtentwicklung, die zur Entstehung der Favelas führte, findet man darin nichts, auch nichts über die Lebensbedingungen der brasilianischen Indigenen, die der französische Ethnologe Levi-Strauss in den 1930er Jahren untersuchte und in seinem Buch "Traurige Tropen" in einen weltweiten Zusammenhang stellte. Beides hätte in der globalgeschichtlichen Betrachtung Brasiliens seinen Platz gehabt.
Zitat 1: Stefan Rinke, Deutschland und Brasilien 1871 bis 1945
Zitat 2: Sergio Costa, Nationalismus aus transnationaler Sicht
Zitat 3: Jeffrey Lesser, Sind Afroamerikaner Afrikaner oder Amerikaner?
Zitat 4: Stefan Zweig, zitiert nach Karen Macknow Lisboa, Europa und Brasilien im Blick zweier Reisender
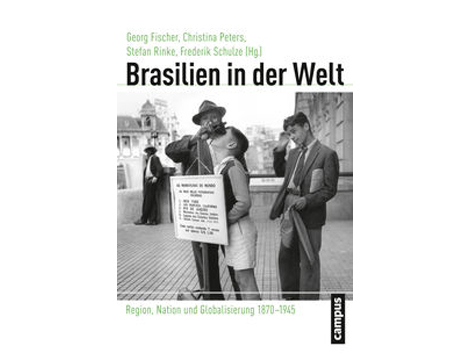
Cover - Rinke et al.: "Brasilien in der Welt"© Campus Verlag Frankfurt-New York
Georg Fischer, Christina Peters, Stefan Rinke, Frederick Schulze (Hg.): Brasilien in der Welt - Region, Nation und Globalisierung 1870-1945
Campus Verlag Frankfurt-New York, Mai 2013
350 Seiten, 39,90 Euro
Campus Verlag Frankfurt-New York, Mai 2013
350 Seiten, 39,90 Euro