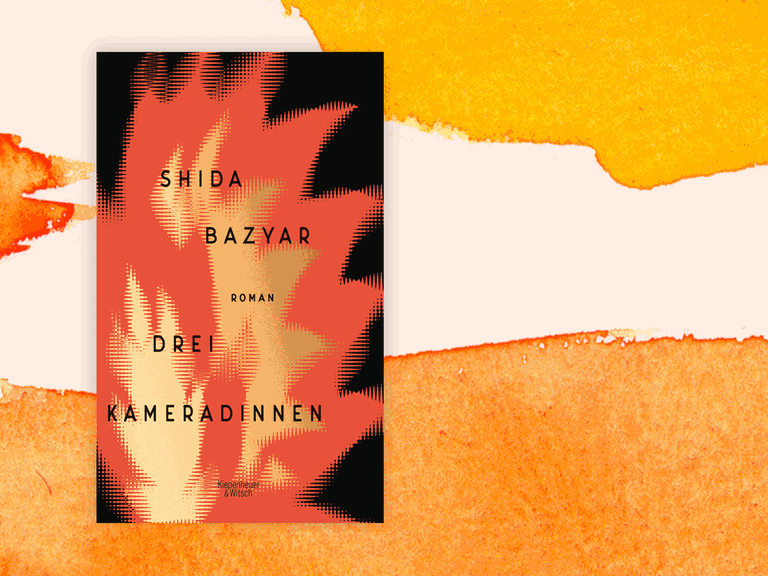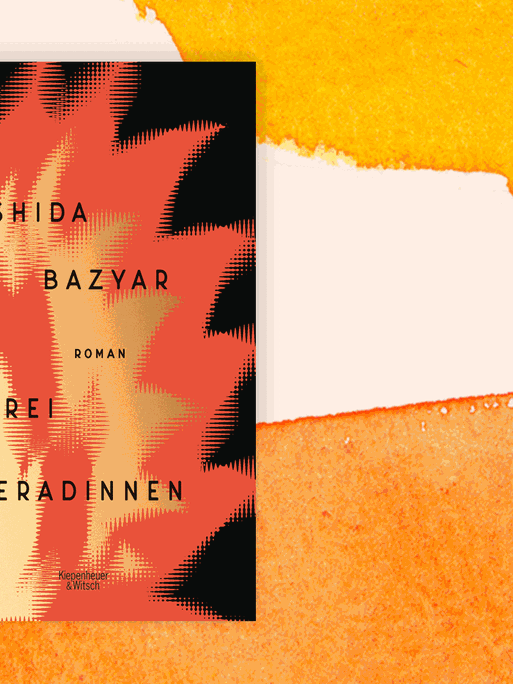Freiheit ist Freiheit, nicht Gleichheit oder Fairness oder Gerechtigkeit oder Kultur oder menschliches Glück oder ein ruhiges Gewissen.
Michael Bröning: "Vom Ende der Freiheit"

© Dietz Verlag
Fatale Folgeschäden einer Diskurs-Vermeidung
06:53 Minuten

Michael Bröning
Vom Ende der Freiheit. Wie ein gesellschaftliches Ideal auf Spiel gesetzt wirdDietz Verlag, Bonn 2021148 Seiten
18,00 Euro
Der Politikwissenschaftler Michael Bröning knöpft sich in seinem neuen Buch die Exzesse seines eigenen progressiven und linken Milieus vor. Dabei bleibt er ruhig, sachlich und unpolemisch.
Gleich zu Anfang stellt der Politikwissenschaftler Michael Bröning, Mitglied der SPD-Grundwertekommission und Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in New York, eines klar: Sein Buch „Vom Ende der Freiheit“ beschäftigt sich nicht mit den Gefahren, die durch Rechtsextremismus und Islamismus drohen, sondern wendet sich an dasjenige progressive Milieu, dem er selbst entstammt.
Erfreulicherweise ist sein Buch, das sich mit den blinden Flecken jener beschäftigt, die ihre Toleranz- und Diversitätsbereitschaft mitunter allzu monstranzenhaft vor sich her tragen, dennoch kein hämisches Abrechnungspamphlet, wie man es von manchen anderen „Ex-Linken“ kennt, die damit zumindest ihrer früheren Selbstgerechtigkeit treu geblieben sind.
In sieben Kapiteln beschäftigt sich Bröning mit Freiheitsgefährdungen im Inneren unserer Gesellschaft, als da wären Cancel Culture, politische Korrektheit und die zänkischen Auswüchse einer partikularistischen Identitätspolitik. Dies zu thematisieren, ist freilich ein Balanceakt, denn:
„Ist nicht der Ruf nach Freiheit mittlerweile die letzte Ausrede all jener Ewiggestriger, die unter Selbstverwirklichung schon immer einen Blankoscheck für das Loslassen des inneren Schweinehundes verstanden haben?“
Umso dringlicher sein Rat an die aufgeklärte Linke, sich das Ideal der Freiheit nicht entwinden zu lassen, nicht die Angst „vor dem Beifall von der falschen Seite“ als Vorwand zu nehmen, sondern sich stattdessen wieder einmal der pointierten Formulierung des britisch-jüdischen Philosophen Isaiah Berlin auszusetzen:
Debatte mit reaktionärer Schlagseite
Auch hat die freie Rede selbstverständlich ethische Standards einzuhalten, sollte sich ansonsten aber keinesfalls selbst einhegen - zum Beispiel „bei der Benennung von Defiziten und in allzu großer Nachsicht gegenüber religiös motivierten Einschüchterungsversuchen, wenn sie etwa von muslimischer Seite kommen“.
Vor allem aber müsse eine Debatte darüber geführt werden, ob die Identitätspolitik mit ihrer kompromisslosen Verabsolutierung von Herkunft nicht längst eine reaktionäre Schlagseite hat und einen verhängnisvollen Abschied markiert von den Inklusionsideen der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung um Martin Luther King.
Mögen zahlreiche der Beispiele intellektueller Selbstzensur auch aus den Wohlstandsblasen amerikanischer Universitäten stammen, wo karrierebewusste und „woke“ Aktivisten weniger die sozialen hard facts von Studiengebühren bekümmern als die Frage, welche Autoren aus früheren Zeiten als missliebig gelten sollten oder wie es um den „strukturellen Rassismus in der Mathematik“ beschaffen sei. Vieles davon könnte auch ein Menetekel für die hiesige Gesellschaft sein.
Nicht zuletzt deshalb, weil all dies eine Steilvorlage für Rechtsaußen ist, wo man geradezu nach Ethnisierung und der Spaltung der liberalen Gesellschaft in immer neue Gruppen und Untergruppen lechzt:
Die Rechte mag Identitätspolitik verabscheuen (und sie unter eigenem Vorzeichen zugleich immer wieder selbst praktizieren), doch sie liebt partikularistische identitätspolitische Debatten. Schon der ehemalige Trump-Berater Steve Bannon gab zu Protokoll: `Wenn die Linke sich auf die Themen Rasse und Identität konzentriert, können wir sie zermalmen.´
Eine aufgeklärte Linke ist wichtiger denn je
Gerade weil Michael Bröning in der Existenz einer (sozialliberalen) Linken einen Garanten sieht für die Verknüpfung von individueller Freiheit, sozialer Chancengleichheit und gesamtgesellschaftlicher Solidarität, geht er mit einem gewissen juste milieu hart ins Gericht.
So erinnert er daran, dass ein „woke capitalism“ zwar keine Scheu hat, in westlichen Ländern mit der Regenbogenfarbe oder dunkelhäutigen Menschen zu werben, sich jenseits davon aber kaum um wirkliche soziale Fairness bemüht.
Das ist kein „whataboutism“, auch entgeht der Autor einem populistischen Entweder-oder, wie es etwa Sarah Wagenknecht in ihren Angriffen auf eine „Lifestyle-Linke“ pflegt. Gerade deshalb scheint er an der Hartleibigkeit jener zu verzweifeln, die selbst die Thematisierung der Problematik für überflüssig erklären:
„Besonders irritierend, dass Einschränkungen der freien Meinungsäußerung vehement von Stimmen für nicht existent erklärt werden, die selber kaum je im Verdacht stehen, von den gerade angesagten Losungen des progressiven Lagers auch nur punktuell abzuweichen.“
Möge der ruhige Duktus und die stringente Argumentation seines Buches dennoch durchdringen.