Roman "Sein Garten Eden"
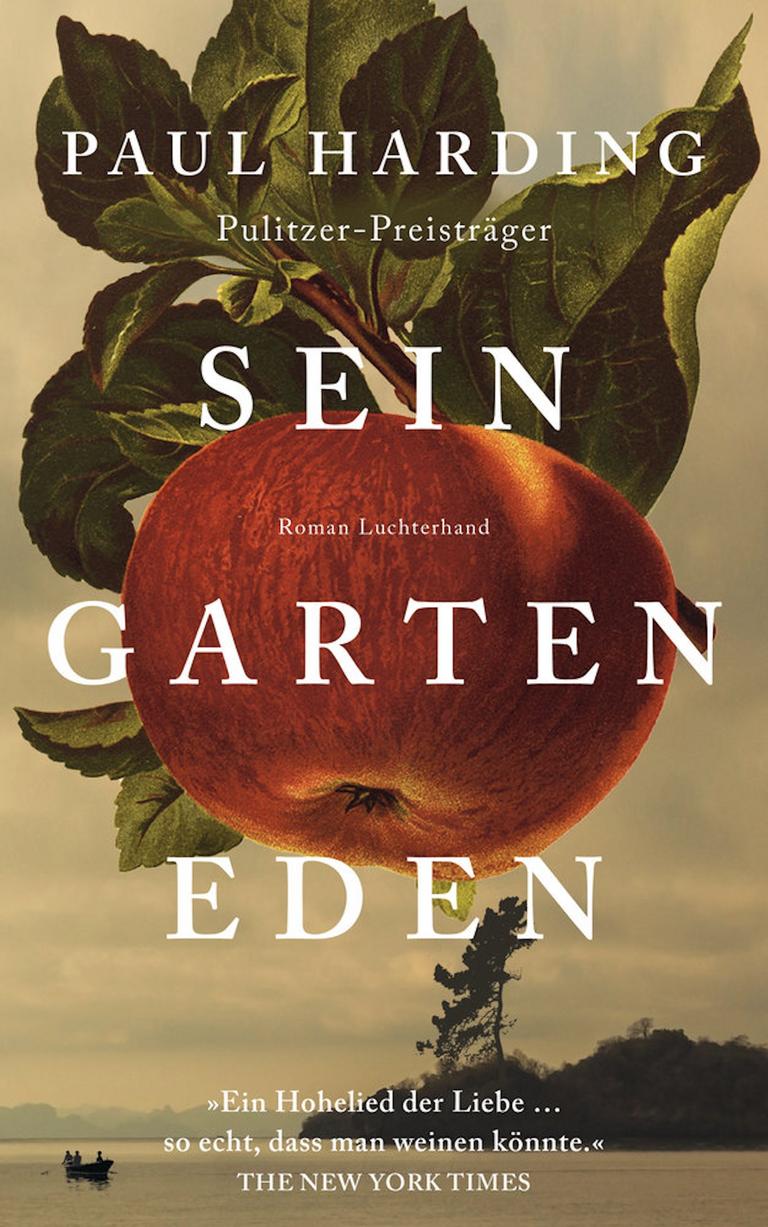
© Penguin Verlag
Vom Paradies zum Schreckensort: Die Geschichte von Apple Island
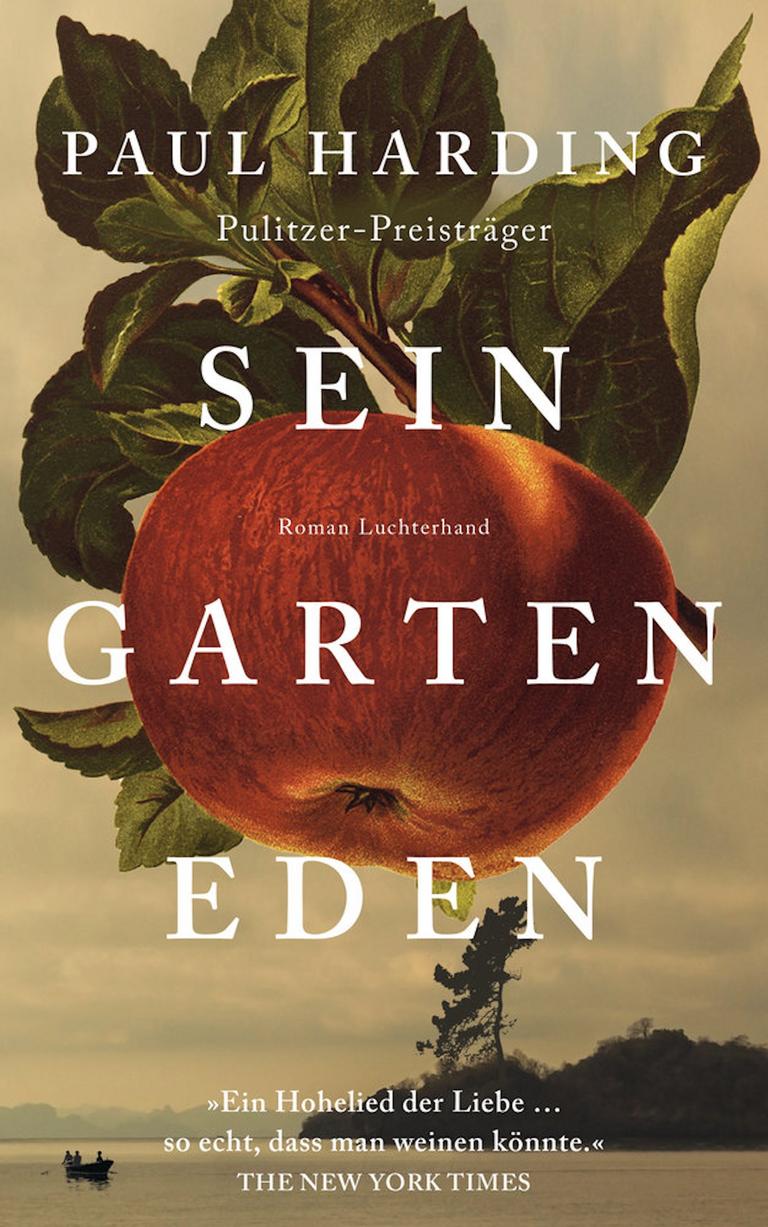
Paul Harding
Aus dem Amerikanischen von Silvia Morawetz
Sein Garten EdenPenguin, München 2024320 Seiten
24,00 Euro
Paul Harding erzählt mit viel Empathie, wie eine kleine Außenseiter-Gemeinschaft auf einer Insel vor Maine Frieden findet, bis die US-Behörden sie 1912 von dort brutal vertreibt. Ein Roman über Rassismus und missverstandene staatliche Fürsorge.
Es ist eine wahre Geschichte, der sich Pulitzer-Preisträger Paul Harding in seinem neuen Roman „This Other Eden“ angenommen hat. Er erzählt – ohne es zu benennen – von Malaga Island, einer kleinen Insel vor der Küste Maines, auf der einige Jahrzehnte eine Gemeinschaft von Fischern unberührt vom staatlichen Zugriff lebte. Die Familien versorgten sich selbst, lebten nach eigenen Regeln und von dem, was die Insel abwarf, wie auch von Gelegenheitsarbeiten auf dem Festland. 1912 endete diese Freiheit, der Staat wollte nicht länger tolerieren, dass hier „mixed-race“-Familien miteinander lebten und Familienmitglieder auch untereinander Beziehungen führten.
Samen und Werkzeug für den Neuanfang
Bei Paul Harding heißt die Insel nun – etwas literarischer – Apple Island, und ihre Geschichte beginnt 1793, als Benjamin Honey mit nichts als ein paar Samen für Obstbäume, etwas Werkzeug und seiner Frau Patience das Ufer erreicht. Er ist ehemaliger Sklave, „Amerikaner, Bantu, Igbo“, wie Harding seine Leser wissen lässt, sie Irin, weiß. Nur hier auf der Insel können die beiden ohne Sorge vor Rassismus leben und eine Familie gründen.
Paul Harding interessiert sich dabei weniger für dieses Paar, das mit den Samen den Grundstein für das Leben auf Apple Island legt, als für die Zeit, in der Honeys Nachkommen aus dessen Paradies vertrieben werden. Sprung also ins Jahr 1911, ein Jahr, bevor die Inselbewohner voneinander getrennt, getötet oder in staatlichen Einrichtungen untergebracht werden. Apple Island ist mittlerweile das Zuhause einer Handvoll Familien geworden, Schwarz und Weiß leben auf der Insel unter einem Dach, und den Jüngeren unter ihnen scheint gar nicht mehr klar zu sein, dass ihr Leben deshalb – außerhalb dieser Insel – verachtet würde.
Ein Missionar will Kindern Lesen beibringen
In diesem Jahr erreicht Matthew Diamond, ein weißer Missionar und Lehrer, die Insel. Der Mann, eine der interessantesten Figuren des Romans, ist voll guter Absichten: Er will den Kindern lesen und schreiben beibringen, ihnen Lateinunterricht geben, sie für Musik und Kunst begeistern, ist dabei selbst aber nicht frei von Vorurteilen. Nur für die Kinder kann er sich erwärmen, hat vor den Erwachsenen, vor Schwarzen im Allgemeinen, eine Zurückhaltung, die er sich selbst kaum eingestehen mag.
Sein Akt der Fürsorge – der Unterricht, der Bau einer Schule auf der Insel – ist also ein durch und durch ambivalentes Unterfangen, das zudem die staatlichen Behörden auf das Inselleben aufmerksam macht, was den Untergang einläutet. Wegen „der körperlichen wie der geistigen“ Hygiene beschließt man, die Inselbewohner aus ihrem Zuhause zu vertreiben – und die Gewalt, mit der dieser Beschluss umgesetzt wird, ist kaum zu ertragen.
Erzählt ohne falsche Romantik
Paul Harding erzählt die Geschichte der Inselbewohner ohne falsche Romantik. Das Paradies von Benjamin Honey ist ein denkbar raues: Die Obstbäume gibt es zwar auch ein Jahrhundert nach dessen Tod noch, trotzdem reicht das Essen immer nur gerade so, die Lebensbedingungen sind herausfordernd, die Nachfahren angegriffen.
Einfache Sympathieträger sind sie allesamt nicht und Harding suggeriert gar nicht erst, dass man leicht in ihre Perspektive springen könnte. Vielmehr gibt er in vielen kleinen Szenen ein Gefühl für ihr Leben, lässt mit großer Behutsamkeit eine Nähe zu ihnen entstehen und ringt darum, in diesem Roman mehr zu erfassen als die historische Wahrheit, Fakten, die sich überprüfen ließen – eine Vorstellung davon nämlich, wie es sich angefühlt haben könnte, in dem Gefühl ständiger Bedrohung, abseits der Zivilisation, auf dieser Insel zu leben.
Die Beschränktheit des rassistischen Blicks
Gleichzeitig nimmt Harding die andere Perspektive in den Roman auf, den Blick von Ärzten, Fotografen, Beamten, die nichts in den Inselbewohnern erkennen können als einen Angriff auf die Hygiene des Landes. Beiden Sichtweisen gibt Harding Raum – und gerade weil er seinen Roman öffnet für die Perspektive von außen, wird beides spürbar: die Beschränktheit, die Traurigkeit des rassistischen Blicks und die Grausamkeit des staatlichen Zugriffs auf das Leben der Inselbewohner.












