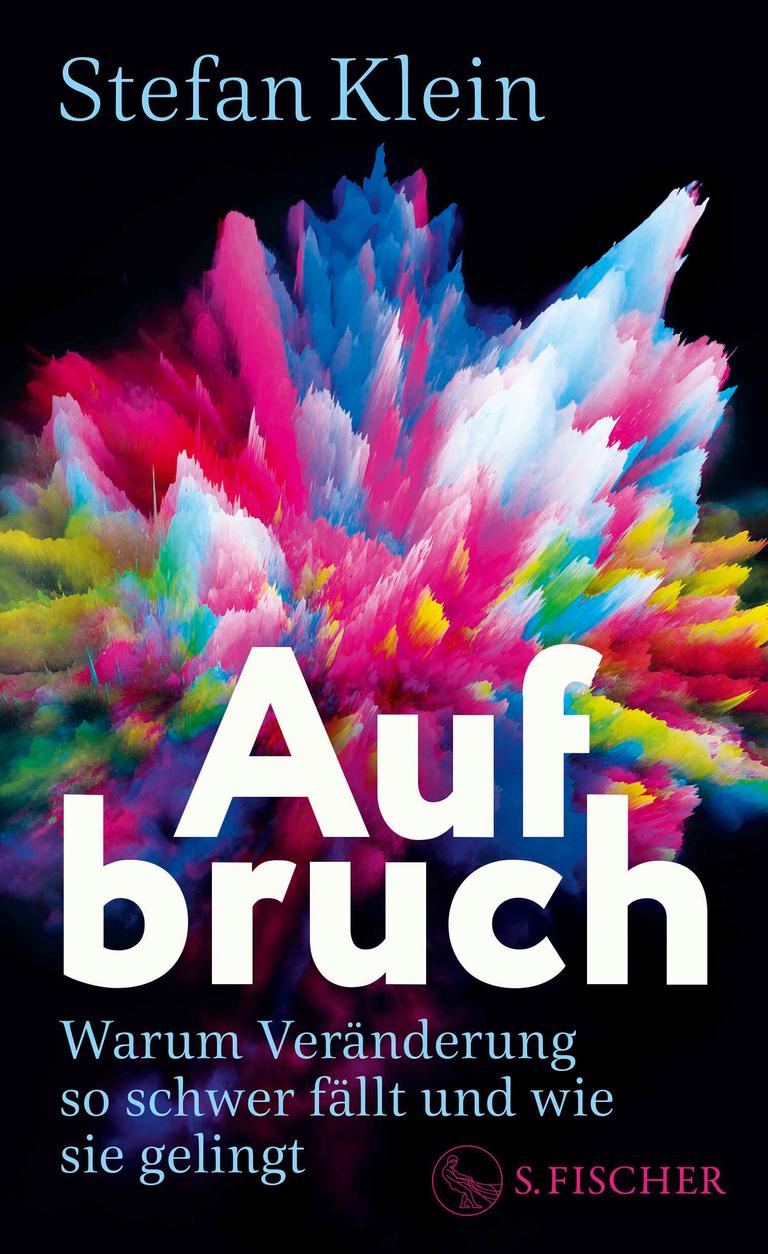Ob die neue Bundesregierung die vielen Herausforderungen bewältigen kann, die sich ihr stellen, das können wir nicht sagen. Die Erfahrungen mit der letzten Regierung, vor allem mit dem, was sie nicht geschafft hat, standen am Anfang der Recherche für Stefan Kleins neues Buch.
Einer von mehreren Anlässen waren die Erfahrungen mit der Ampelkoalition, die ja schon mit einem Aufbruchsanspruch angetreten ist und den überhaupt nicht einlösen konnte. Und ich fragte mich, warum ist das eigentlich so? Warum scheitern da Menschen, denen ich erstmal unterstelle, dass sie durchaus aufbruchswillig und veränderungswillig sind?
Sachliche Argumente reichen nicht aus
Der Autor hat daraufhin in der Wissenschaft nach Antworten gesucht – bei Psychologen, Ökonominnen, Anthropologen. Das Ergebnis: Wir können den Wandel nicht schaffen, wenn wir nur auf sachliche Argumente setzen. Menschen handeln nicht rein rational.
Klein macht sieben Illusionen über den Fortschritt aus, denen nicht nur Politikerinnen und Politiker aufsitzen. Eine ist etwa, dass Menschen ihre Umwelt realistisch einschätzen - stattdessen prägen Vorurteile unsere Wahrnehmung. Eine andere besteht in der Annahme, dass die Lösung, die am besten für den Einzelnen ist, auch gut für die Allgemeinheit sei. Konkret nachvollziehbar werden diese Überlegungen etwa am Beispiel des Klimawandels, bei dem die Mehrheit der Menschen durchaus weiß, dass er real ist.
Dass wir den Wandel unmöglich verhindern können, ist uns durchaus bewusst. Und so behaupten wir gar nicht, dass wir es wollen. Unsere Absichten hören sich viel bescheidener an: andere Wege gehen durchaus, nur bitte nicht gerade jetzt. In einer unsicheren Welt suchen wir in unseren Gewohnheiten Halt. Wir klammern uns an sie wie Ertrinkende an die letzten Planken eines untergehenden Schiffs.
Heizungsgesetz als fehlgeschlagener Versuch der Veränderung
Jedes Buch über gesellschaftliche Veränderung muss sich mit dem Phänomen auseinandersetzen, dass es hartnäckige Verweigerer des Wandels gibt. Das schon fast sprichwörtliche Heizungsgesetz der Ampel ist ein Beispiel für einen fehlgeschlagenen Versuch der Veränderung. Es waren nicht nur wirtschaftliche Gründe, die zum Protest dagegen führten. Viele Menschen fühlten sich einfach überfordert.
Es überfordert sie, aber es überfordert sie nicht unbedingt wirtschaftlich, es überfordert sie kognitiv.
Hier liefert das Buch einige Erkenntnisse, wie man solche kognitiven Barrieren und Dissonanzen überwinden kann. Der Mensch ist ein soziales Wesen – wenn er am Beispiel seiner Nachbarn sieht, dass Veränderung möglich ist, dann ist er eher bereit, mitzumachen. Das gilt für Wärmepumpen genauso wie etwa für die Toleranz gegenüber gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften. Bei der Ehe für alle hat die Politik ja 2017 nur noch nachvollzogen, was in der Gesellschaft längst akzeptiert war.
Klein zitiert noch weitere historische Beispiele, in denen grundlegende Veränderungen binnen relativ kurzer Zeit herbeigeführt wurden: etwa die Abschaffung der Sklaverei. Die war in Europa und Nordamerika über Jahrhunderte hinweg eine Selbstverständlichkeit, dann setzte sich von der Französischen Revolution bis zur Abschaffung der Sklaverei in den USA 1865 die Überzeugung durch, dass sie mit der Würde des Menschen nicht vereinbar sei.
Schneller ging es bei der weitgehenden Ächtung des Rauchens in den letzten Jahrzehnten. Auch die These, wir seien in der modernen Welt generell überfordert, weil der Wandel auf so vielen Ebenen gleichzeitig geschieht, lehnt Stefan Klein ab.
Menschen sind die anpassungsfähigsten und kognitiv flexibelsten Wesen, die die Evolution je hervorgebracht hat. Und es hat in der langen Geschichte der Menschheit immer wieder Situationen gegeben, in denen sich Menschen auf radikale neue Situationen einstellen mussten.
Als Beispiel nennt er die Renaissance. Eine Phase der Globalisierung, in der Machtverhältnisse umgestürzt wurden, eine neue Medientechnologie aufkam und Seuchen grassierten – das klingt erstaunlich aktuell.
Wenn ich vergleiche, welchem Veränderungsdruck die Menschen um das Jahr, sagen wir mal, 1550 ausgesetzt waren, dann kann ich nicht finden, dass wir in einer historisch ungewöhnlich unbequemen Lage sind.
Natürlich gibt es auch die Gegenbeispiele. Der Niedergang des Römischen Reichs, der Untergang der Maya und der Zusammenbruch vieler anderer Zivilisationen haben eines gemeinsam: Die Menschen stürzten blind in die Katastrophe. Sie konnten das Unglück nicht abwenden, weil sie weder die Situation noch ihren eigenen Beitrag daran verstanden. Wir hingegen kennen unsere Lage genau. Zu wissen, dass wir uns schaden, und es trotzdem zu tun: Dies ist unser Dilemma.
Wir, wenn wir in die Katastrophe rasseln, rasseln sehend in die Katastrophe. Wir können uns nicht darauf herausreden, dass wir nicht gewusst haben.
Trotz aller Katastrophenrhetorik schafft Klein noch eine optimistische Schlusskurve. Er setzt seine Hoffnungen auf die kommende Generation.
Wenn ich so die Generation nach uns angucke, die Generation meiner Kinder. Ich glaube, was sich da zum Beispiel an Verständnis von Geschlechterbeziehungen, von Inklusion, von Diversität getan hat und tut, das ist enorm.
Stefan Kleins solide recherchiertes Buch ist eine wichtige Lektüre für Menschen, die in sozialen Bewegungen aktiv sind, aber auch für Politikerinnen, die etwas bewegen wollen, oder für Betriebspsychologen, die Change Management betreiben. Es zeigt den Ungeduldigen, dass auch ein schneckenmäßiger Fortschritt umschlagen kann in radikalen Wandel, und gibt den Verzagten, so heißt es im Buch, eine „Gebrauchsanweisung für eine bessere Welt”. Die neuen Regierenden in Berlin sollten es lesen.