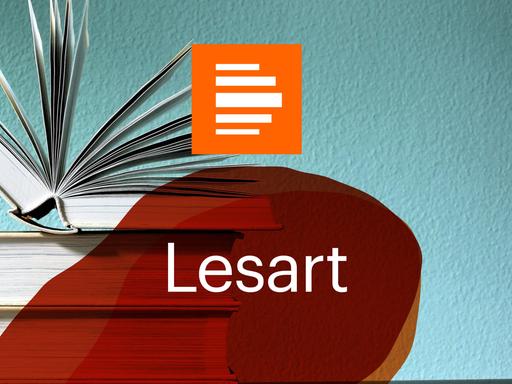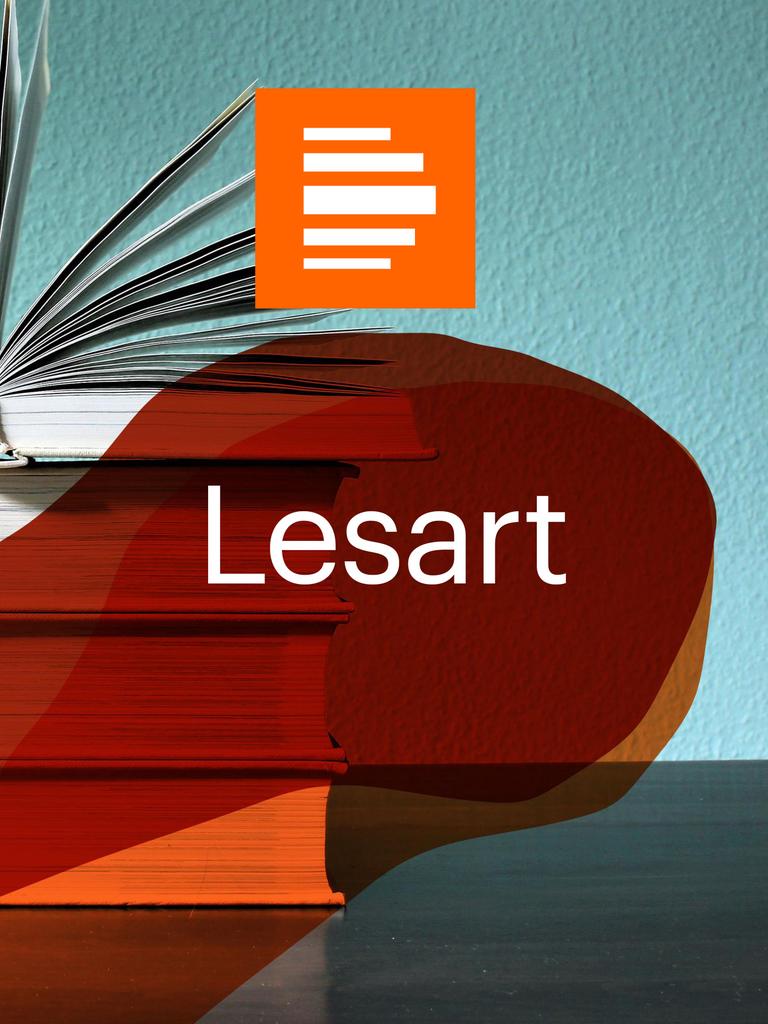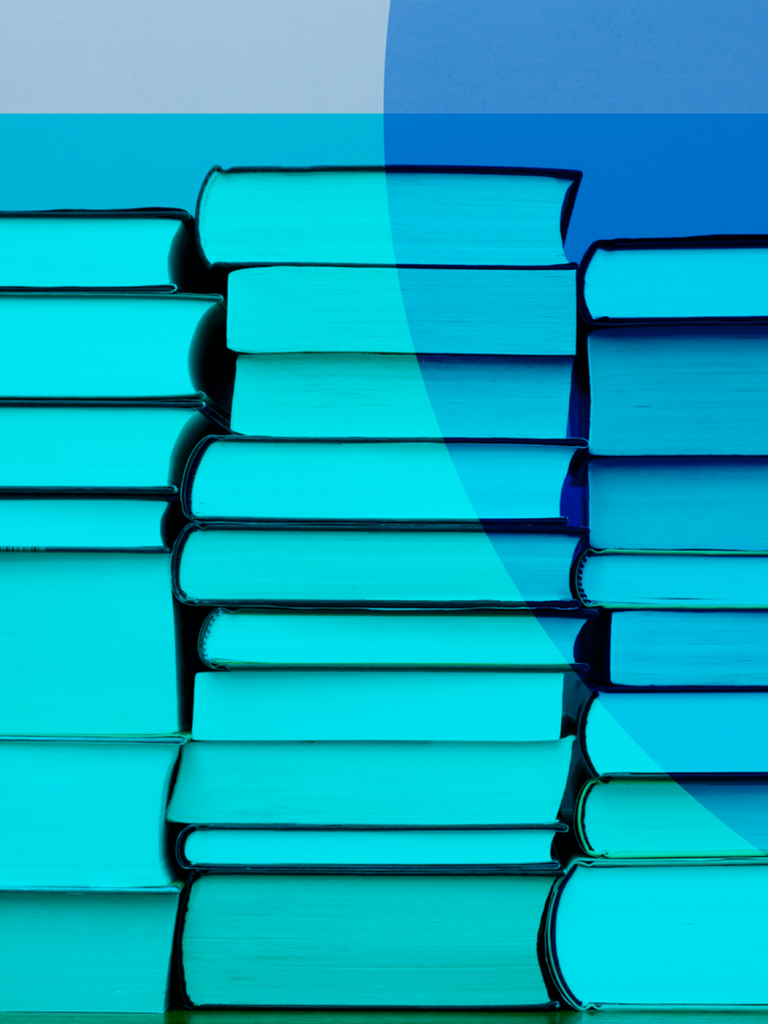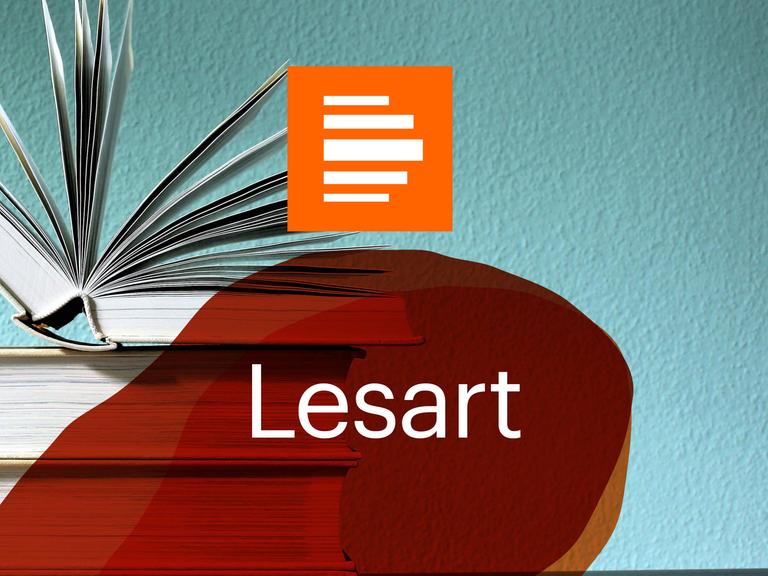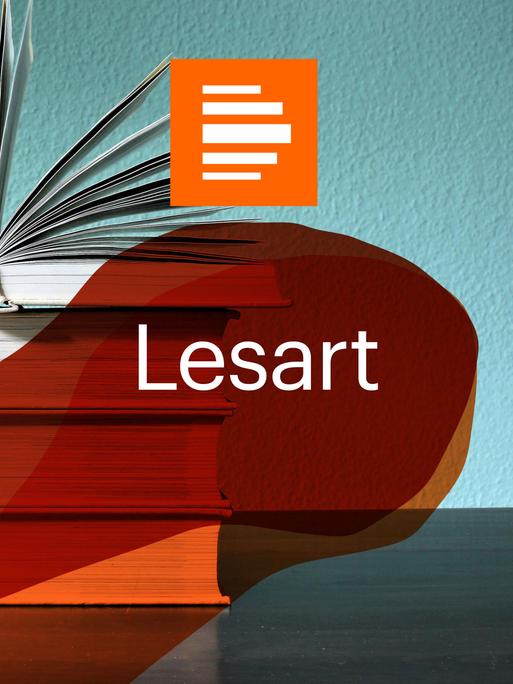Als der Erste Weltkrieg im Frühjahr 1918 endet, erweist sich der Friede in Europa als zerbrechlich. Der Vertrag von Versailles wird von vielen in Deutschland als „Kriegsschuldlüge“ verstanden und der Friede als nur temporär.
In Russland tobt seit der Februarrevolution 1917 und dem Oktoberputsch ein offener Kampf ums politische System. Während die Bolschewiki 1922 die Sowjetunion gründen, erstarkt zunächst in Italien und dann in Deutschland der Faschismus. Es wird das Jahrhundert der totalitären Ideologien.
Heute erlebt Europa eine neue Zunahme von Extremismus. Rechtsextreme Parteien gewinnen Zustimmung. Die Sorge vor einem neuen Faschismus geht um. Wir blicken auf die Geschichte und gleichen sie mit der Gegenwart ab.
Wie Faschismus verstehen?
Welche Parallelen zeichnen sich ab und worin liegen die historischen Unterschiede? Welche Köpfe und welche Schriften haben den Aufstieg des Faschismus befördert? Welchen Logiken und Mechanismen folgt Agitation? Welche Urtexte und welche Sachbuchklassiker helfen bis heute, Faschismus zu verstehen?
Gemeinsam mit sechs Fachleuten – von den Politikwissenschaftlern Peter R. Neumann und Matthias Quent über die Politologin Natascha Strobl und die Soziologin Paula-Irene Villa Braslavsky bis zum Historiker Volker Weiß und zum Theatermacher Bernd Stegemann – haben wir sechs Bücher aus dem gesamten Jahrhundert ausgewählt.
Wir haben unsere Gäste gebeten, diese Klassiker neu zu lesen. Im Gespräch fragen wir: Wie können wir Faschismus verstehen?
Übersicht der vorgestellten Bücher
Als der Philosoph Oswald Spengler zum Ende des Ersten Weltkrieges "Der Untergang des Abendlandes" schrieb, traf das Buch einen Nerv. Spengler postulierte in seinem Bestseller eine schicksalhafte, zyklische Sicht auf die Geschichte. Er beschrieb darin Kulturen wie organische Einheiten. Den Untergang des Abendlandes hielt er für naturgegeben und unvermeidlich.
Spenglers Denken und seine populäre Verachtung für die Weimarer Republik gelten als Wegbereiter des deutschen Faschismus. Auch nach hundert Jahren ist „Der Untergang des Abendlandes“ eine Urschrift konservativer Verlustangst und -lust. Denn Spengler formulierte eine konservative Grundidee, sagt der Politikwissenschaftler und Extremismusforscher Peter R. Neumann: die Angst als Kernlogik rechten sowie rechtsextremen und faschistischen Denkens. Neumann arbeitet am Londoner King’s College als Senior Fellow zu den Mechanismen der Radikalisierung.
Oswald Spengler: „Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte“
Beck's Historische Bibliothek, 1271 Seiten, 34,90 Euro
(Erstausgabe 1918/1922)
Der Historiker Fritz Stern analysierte „Kulturpessimismus als politische Gefahr“. Seine eindringliche Warnung aus dem Jahr 1961 beschreibt ein Phänomen, das auch heute vielen Menschen anschlussfähig erscheint: Der Glaube, dass Kultur verfalle und gerettet werden müsse – mit den Ideen des Nationalismus, des Reaktionären, des Rechtsextremismus.
Stern beschrieb dieses Motiv anhand von drei Vorbereitern des Nationalsozialismus. Was sie einhellig beklagten, war eine geistige Leere in der Gesellschaft, ein Verlust von Tugend, die Presse sei korrupt, die Parteien Ursache nationaler Zwietracht. In ihren Gegenrezepten hießen sie Gewalt gut und begründeten sie mit darwinistischen und rassistischen Argumenten.
Mit ihren zornigen Texten schufen sie Voraussetzungen dafür, die Unzufriedenheit in der Gesellschaft in Politik umzusetzen. Stern beschreibt das als „Übergang von übermäßiger Sentimentalität zu zügelloser Aggressivität, der sich im deutschen Denken vollzog". Der Historiker beklagt, dass der Kulturpessimismus zu wenig als ein gefährliches Element in der deutschen Gesellschaft erkannt wurde.
Über das Buch spricht der Dramaturg und Sachbuchautor Bernd Stegemann.
Fritz Stern: „Kulturpessimismus als politische Gefahr. Eine Analyse nationaler Ideologie in Deutschland“, übersetzt von Alfred P. Zeller, mit einem Vorwort von Norbert Frei
Klett-Cotta, 467 Seiten, 25 Euro (Englische Erstausgabe 1961)
Fantasien von männlicher Stärke und Härte, Hass auf Frauen, reaktionäre Geschlechterrollen – diese bilden ein Bindeglied aller historischen und aktuellen rechtsextremen Bewegungen. Denn Rechte, Rechtsextreme und Faschisten sahen und sehen nicht nur das Abendland und die Kultur vom Untergang bedroht, sondern auch ihre Vorstellungen von Männlichkeit.
Kaum jemand hat das so früh und so genau beschrieben wie Klaus Theweleit in seinem Instant-Klassiker „Männerphantasien“ von 1977. Warum wird ausgerechnet diese rechtsextreme Gemeinsamkeit bis heute so oft übersehen und wie kann der Blick auf Gendervorstellungen dabei helfen, Faschismus zu verstehen?
Klaus Theweleit: "Männerphantasien"
Matthes & Seitz Berlin, 1.278 Seiten, 48 Euro (Erstausgabe: 1977)
Um die Methoden faschistischer Agitation zu durchschauen, bietet sich ein Blick auf deren „Falsche Propheten“ an. Unter diesem Titel hat der Literatursoziologe Leo Löwenthal die politische Stimmungsmache durch US-amerikanische Rechtsextremen in den 1930ern und 1940ern untersucht. Der – zu Unrecht fast vergessene – Mitbegründer der Frankfurter Schule analysierte ihre typische Rhetorik von Angst, von drohendem Chaos und eines brutalen Kampfs gegen vermeintlich Schuldige.
Löwenthal warnte davor, diese Agitation zu unterschätzen; nicht selten sei sie eine „Generalprobe fürs Pogrom“. Sein Werk, zuerst 1949 erschienen, ist von erschütternder Aktualität. Über das Buch und die Bezüge zur Gegenwart spricht Volker Weiß. Der Historiker analysiert in seinen Büchern unter anderem die geistigen Netzwerke der Neuen Rechte.
Leo Löwenthal: „Falsche Propheten. Studien zur faschistischen Agitation“
mit einem Nachwort von Carolin Emcke
Suhrkamp, Berlin, 253 Seiten, 15 Euro (Englische Erstausgabe: 1949)
Eine Blaupause für den Machtkampf heutiger Rechtsextremer lieferte paradoxerweise ein Kommunist: der italienische Politiker Antonio Gramsci. Der dezidierte Gegner des Faschismus und Mitbegründer der Kommunistischen Partei Italiens wurde 1926 verhaftet und saß bis kurz vor seinem Tod im Gefängnis. Dort formulierte er in 32 Heften ein Konzept politischer und kultureller Hegemonie. Legitime politische Macht entscheide sich nicht erst bei Wahlen und in Parlamenten, sondern im vorpolitischen Raum.
Gramscis Überlegungen nutzen heute rechtsextreme Bewegungen als Praxisanleitung für den Kampf um geistige Vorherrschaft und Diskursverschiebung. Daraus leitet sich die Bedeutung von Diskurshoheit auf Marktplätzen, im Fußballstadion, auf TikTok und auf Sylt ab. Sollten demokratische Parteien heute Gramsci als Anleitung oder als Warnung lesen?
Welche Konzepte sich zur Bekämpfung von faschistischen Tendenzen aus Gramscis „Gefängnishefte“ lesen lassen, beschreibt die Wiener Politikwissenschaftlerin Natascha Strobl.
Antonio Gramsci: „Gefängnishefte. Kritische Gesamtausgabe in 10 Bänden“,
herausgegeben von Klaus Bochmann und Wolfgang Fritz Haug
Argument Verlag, 3542 Seiten, 180 Euro (ursprünglich geschrieben ab 1926)
Wer rechtsradikal wähle, sei kein „Protestwähler“ und nicht „besorgt“, sondern: reaktionär. Friedbert Pflüger, CDU-Politiker und von 1990 bis 2006 Mitglied des Bundestages, formulierte dieses Urteil in seinem Buch „Deutschland driftet“, geschrieben 1994.
Angesichts rassistischer Anschläge und antisemitischer Taten beschrieb er auch eine Diskursverschiebung und warnte vor antiaufklärerischen Ideen und antiparlamentarischem Denken, vor Antisemitismus, Rassismus, Nationalismus und einem antiwestlichen Sonderweg.
Pflüger schrieb über die Gefahren, die von der wiederentdeckten Konservativen Revolution ausgingen, von den Ideengebern und Steigbügelhaltern des Nationalsozialismus. Er warnte die CDU/CSU eindringlich davor, Themen und Begriffe der Neuen Rechten zu übernehmen, und schrieb: Wer nach links und rechts keine klaren Trennlinien ziehe, müsse sich den Vorwurf einer Mitschuld an politischer Gewalt gefallen lassen.
Über diese Warnung aus den 1990er-Jahren spricht der Soziologe Matthias Quent. Er fortscht zu Rechtsextremismus an der Hochschule Magdeburg/Stendal.
Friedbert Pflüger: "Deutschland driftet. Die Konservative Revolution entdeckt ihre Kinder"
Econ, 1994, 198 Seiten, antiquarisch erhältlich