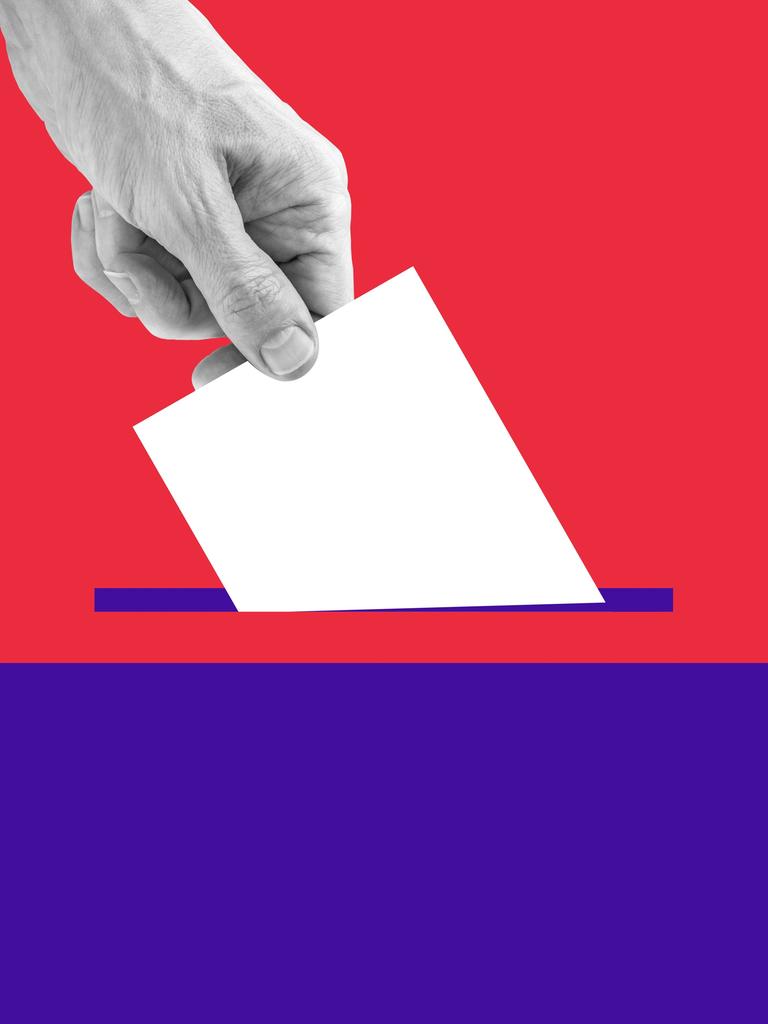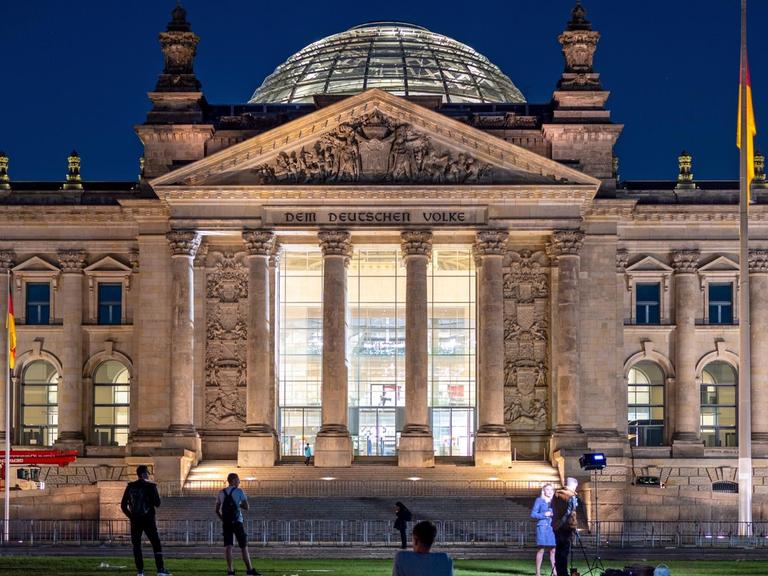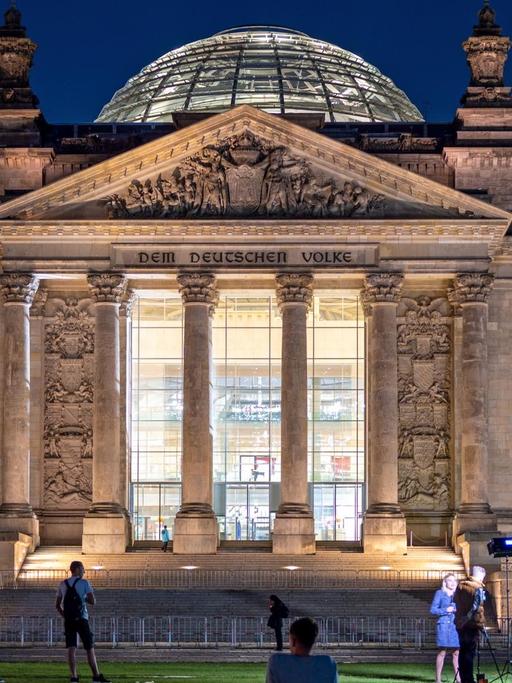Kommentar: Demografie und Wahlen

Alte Menschen bestimmen die Wahl und die Themen im Wahlkampf. Sie sind nicht nur die größte Wählergruppe, sie nehmen ihr Wahlrecht auch häufiger wahr als die junge Generation - weil diese sich nicht gesehen und gehört fühlt? © imago / Funke Foto Services / Kerstin Kokoska
Mächtige Alte, frustrierte Junge
04:38 Minuten

Der Jugend gehört die Zukunft, heißt es immer. Doch im Wahlkampf zeigt sich: Die ältere Generation gibt den Ton an, weil sie die größte Wählergruppe sind. Grund genug für die Jungen, frustriert zu sein.
Die demografische Entwicklung der Bundesrepublik hat erhebliche Auswirkungen auf die Struktur der Wählerschaft. Schaut man sich an, wer wählen darf und wer nicht, so sieht man unmittelbar: Der Anteil der wahlberechtigten Menschen ab 60 ist seit Gründung der Bundesrepublik stetig gestiegen. 1953 lag dieser Anteil noch bei rund 20 Prozent, bei der bevorstehenden Bundestagswahl am 23. Februar werden es über 40 Prozent sein.
Und das ist nicht das Ende der Geschichte. Wie wir aus der sogenannten „repräsentativen Wahlstatistik“ der Bundeswahlleiterin wissen, verschärft sich das Problem noch weiter, wenn wir uns die tatsächliche Wahlbeteiligung unterschiedlicher Altersgruppen anschauen. Denn die Älteren werden nicht nur mehr, sie wählen auch häufiger als die Jungen.
Junge Menschen gehen seltener wählen
Konkret: Bei der Bundestagswahl 2017 lag die Wahlbeteiligung bei jungen Menschen unter 25 bei unter 70 Prozent, während sie bei Menschen zwischen 60 und 69 bei 81 Prozent lag, bei Menschen über 70 bei rund 75 Prozent . Vier Jahre später, bei der Wahl 2021, sah das Bild sehr ähnlich aus: Auch damals nutzten ältere ihr Wahlrecht häufiger als jüngere Menschen.
Die Struktur der Wählerschaft und erst recht die Struktur der tatsächlich Wählenden ergraut also. Und als wäre als das nicht genug, kommt im Wahljahr 2025 noch ein weiterer Frustfaktor für junge Menschen hinzu. Bei der Europawahl im vergangenen Jahr 2024 durften ja erstmals bei einer bundesweiten Wahl auch 16- und 17-Jährige wählen. Solche Absenkungen des Wahlalters führen naturgemäß dazu, dass sich die Struktur der Wählerschaft etwas verjüngt. Und auch die Wahlbeteiligung junger Menschen scheint bei der Europawahl im vergangenen Jahr recht hoch gewesen zu sein, gerade auch im Vergleich zu älteren Gruppen, wie jüngst veröffentlichte Zahlen zeigen.
Vorgezogene Wahl schließt junge Menschen aus
Jetzt im Februar kommt für viele der große Frust. Für all diejenigen etwa, die im vergangenen Jahren mit 16 Jahren erstmals wählen durften und von denen viele auch – um es mal ein wenig pathetisch zu formulieren – „die Süße des Wählens“ tatsächlich gekostet haben – bleiben dieses Mal die Wahllokale verschlossen. Gleiches gilt für viele, die damals 17 waren. Wer am 23. Februar 2025 noch keine 18 ist, bleibt draußen. Besonders bitter ist das für all jene, die über den Sommer ihren 18. Geburtstag feiern werden. Hätte die Wahl, wie ursprünglich geplant, im September 2025 stattgefunden, wären sie dabei gewesen. Jetzt im Februar sind sie raus.
Nun könnte man das als Petitessen abtun. So ist es halt. Aber ganz so einfach ist es eben doch nicht. Wir wissen, dass solche Erfahrungen – mal darf man wählen, mal darf man nicht – zu Frustration bei jungen Menschen führt. Und gerade bei jungen Menschen bedeutet das: Gleich ihre allerersten Wahlerfahrungen sind frustrierend. Das kann wiederum prägende Folgen über den Tag hinaus haben.
Daraus folgt wohl kaum, dass es künftig keine vorgezogenen Neuwahlen mehr geben darf. Aber dass ein einheitliches Wahlalter wünschenswert wäre, um Frustrationen zu verhindern, vielleicht dann doch.
Wünsche junger Generationen weniger sichtbar
Und dabei haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, welche Folgen sich aus der alternden Wählerschaft für Wahlen und Wahlkämpfe ergeben. Im Lichte dieser Strukturen erscheint es jedenfalls völlig nachvollziehbar, dass Parteien zunehmend auf die Bedürfnisse älterer Menschen eingehen. Oder warum sprechen wir doch recht häufig über Rente in Wahlkampfzeiten? Und so wenig über das Thema Bildung? Die Bedürfnisse und Themen der jüngeren Generation scheinen weitaus weniger sichtbar. Und das wird wohl auf absehbare Zeit so bleiben. Die Wahlen der Zukunft sind vor allem auch Wahlen der Alten.