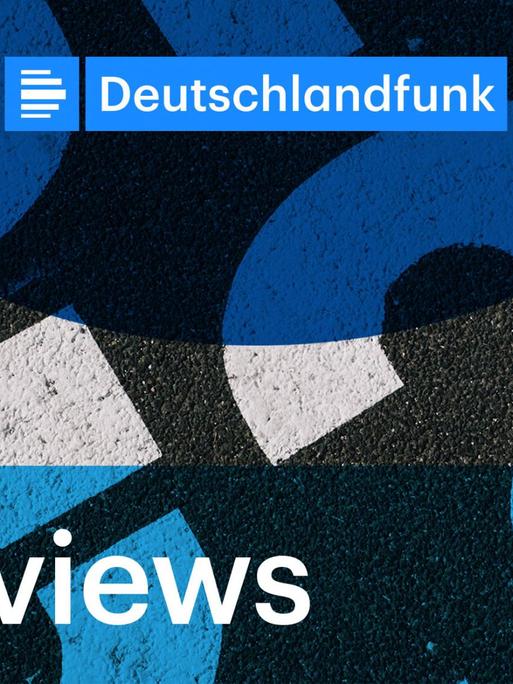Kommentar zum Wahlkampf

Politische Kontrahenten: Bundeskanzler Olaf Scholz (2. von links), CDU-Chef Friedrich Merz (2. von rechts) und FDP-Chef Christian Linder (ganz rechts) sind in der Wahl der Mittel nicht zimperlich. © picture alliance / Anadolu / Halil Sagirkaya
Darf es bitte etwas mehr sein?
04:33 Minuten

Bei der Debatte rund um die Vertrauensfrage ging es im Bundestag ruppig zu, im anstehenden Wahlkampf drohen Schlammschlachten. Das haben die Bürger nicht verdient. Was sie brauchen: mehr Substanz, mehr Sachlichkeit, mehr Fairness.
„Das ist mehr als eine Kampagne. Das ist ein Ruf zu den Waffen!“ soll der US-Präsidentschaftskandidat Franklin D. Roosevelt 1932 nach seiner Nominierung ausgerufen haben, um seine Anhänger zu mobilisieren. Er war erfolgreich und schlug seinen Gegenkandidaten haushoch. Als jüngst ruchbar wurde, die FDP habe für ihr Ausscheiden aus der Ampel-Koalition eine „offene Feldschlacht“ als Finale vorgesehen, wurde man an die militärische Herkunft des Wortes Kampagne erinnert. Campagna bezeichnete die Zeitspanne, die ein Heer im Feld verbrachte.
Pläne für die Präsentation eigener Highlights
Das will natürlich gut durchdacht sein und geplant werden. Die Parteien und ihre Spitzenkandidaten tun das gerade: Sie schmieden einen Zeitplan mit entsprechenden Höhepunkten, stets im Blick auf die politischen Mitbewerber, um eigene Highlights zu inszenieren und auf Irritationen vorbereitet zu sein.
Das nennt man, auch militärisch: Strategie. Das D-Day-Papier der Freien Demokraten hat deren schnöde Wirklichkeit, die Dürftigkeit der Sprache, die Pauschalität der Zielsetzungen und die Naivität der Einschätzungen unter Beweis gestellt.
Die erwischten Strategen erklärten zu ihrer Entschuldigung, die anderen Parteien würden das doch genauso machen. Und da haben sie recht: Man darf davon ausgehen, dass auch andernorts Feldschlachten geplant werden.
Politische Zustimmung braucht Werbung
Bevor ich dazu einige Erwartungen formuliere, möchte ich ein Missverständnis vermeiden, das politische Werbung häufig betrifft. Politische Zustimmung braucht Werbung, und ja: Politik ist zu einem guten Teil Werbung für Personen und Programme. Zu den üblichen Methoden erfolgreichen Regierens gehören die drei großen "G": Neben Geld, um materielle Handlungsanreize zu schaffen, und Gesetzen, um verbindliche Regeln zu setzen, auch Gute Worte, anders gesagt: Überzeugungsarbeit.
Und an keiner Stelle tritt diese Facette von Politik deutlicher hervor als bei demokratischen Wahlen. Dazu gehören bekanntlich mehr oder weniger Erfolg versprechende Spitzenkandidatinnen und -kandidaten, die um Vertrauen werben. Es zeichnet sich ab, wie die nun inszeniert werden sollen. Olaf Scholz als der das Feld von hinten aufrollende Friedenskanzler, Robert Habeck als der zuversichtliche Bro am Küchentisch, Christian Lindner als der prinzipienfeste Einzelgänger, Friedrich Merz als der spätberufene Krisenmanager, Alice Weidel als die dauerempörte Systemsprengerin, Sarah Wagenknecht als zorniger Friedensengel.
Darf es bitte etwas mehr sein? Oder ist es naiv zu erwarten, bis zum 23. Februar 2025 werde man dem Publikum einen anspruchsvollen und inhaltsreichen, fairen und ernsthaften Wahlkampf bescheren?
Ein US-Politikberater hat den Begriff der „permanenten Kampagne“ erfunden und darauf angespielt, dass Kampagnen das Kerngeschäft des Regierens zu allen Zeiten überwuchern. Bleibt also die Herausforderung, Kampagnen nicht nur professioneller zu gestalten als zuletzt im FDP-Hauptquartier, sondern transparenter und interaktiver. Das heißt: Wir wollen uns mit realistischen Alternativen auseinandersetzen und die besten von allen schlechten Lösungen abwägen.
Die Bürger wollen nicht für dumm verkauft werden
Die Bürgerschaft möchte nicht als Politik-Konsumenten für dumm verkauft werden, und sie möchte, dass auch bis Ende Februar Politik noch stattfindet. Angesichts der überall in Europa drohenden Sperrminorität antidemokratischer Parteien muss die demokratische Mitte kompromissfähig sein und sich zusammen für den Fall wappnen, dass die Populisten Mehrheiten erringen.
Mehr Substanz, mehr Sachlichkeit, auch mehr finanzielle Transparenz – all das würde jedenfalls den vernünftigen Teil der Wählerschaft besser erreichen und zufrieden stellen.