"Champagner und Baumkuchen bis ein Uhr"
Wie wir unser Leben ökologisch umbauen können, was Helmut Schmidt und Peer Steinbrück aus der Vergangenheit gelernt haben, welches 64-Stunden-Hörbuch eine ganze Generation von Schriftstellern zu Wort kommen lässt - das erklärt die Spezial-Ausgabe der "Lesart".
Das Weltklima kann nicht mit Diskussionen gerettet werden. Auch das Ergebnis des Klimagipfels von Durban vor 14 Tagen hat wirkliche Veränderungen in weite Ferne verschoben. Was zunächst bleibt, ist die Ausweitung erneuerbarer Energien und der bewusste Umgang mit Strom, Nahrung und Umwelt durch jeden Einzelnen.
Nur so kann das Ziel erreicht werden, die Erderwärmung zu begrenzen, mahnt Christiane Paul. Die Schauspielerin und Ärztin ist besorgt über den Zustand unserer Welt. In ihrem Hörbuch "Das Leben ist eine Öko-Baustelle" beschreibt sie ihren Versuch, umweltbewusst zu leben:
"Ich kann nicht sagen, dass ich ein Aha- oder Erweckungserlebnis hatte im Sinne von: Ich sehe Vögel am Strand mit einem Ölfilm und von Stund an war ich ein Öko. Ich weiß aber, dass sich das irgendwann im Laufe des Jahres 2006 bei mir so weit entwickelt hatte, dass ich dachte: So geht es nicht weiter. Richtig alarmiert haben mich dann die Zahlen und Berichte über den Klimawandel, die Ende 2006 und Anfang 2007 veröffentlicht wurden. Das war für mich die ökologische Wende. Ich fing an, alles zu lesen, was ich in die Hände kriegen konnte. Darüber, welche Arten aussterben, was an den Polen passiert, wie sich die Atmosphäre seit der industriellen Revolution verändert hat. Ich konnte nicht mehr beim Informieren, beim Nachdenken und Reden stehen bleiben und begann, mich intensiv mit den Veränderungsmöglichkeiten meines Lebensstils und meines Konsums zu beschäftigen und zu sehen, was ich wie verändern und verbessern könnte. Wir können nicht erwarten, dass sich anderswo was tut, ehe wir etwas tun. Meine Kinder sind eine starke Motivation. Aber noch stärker treibt mich eine andere Frage um. Ich denke weniger: Was für eine Welt hinterlasse ich denen? Ich denke: Was tun wir der Welt, was tun wir dem Planeten, was tun wir uns an? Ich bin kein Naturfreak, ich liebe auch nicht die Tiere mehr als die Menschen. Aber wenn ich bestimmte Bilder sehe, wie der Mensch alles gnadenlos abholzt und ausbeutet und nichts mehr übrig lässt, da frage ich mich dann auch: Werden meine Kinder 50, 60 Jahre alt? In welcher Welt?"
Natürlich müsste die Politik den großen Umbau für das Klima und den Umgang mit Ressourcen hinbekommen. Christiane Paul aber bezweifelt, dass die Politik überhaupt konsequent die großen ökologischen Themen angehen will. In Gesprächen mit Wissenschaftlern, Ernährungsberatern und Politikern hat sie sich intensiv mit dem Zustand der Erde und mit Umweltproblemen – im Großen wie im Kleinen – beschäftigt. Der Ansatz für ein Umdenken liegt für sie bei jedem Einzelnen, im persönlichen Alltag: nämlich in der Bereitschaft, Lebensgewohnheiten zu ändern:
"Meine grundsätzliche Einstellung zum Essen von Fleisch ist eindeutig. Erstens: Ich finde, der Mensch kann Fleisch essen. Zweitens: Der Mensch muss nicht Fleisch essen. Drittens: Der Mensch sollte weitaus weniger Fleisch essen, als heute produziert und konsumiert wird. Ernährungswissenschaftler sagen, dass der Mensch auf Fleisch verzichten kann, wenn er sich sein Protein, anders holt: über Hülsenfrüchte, also Bohnen, Sojabohnen, Erbsen, Linsen, Nüsse. Für mich ist das entscheidende und massive Problem die Massentierhaltung, die genetische Veränderung der Tiere, die fürchterlichen Lebensbedingungen nach den Vorgaben der industriellen Landwirtschaft und die Art, wie sie getötet werden. Wie der US-amerikanische Lebensmittelphilosoph Michael Pollan sagt: 'Das Problem ist nicht das Fleisch, das Problem ist die Fleischfabrik.'"
Akribisch, oft sehr ins Detail gehend, erzählt Christiane Paul über Diskussionen mit der Familie und mit Freunden. Dabei ist ihr bewusst, wie schnell man im täglichen Leben an die eigenen Grenzen stößt und wie leicht man anderen mit "Bekehrungsversuchen" auf die Nerven geht:
"Manche Leute denken vielleicht, weil ich Ärztin bin oder war, würde ich Bioernährung wegen des gesundheitlichen Aspekts bevorzugen. Das ist nicht so. Ich lebe nicht nach einer Ich-muss-mich-gesund-ernähren-Formel. Ich rauche gern mal eine Zigarette und ich trinke auch gern mal ein Glas Wein. Abgesehen davon ernähre ich mich relativ gesund. Und ich mache Sport. Man kann nicht sagen, dass ich beim Einkaufen von Lebensmitteln kreativ bin. Im Gegenteil: Ich kaufe immer dasselbe ein. Das sind Lebensmittel, von denen ich weiß, dass sie mir oder uns schmecken. Und es sind zum Großteil Biolebensmittel. Bei mir kommt auch eindeutig der subjektive Genussfaktor dazu. Bio sieht für mich besser aus und schmeckt mir besser. Manchmal schaue ich in meine Tasche und denke: Viel ist das ja nicht für 30 Euro. Aber ich habe mich grundsätzlich entschlossen, mehr Geld für Lebensmittel auszugeben, weil ich es wichtig finde und weil es mir das wert ist – mehr Qualität für weniger Quantität. Ich bin mir bewusst, dass das eine sehr privilegierte Position ist, in der ich mich befinde, und dass es Familien und Haushalte gibt, die diese Entscheidung, bio oder konventionell, nicht haben. Vielen bleibt oft nur der Weg zum Discounter. Doch selbst da kann ich wählen und auf die Produkte zurückgreifen, die am wenigsten aufbereitet oder vorgefertigt sind."
Christiane Paul: Das Leben ist eine Öko-Baustelle (MP3-Audio) Das Leben ist eine Öko-Baustelle ist ein kluges und sehr engagiertes Plädoyer. Die Leidenschaft merkt man Christiane Paul auch an, die das Hörbuch selbst gesprochen hat. Erschienen sind die 3 CDs bei Der-Audio-Verlag.
Es gibt viel zu tun, das meint auch die Journalistin Bascha Mika. Sie will aber nicht Tiere und Umwelt schützen, sondern sorgt sich um die Gleichberechtigung der Frauen. Das klingt zunächst wie ein Thema von gestern. Aber Bascha Mika macht rasch klar: Auch heute noch laufen Frauen reihenweise in die "Rollenfalle". Im Gegensatz zu früher sind sie aber selbst schuld, argumentiert sie – und dürfte damit manche Geschlechtsgenossin vor den Kopf stoßen.
"Frauen und Männer sind hierzulande gleichberechtigt, heißt es. Doch das ist nur Theorie, nicht die Praxis. Im wirklichen Leben haben die meisten modernen Paare die Aufgaben untereinander geteilt wie die Eltern und Großeltern – hübsch entlang der Geschlechtergrenzen. Selbst die jetzt 20- und 30-jährigen. Auch wenn Väter einen hooper-trooper-Kinderwagen schieben und Mütter am Sandkasten mit einem Smartphone spielen, hat sich nicht wirklich etwas verändert. Es scheint nur so. Das Grundmuster ist erschreckend gleich geblieben: Der Mann als Versorger draußen in der Welt, die Frau daheim bei Haus und Kindern, vielleicht mit einem Halbtagsjob. Er zahlt bar, sie mit Lebenszeit und Eigenständigkeit. Ein schleichender Prozess der weiblichen Selbstabwertung. Doch der Unterschied zu früheren Generationen ist eklatant: Heute haben Frauen die Wahl. Ihr Los ist selbst gezimmert."
Andrea Sawatzki liest das kämpferische Buch mit dem Titel: "Die Feigheit der Frauen. Eine Streitschrift wider den Selbstbetrug". Denn genau das wirft sie ihrem Geschlecht vor: Dass Frauen unabhängig von Alter und Bildungsstand sich den alten Rollenmustern anpassen, und zwar freiwillig. Über das eigene Unbehagen, wenn sie nach Studium und mit bester Qualifikation zur windelwechselnden Hausfrau werden, darüber versuchen sie dann hinwegzusehen. In vielen Gesprächen habe sie immer wieder die gleichen Ausreden für ein fremdbestimmtes Leben gehört, meint Bascha Mika: Dass das Leben sich rein zufällig so entwickelt hat, dass es schon passen würde. In Wirklichkeit aber, sagt die ehemalige "taz"-Chefredakteurin, hätten Frauen Angst vor Wettbewerb, vor dem Risiko – sie seien schlicht feige.
"Mut gehört nicht zum Standardrepertoire in der weiblichen Welt. Feigheit durchaus. Die Angst, etwas zu verlieren, macht Frauen zu Weichlingen. Denn zu verlieren gibt es viel: vom Selbstbild des sanften, friedfertigen Wesens über das gewohnte Leben bis hin zur Liebe eines Mannes. Wer den Mut hat, hoch zu klettern, kann auch tief fallen. Frauen schützen sich davor durch ihre Höhenangst. Unterstützt werden sie dabei von ihrer Bequemlichkeit: Sie haben sich doch alles so schön eingerichtet – und auf die guten Seiten wollen sie auch keinesfalls verzichten – nicht auf das Geld, den attraktiven Mann, die schöne heile Welt. Bequemlichkeit ist nicht nur ein Übel, sie ist eine Falle."
Wie Frauen immer wieder in diese Falle stolpern, das zeigt Bascha Mika unerbittlich auf. Mit Larmoyanz und Schuldzuweisungen gegen Männer hat sie nichts am Hut. Natürlich finden es viele von ihnen praktisch, wenn die Ehefrau zuhause putzt. Das leugnet sie nicht. Heute aber könnten Frauen anders, wenn sie nur wollten.
Bascha Mika: Die Feigheit der Frauen (MP3-Audio) Bascha Mika: Die Feigheit der Frauen: Rollenfallen und Geiselmentalität. Eine Streitschrift wider den Selbstbetrug. Vier CDs bei Random House Audio.
Wenn sich zwei Politiker unterschiedlicher Generationen treffen, um über Gesellschaft, Banken und die eigene Partei zu sprechen, dann sorgt das Ereignis allemal für Aufmerksamkeit. Besonders wenn Helmut Schmidt, einst Bundeskanzler, mit Peer Steinbrück, Ex-Ministerpräsident und -Finanzminister, stundenlang plaudert. Dabei wird klar: Schmidt empfiehlt seinen Freund Steinbrück als den idealen Kanzler-Kandidaten der SPD.
Doch das allein wäre wohl nicht ausreichend, sich den Gedankenaustausch anzuhören. Es sind vielmehr Analysen, die die Unterhaltung zu einem interessanten Diskurs über den Zustand der Politik werden lassen. Zum Beispiel die Finanzkrise.
Schmidt: "Ich hatte eine Auseinandersetzung im Jahre 1998 mit einem Mann, der hieß Bill McDonough; er leitete die Zentralbank in New York."
Steinbrück: "Ja. Ich war bei ihm."
Schmidt: "Er und Greenspan, die beiden hatten damals die Rettung eines großen Hedgefonds beschlossen. Ich war der Meinung: ‚Lasst sie pleitegehen.’ Und diese beiden Herren waren der Meinung: ‚Die Konsequenzen sind zu schrecklich, denn der reißt soundso viele Leute, die ihm Geld geliehen haben, mit in den Konkurs.’ Mein Argument war: ‚Lasst sie in Konkurs gehen, das wird eine Lehre sein für all die übrigen.’ Durchgesetzt haben sich damals natürlich Greenspan und McDonough. Da fängt der Fehler an. Das war heute vor 13 Jahren."
Steinbrück: "Diesen Fehler habe ich letztlich auch gemacht. Vor dieser Frage stand ich exakt Ende Juli 2007 bei einer ganz kleinen Bank in Düsseldorf, die hieß IKB. Da hatte ich eine Telefonkonferenz, die ich mein Leben lang nicht vergessen werde; zugeschaltet waren der Bundesbankpräsident Weber, Herr Sanio von der BaFin, die Köpfe der drei großen Bankenverbände für die Öffentlich-Rechtlichen, für die Genossenschaften, der Bundesverband der Deutschen Banken. Und ich stellte als erstes die Frage: ‚Warum lassen wir die nicht pleitegehen?’ Und daraufhin lautete versammelte Auffassung aller Beteiligten: ‚Wenn Sie die pleitegehen lassen, Herr Steinbrück, dann haben Sie es mit Ansteckungsgefahren zu tun, die unabsehbar sind, weil eine Reihe von institutionellen Anlegern dort dann entsprechende Abschreibungen und Wertberichtigungen vornehmen müssen und damit Dominosteineffekte ausgelöst werden. Das Ergebnis war, dass wir die IKB gerettet haben."
Schmidt: "Das heißt, Sie haben damals so gehandelt, wie alle Staaten der Welt dann anschließend gehandelt haben. Und insgesamt stellt es sich heraus als ein Fehler."
Steinbrück: "Nur das Problem ist für politische Entscheider, dass sie das immer erst hinterher wissen. Sie müssen entscheiden in kürzester Zeit, bei unvollständigen Informationen. Und das ist der Unterschied zwischen Politikern und Journalisten."
Gerade in der Finanz- und Wirtschaftspolitik stellen die beiden Politiker ihrer eigenen Partei kein gutes Zeugnis aus. Es sei eine Schwäche der deutschen Sozialdemokratie, dass sie immer nur ausnahmsweise Personen hervorgebracht habe mit ausreichendem Sachverstand für das Amt, sagt Helmut Schmidt:
Schmidt: "Die deutsche Sozialdemokratie ist dadurch gekennzeichnet – und zum Teil müsste man sagen, sie krankt daran –, dass für sie die Sozialversicherung unendlich viel wichtiger ist als die Aufsicht über die geldgierigen Investmentbanker."
Steinbrück: "Man kann es noch schärfer formulieren: Man reüssiert in der SPD am besten mit sozialpolitischen Themen, aber nicht mit finanzpolitischen Themen. Es ist den konservativ-liberalen Parteien natürlich schon gelungen, die SPD durchgängig zu diskreditieren. Dass sie eigentlich irgendeine Variante des Sozialismus einführen will. Dass sie ein - im marktwirtschaftlichen Glaubensbekenntnis besehen - unsicherer Kantonist ist. Und es ist ihnen auch gelungen, in eine breite Bevölkerung den Verdacht immer hineinzuprojizieren, die Sozis könnten nicht mit Geld umgehen. Nach dem Motto: Wenn die Sozialdemokraten in der Wüste regieren, dann wird der Sand knapp. Mein Eindruck ist im Augenblick, das könnte kippen. Das könnte kippen. So, wie ich die derzeitige Wahrnehmung der Bundesregierung in diesen Kreisen wahrnehme, kann es gut sein, dass die als zukünftige Multiplikatoren einer Politik von CDU, CSU und FDP nicht mehr unbedingt dienlich sind."
Klare Worte, die überhaupt das gesamte Gespräch auszeichnen und es auch deswegen hörenswert machen. Typisch für den altersweisen Helmut Schmidt und den scharfen Denker Peer Steinbrück: Ironie und Witz, die immer wieder durchfunkeln und beiden offensichtlich Vergnügen bereiten:
Schmidt: "Die Deutschen lassen sich leichter ängstigen als ihre Nachbarn in Europa."
Steinbrück: "Die Bereitschaft der Deutschen, sich zu ängstigen, die ist sehr stark ausgeprägt. Ich wundere mich immer, wie häufig wir uns vergiften, aber das Durchschnittsalter unserer Bevölkerung immer weiter hochgeht."
Schmidt: "Ja, und die Riesengefahr des Nikotins! Sieht man an mir. Ich rauche jeden Tag zwei, drei Päckchen und lebe immer noch!"
Steinbrück: "Aber da sind Sie nun auch die absolute Ausnahme. (lacht) Im Übrigen hat Ihr Arzt gesagt, dass Ihr gesamter Stoffwechsel zusammenbricht, wenn Sie nicht mehr rauchen."
Schmidt: "Ja. Das brauchte er mir gar nicht zu sagen, das weiß ich sogar selber. (Beide lachen) Das ist auch so eine Hysteritis, allerdings nicht auf Deutschland beschränkt. Das ist genauso schlimm in Amerika, genauso schlimm in Kanada."
Steinbrück: "Stimmt es denn auch, dass Sie auf dem Capitol Hill in Washington geraucht haben?"
Schmidt: "Ja, selbstverständlich."
Steinbrück: "Dann sind Sie wahrscheinlich der einzige Deutsche, dem man das durchgehen lassen hat." (lacht)"
Schmidt: Ein bisschen Ansehen hatte ich. (Beide lachen)
Helmut Schmidt und Peer Steinbrück: Zug um Zug (MP3-Audio) Zug um Zug – ein Gespräch zwischen Helmut Schmidt und Peer Steinbrück, aufgezeichnet im Sommer 2011. Ein Hoffmann-und-Campe-Hörbuch mit 3 CDs.
Es gibt wohl keinen zweiten in Deutschland, der das literarische Leben der letzten Jahrzehnte so begleitet hat wie Heinz Ludwig Arnold. Sei es als Herausgeber etwa des Kritischen Lexikons zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, sei es als Autor, als Kritiker und Rezensent – oder als Gesprächspartner. Und was waren das für Gespräche! Arnold interviewt die vielen Nachkriegsautoren nicht einfach: Er ringt mit ihnen, oft zwei, drei Stunden lang. Um ihre Literatur, um Politik und um das Selbstverständnis einer ganzen Generation von Schriftstellern. Stets politisch, stets persönlich, und oft sehr grundsätzlich.
Mit Hans Magnus Enzensberger zum Beispiel, im September 1973. Die beiden Männer liegen entspannt auf dem Fußboden, auf einem flauschigen Teppich, das Mikrofon zwischen ihnen.
Enzensberger: ""Ich bin ja schon seit 15 Jahren berufstätig."
Arnold: "Als was?"
Enzensberger: "Als Schreiber."
Arnold: "Als freier Schriftsteller?"
Enzensberger: "Ja, als Produzent von Schriftstücken, die dann vervielfältigt und verkauft werden."
Arnold: "Als Literaturproduzent?"
Enzensberger: "Ich hab’ das Wort absichtlich vermieden. Das ist ja schon eine Einschränkung, deswegen. Man muss den neutralsten Ausdruck wählen. Einer, der vom Verkauf seiner Schriften lebt."
Arnold: "Ist Dichter eigentlich ein Beruf?"
Enzensberger: "Ich glaub’ nicht. Es steht auch nicht in meinem Pass."
Arnold: "Aber Sie sind einer."
Enzensberger: "Ja, ich hab’ auch… unter den Schriften, die ich angefertigt habe, haben sich auch Gedichte befunden."
Arnold: "Fertigt man denn Gedichte genauso an wie man etwa Gespräche zwischen Marx und Engels macht?"
Enzensberger: "Das könnte man schon. Also die Möglichkeit lässt sich doch nicht ausschließen. Schauen Sie, wenn ich zum Beispiel von Ihnen einen Auftrag bekommen würde, einen Sonettenkranz zu liefern – ich weiß nicht ob ich den Auftrag annehmen würde, aber wenn ich ihn annehmen würde, gäbe es nur eine Möglichkeit, den Auftrag auszuführen. Nämlich durch Ausfertigung."
Max Frisch, Peter Handke, Jurek Becker, Walter Kempowski, Martin Walser – die Liste der Gesprächspartner ist noch länger. Insgesamt umfassen die Aufnahmen rund 64 Stunden, die nun als Hörbuch erschienen sind. Weitgehend ungeschnitten, zum Glück: Im Hintergrund hören wir Familien, die das Abendessen zubereiten, im Hof die Kreissäge des Nachbarn, und direkt an unseren Ohren das Feuerzeug, mit dem all die Zigaretten, Pfeifen und Zigarren angezündet werden.
Heinrich Böll erklärte nach dem Gespräch im Jahr 1971, er habe noch nie so ausführlich über sein Leben gesprochen. Über Erfolg und Kritik.
Böll: "Ich glaube, dass zum Wesen der Autorschaft, drücken wir es ein bisschen pathetisch aus, die Fähigkeit, fürchterliche Knüppelschläge hinzunehmen, dazugehört."
Arnold: "Und die wächst ja auch mit der Zeit."
Böll: "Und das ist die einzige Ähnlichkeit, die zwischen einem Autor und einem Boxer besteht."
Arnold: "Nur dass beim Boxen zwei da sind und Sie zurückschlagen können."
Böll: "Ja, das kann man nicht. Das kann man nicht, und das ist vielleicht eine sadistische Komponente in dem Gewerbe."
Arnold: "Oder eine masochistische!"
Böll: "Ja. Ja. "
Arnold: "Würden Sie denn sagen, dass Sie von der Kritik im Laufe Ihrer schriftstellerischen Entwicklung prinzipiell… - dass die Kritik Ihnen gerecht geworden ist?"
Böll: "Nicht ungerecht, würde ich sagen."
Alle diese Gespräche sind sehr verbindlich – auch wenn Böll eine Frage dann doch zu persönlich ist.
Böll: "Über Religion rede ich nicht. Das ist mir zu peinlich. Das ist mir auch zu privat."
Heinz Ludwig Arnold respektiert solche Wünsche, er gibt seinen Gesprächspartnern Raum, aber er insistiert auch und diskutiert. Günter Grass trifft er gleich dreimal, immer im Abstand von drei bis vier Jahren. Das erste Gespräch, 1970, beginnt gleich mit einer Panne: Heinz Ludwig Arnold bemerkt erst nach einer Viertelstunde, dass das Aufnahmegerät nicht läuft. Er schaltet es ein.
Arnold: "Sollen wir das noch mal ganz kurz rekapitulieren? Oder die Fragen nur ganz…"
Grass: "…das läuft sicher in andere Geschichten hinein."
Arnold: "Sollen wir weitermachen einfach?"
Grass: "Ja."
Arnold: "Also diese provozierende Frage war das jedenfalls. Die war wirklich nur…"
Grass: "Ja stellen Sie die doch noch mal!"
Arnold: "Es gab und gibt Stimmen, die immer noch jeden Roman, jede zusammenhängende Fabel, es gibt andere, die Gedichte für reaktionär halten, vom herkömmlichen Theater ganz zu schweigen. Sind Sie also ein reaktionärer Schriftsteller?"
Wie politisch dürfen und müssen Kunst und Künstler sein? Diese Frage ist immer gegenwärtig. Auch 1974: Günter Grass hatte die SPD und Willy Brandt immer wieder unterstützt und zieht bitter sein Resümee.
Arnold: "Sind Sie denn nun, einmal ganz grob gesprochen, von Ihrem Einsatz für die Politik im Grunde doch ein bisschen enttäuscht?"
Grass: "Ja nicht nur ein bisschen. Ich bin ziemlich enttäuscht, selbstverständlich! Wenn jemand jahrelang sehr viel in das investiert, und er sich nicht selbst beschwindeln will, dann kann er sich auch mit den vorzeigbaren Ergebnissen dieser Arbeit, der Arbeit der Partei, die man unterstützt hat, und auch der eigenen Leistungen, die ich nicht kleinschreiben will, kann er sich dennoch damit nicht trösten. Denn wenn ich nicht mehr gewollt hätte, wäre ein so jahrelanges Engagement gar nicht durchzuhalten gewesen."
Arnold: "Ja."
Es waren die Jahre der politischen Literatur. Allzu enger Kontakt zu Parteien war aber auch unter Schriftstellern umstritten. Das macht Friedrich Dürrenmatt deutlich.
Dürrenmatt: "Ich glaube, ein Schriftsteller hat die Pflicht, - ich würde das jetzt grotesk ausdrücken - nicht in einer Partei zu sein. Weil seine Chance darin besteht, dass er keine Partei nötig hat. Das heißt nicht, dass er selbstverständlich als Stimmbürger eine bestimmte Partei unterstützen kann. Da ist er nun wie jeder Stimmbürger vor eine Wahl gestellt."
Arnold: "Würden Sie denn auch es für gut halten, was Günter Grass zum Beispiel macht, der seit vielen Jahren für die SPD außerhalb der SPD trommelt."
Dürrenmatt: "Ich würde jetzt das nicht als ‚Trommeln’ bezeichnen. Er ist kein Mitläufer, sondern ein Begleiter des Sozialismus. Und insofern bin ich ja auch ein Begleiter des Sozialismus – nicht, würde ich sagen, der Sozialistischen Partei der Schweiz, sondern des Sozialismus, der naturgemäß kommen muss, will diese Welt nicht in einer ungeheuren Willkür versinken."
Wir sitzen mit am Tisch, so der Eindruck. Wir hören all die Klassiker der Nachkriegsliteratur, wie sie langsam und sorgfältig ihre Gedanken entwickeln. Diese Gespräche, das kann man ohne Übertreibung sagen, sind selbst Literaturgeschichte. Und das verdanken wir Heinz Ludwig Arnold. Er ist am 1. November gestorben, im Alter von 71 Jahren. Kurz davor sind seine Gespräche als Hörbuch erschienen. Wie ein Vermächtnis.
Heinz Ludwig Arnold: Meine Gespräche mit Schriftstellern 1970 - 1999 (MP3-Audio) Heinz Ludwig Arnold: Meine Gespräche mit Schriftstellern 1970 bis 1999. Erschienen auf drei einzelnen CDs im mp3-Format. Quartino-Verlag.
Erstaunlich viele Bücher hat Rudolf Ditzen geschrieben… Sie kennen ihn nicht? Sicher aber Hans Fallada. Unter diesem Namen veröffentlichte er seine Werke, von denen einige weltbekannt und Klassiker wurden: "Kleiner Mann – was nun?" oder "Wer einmal aus dem Blechnapf frisst". Und: "Jeder stirbt für sich allein". Sein letztes Buch, lange vergessen und jetzt, über 60 Jahre nach seinem Tod, erstmals in der ursprünglichen Fassung neu veröffentlicht - auch als Hörbuch, allerdings gekürzt.
Basierend auf dem wahren Schicksal eines hingerichteten Ehepaares spiegelt Hans Fallada den Zustand der Berliner Gesellschaft wider. Er erzählt von den kleinen Leuten, von Otto und Anna Quangel, die mit Postkarten gegen "den Führer und die Partei, gegen den Krieg" aufrufen:
"Wir schreiben 1940, die Ausplünderung der überfallenen Völker hat begonnen, das deutsche Volk hat keine großen Entbehrungen zu tragen. Eigentlich ist noch fast alles zu haben, und noch nicht einmal übermäßig teuer. Und was den Krieg selbst angeht, so wird er in fremden Ländern fern von Berlin ausgetragen. Ja, es erscheinen schon dann und wann englische Flugzeuge über der Stadt. Dann fallen ein paar Bomben, und die Bevölkerung macht am nächsten Tage lange Wanderungen, um die Zerstörungen zu besichtigen. Die meisten lachen dann und sagen: "Wenn die uns so erledigen wollen, brauchen sie hundert Jahre dazu, und dann ist noch immer nicht viel davon zu merken. Unterdes radieren wir ihre Städte vom Erdboden aus!"
Die meisten Menschen laufen dem Erfolg nach. Ein Mann wie Otto Quangel, der mitten im Erfolg aus der Reihe tritt, ist eine Ausnahme. Er sitzt da. Er hat noch Zeit, noch muss er nicht in die Fabrik. Aber jetzt ist die Unruhe der letzten Tage von ihm abgefallen.
Dann, als seine Zeit gekommen ist, zahlt er und macht sich auf den Weg in die Fabrik. Obwohl es ein weiter Weg ist vom Alexanderplatz aus, geht er ihn zu Fuß. Trotzdem Quangel sich jetzt für ein ganz anderes Leben entschlossen hat, wird er an den bisherigen Gewohnheiten nichts ändern. Er wird weiter sparsam bleiben und sich die Menschen vom Leibe halten.
Schließlich steht er wieder in seiner Werkstatt, aufmerksam und wach, wortlos und abweisend, ganz wie immer. Ihm ist nichts anzusehen von dem, was in ihm vorgegangen ist. Niemand wird ihm etwas anmerken. Für alle steht sein Bild fest: ein alter Trottel, von einem schmutzigen Geiz besessen, nur für seine Arbeit interessiert. Das ist das Bild, und so soll es auch bleiben."
Ulrich Noethens Interpretation macht begreiflich, wie der Schauer des Alltäglichen und des Grausamen in Zeiten des Nationalsozialismus über die Gesellschaft kam.
Hans Fallada: Jeder stirbt für sich allein (MP3-Audio) Hans Fallada: Jeder stirbt für sich allein. 8 CDs. Ein Hörbuch von Osterwold-Audio.
Nach der fiktionalen Schilderung des Widerstands im Dritten Reich wenden wir uns zum Ende dieser Lesart einer fast protokollarischen Aufzeichnung aus dem Jahr 1933 zu. Wie man den Weihnachtsmorgen verbrachte. Genauer: Thomas Mann samt Familie.
"Stand halb neun Uhr auf. Frühstück an dem ausgezogenen Familientisch mit Kaviar und Stollen. Die Kinder, noch gestern Abend spät befragt, was von Weihnachten das Schönste gewesen sei, erklärten: "Als Herr Papale bei Tisch einen Juden nachmachte."
Die Tagebuchauszüge des Schriftstellers sind sehr genau. Thomas Mann führt die Gästelisten auf, wer wann zum Essen kam, erwähnt den Nebel und die eigene schlechte Laune. Dazwischen blitzt immer wieder die Politik auf. Sein Ärger über die Nazis, und darüber, dass die Kinder in der Schule das Horst-Wessel-Lied pauken müssen.
Jahr um Jahr vergeht, immer wieder hören wir das einsilbige Tagesbuch des sonst so wortreichen Thomas Mann - beeindruckend karg gelesen von Hanns Zischler.
"Missmut wegen nachteiliger Wirkung der Umarbeitung auf das Grammophon. Unleidliches Nadelgeräusch. Zum Protestieren. Regen."
Zwischen diesen lakonischen Einträgen: historische Einordnungen. Die weitläufige Familie verändert sich, neue Gäste kommen hinzu. Die Manns fliehen vor dem Dritten Reich ins Exil, feiern in Princeton, und bekommen eine Weihnachtsbotschaft vom Präsidenten.
"Vor der Bescherung Versammlung der Kinder im Arbeitszimmer und Gesang. Baum, mit dünnen Kerzen brennend, schöner englischer Shakespeare, Pyjama, Platten et cetera. Reiche Gaben überall. Blumentöpfe und Süßigkeiten. Abendessen mit Kerzenbeleuchtung, festlich angenehmes Bild. Champagner. Kaffee. Unterhaltung in der neuen Sitzecke bei Champagner und Baumkuchen bis ein Uhr. Den ganzen Tag die Seltsamkeit der Situation sehr lebhaft empfunden. Erstes Weihnachten in Amerika. Die Möglichkeiten der Zukunft immer wieder erörtert."
Dreieinhalb Jahrzehnte umfassen diese Weihnachtsprotokolle und reichen bis ins Jahr 1954. Da leben die Manns bereits in der Schweiz.
Eine politische Familiengeschichte in gerade mal einer Stunde: Thomas Mann: Weihnachten bei den Manns (MP3-Audio) Weihnachten bei den Manns. Der Hörverlag.
Diese Hörbücher gibt es auch als gedruckte Bücher:
Christiane Paul:
"Das Leben ist eine Öko-Baustelle. Mein Versuch, ökologisch bewusst zu leben"
Verlag: Ludwig, 288 Seiten, 19,99 Euro
Bascha Mika:
"Die Feigheit der Frauen. Rollen fallen und Geiselmentalität. Eine Streitschrift wider den Selbstbetrug"
Verlag: C. Bertelsmann, 256 Seiten, 14,99 Euro
Helmut Schmidt & Peer Steinbrück:
"Zug um Zug – Ein Gespräch"
Verlag: Hoffmann und Campe
320 Seiten, 24,99 Euro
Programmhinweis:
Die nächste Ausgabe der Lesart am Neujahrstag dreht sich um den Preußenkönig Friedrich II. und um dessen 300. Geburtstag im kommenden Jahr.
Nur so kann das Ziel erreicht werden, die Erderwärmung zu begrenzen, mahnt Christiane Paul. Die Schauspielerin und Ärztin ist besorgt über den Zustand unserer Welt. In ihrem Hörbuch "Das Leben ist eine Öko-Baustelle" beschreibt sie ihren Versuch, umweltbewusst zu leben:
"Ich kann nicht sagen, dass ich ein Aha- oder Erweckungserlebnis hatte im Sinne von: Ich sehe Vögel am Strand mit einem Ölfilm und von Stund an war ich ein Öko. Ich weiß aber, dass sich das irgendwann im Laufe des Jahres 2006 bei mir so weit entwickelt hatte, dass ich dachte: So geht es nicht weiter. Richtig alarmiert haben mich dann die Zahlen und Berichte über den Klimawandel, die Ende 2006 und Anfang 2007 veröffentlicht wurden. Das war für mich die ökologische Wende. Ich fing an, alles zu lesen, was ich in die Hände kriegen konnte. Darüber, welche Arten aussterben, was an den Polen passiert, wie sich die Atmosphäre seit der industriellen Revolution verändert hat. Ich konnte nicht mehr beim Informieren, beim Nachdenken und Reden stehen bleiben und begann, mich intensiv mit den Veränderungsmöglichkeiten meines Lebensstils und meines Konsums zu beschäftigen und zu sehen, was ich wie verändern und verbessern könnte. Wir können nicht erwarten, dass sich anderswo was tut, ehe wir etwas tun. Meine Kinder sind eine starke Motivation. Aber noch stärker treibt mich eine andere Frage um. Ich denke weniger: Was für eine Welt hinterlasse ich denen? Ich denke: Was tun wir der Welt, was tun wir dem Planeten, was tun wir uns an? Ich bin kein Naturfreak, ich liebe auch nicht die Tiere mehr als die Menschen. Aber wenn ich bestimmte Bilder sehe, wie der Mensch alles gnadenlos abholzt und ausbeutet und nichts mehr übrig lässt, da frage ich mich dann auch: Werden meine Kinder 50, 60 Jahre alt? In welcher Welt?"
Natürlich müsste die Politik den großen Umbau für das Klima und den Umgang mit Ressourcen hinbekommen. Christiane Paul aber bezweifelt, dass die Politik überhaupt konsequent die großen ökologischen Themen angehen will. In Gesprächen mit Wissenschaftlern, Ernährungsberatern und Politikern hat sie sich intensiv mit dem Zustand der Erde und mit Umweltproblemen – im Großen wie im Kleinen – beschäftigt. Der Ansatz für ein Umdenken liegt für sie bei jedem Einzelnen, im persönlichen Alltag: nämlich in der Bereitschaft, Lebensgewohnheiten zu ändern:
"Meine grundsätzliche Einstellung zum Essen von Fleisch ist eindeutig. Erstens: Ich finde, der Mensch kann Fleisch essen. Zweitens: Der Mensch muss nicht Fleisch essen. Drittens: Der Mensch sollte weitaus weniger Fleisch essen, als heute produziert und konsumiert wird. Ernährungswissenschaftler sagen, dass der Mensch auf Fleisch verzichten kann, wenn er sich sein Protein, anders holt: über Hülsenfrüchte, also Bohnen, Sojabohnen, Erbsen, Linsen, Nüsse. Für mich ist das entscheidende und massive Problem die Massentierhaltung, die genetische Veränderung der Tiere, die fürchterlichen Lebensbedingungen nach den Vorgaben der industriellen Landwirtschaft und die Art, wie sie getötet werden. Wie der US-amerikanische Lebensmittelphilosoph Michael Pollan sagt: 'Das Problem ist nicht das Fleisch, das Problem ist die Fleischfabrik.'"
Akribisch, oft sehr ins Detail gehend, erzählt Christiane Paul über Diskussionen mit der Familie und mit Freunden. Dabei ist ihr bewusst, wie schnell man im täglichen Leben an die eigenen Grenzen stößt und wie leicht man anderen mit "Bekehrungsversuchen" auf die Nerven geht:
"Manche Leute denken vielleicht, weil ich Ärztin bin oder war, würde ich Bioernährung wegen des gesundheitlichen Aspekts bevorzugen. Das ist nicht so. Ich lebe nicht nach einer Ich-muss-mich-gesund-ernähren-Formel. Ich rauche gern mal eine Zigarette und ich trinke auch gern mal ein Glas Wein. Abgesehen davon ernähre ich mich relativ gesund. Und ich mache Sport. Man kann nicht sagen, dass ich beim Einkaufen von Lebensmitteln kreativ bin. Im Gegenteil: Ich kaufe immer dasselbe ein. Das sind Lebensmittel, von denen ich weiß, dass sie mir oder uns schmecken. Und es sind zum Großteil Biolebensmittel. Bei mir kommt auch eindeutig der subjektive Genussfaktor dazu. Bio sieht für mich besser aus und schmeckt mir besser. Manchmal schaue ich in meine Tasche und denke: Viel ist das ja nicht für 30 Euro. Aber ich habe mich grundsätzlich entschlossen, mehr Geld für Lebensmittel auszugeben, weil ich es wichtig finde und weil es mir das wert ist – mehr Qualität für weniger Quantität. Ich bin mir bewusst, dass das eine sehr privilegierte Position ist, in der ich mich befinde, und dass es Familien und Haushalte gibt, die diese Entscheidung, bio oder konventionell, nicht haben. Vielen bleibt oft nur der Weg zum Discounter. Doch selbst da kann ich wählen und auf die Produkte zurückgreifen, die am wenigsten aufbereitet oder vorgefertigt sind."
Christiane Paul: Das Leben ist eine Öko-Baustelle (MP3-Audio) Das Leben ist eine Öko-Baustelle ist ein kluges und sehr engagiertes Plädoyer. Die Leidenschaft merkt man Christiane Paul auch an, die das Hörbuch selbst gesprochen hat. Erschienen sind die 3 CDs bei Der-Audio-Verlag.
Es gibt viel zu tun, das meint auch die Journalistin Bascha Mika. Sie will aber nicht Tiere und Umwelt schützen, sondern sorgt sich um die Gleichberechtigung der Frauen. Das klingt zunächst wie ein Thema von gestern. Aber Bascha Mika macht rasch klar: Auch heute noch laufen Frauen reihenweise in die "Rollenfalle". Im Gegensatz zu früher sind sie aber selbst schuld, argumentiert sie – und dürfte damit manche Geschlechtsgenossin vor den Kopf stoßen.
"Frauen und Männer sind hierzulande gleichberechtigt, heißt es. Doch das ist nur Theorie, nicht die Praxis. Im wirklichen Leben haben die meisten modernen Paare die Aufgaben untereinander geteilt wie die Eltern und Großeltern – hübsch entlang der Geschlechtergrenzen. Selbst die jetzt 20- und 30-jährigen. Auch wenn Väter einen hooper-trooper-Kinderwagen schieben und Mütter am Sandkasten mit einem Smartphone spielen, hat sich nicht wirklich etwas verändert. Es scheint nur so. Das Grundmuster ist erschreckend gleich geblieben: Der Mann als Versorger draußen in der Welt, die Frau daheim bei Haus und Kindern, vielleicht mit einem Halbtagsjob. Er zahlt bar, sie mit Lebenszeit und Eigenständigkeit. Ein schleichender Prozess der weiblichen Selbstabwertung. Doch der Unterschied zu früheren Generationen ist eklatant: Heute haben Frauen die Wahl. Ihr Los ist selbst gezimmert."
Andrea Sawatzki liest das kämpferische Buch mit dem Titel: "Die Feigheit der Frauen. Eine Streitschrift wider den Selbstbetrug". Denn genau das wirft sie ihrem Geschlecht vor: Dass Frauen unabhängig von Alter und Bildungsstand sich den alten Rollenmustern anpassen, und zwar freiwillig. Über das eigene Unbehagen, wenn sie nach Studium und mit bester Qualifikation zur windelwechselnden Hausfrau werden, darüber versuchen sie dann hinwegzusehen. In vielen Gesprächen habe sie immer wieder die gleichen Ausreden für ein fremdbestimmtes Leben gehört, meint Bascha Mika: Dass das Leben sich rein zufällig so entwickelt hat, dass es schon passen würde. In Wirklichkeit aber, sagt die ehemalige "taz"-Chefredakteurin, hätten Frauen Angst vor Wettbewerb, vor dem Risiko – sie seien schlicht feige.
"Mut gehört nicht zum Standardrepertoire in der weiblichen Welt. Feigheit durchaus. Die Angst, etwas zu verlieren, macht Frauen zu Weichlingen. Denn zu verlieren gibt es viel: vom Selbstbild des sanften, friedfertigen Wesens über das gewohnte Leben bis hin zur Liebe eines Mannes. Wer den Mut hat, hoch zu klettern, kann auch tief fallen. Frauen schützen sich davor durch ihre Höhenangst. Unterstützt werden sie dabei von ihrer Bequemlichkeit: Sie haben sich doch alles so schön eingerichtet – und auf die guten Seiten wollen sie auch keinesfalls verzichten – nicht auf das Geld, den attraktiven Mann, die schöne heile Welt. Bequemlichkeit ist nicht nur ein Übel, sie ist eine Falle."
Wie Frauen immer wieder in diese Falle stolpern, das zeigt Bascha Mika unerbittlich auf. Mit Larmoyanz und Schuldzuweisungen gegen Männer hat sie nichts am Hut. Natürlich finden es viele von ihnen praktisch, wenn die Ehefrau zuhause putzt. Das leugnet sie nicht. Heute aber könnten Frauen anders, wenn sie nur wollten.
Bascha Mika: Die Feigheit der Frauen (MP3-Audio) Bascha Mika: Die Feigheit der Frauen: Rollenfallen und Geiselmentalität. Eine Streitschrift wider den Selbstbetrug. Vier CDs bei Random House Audio.
Wenn sich zwei Politiker unterschiedlicher Generationen treffen, um über Gesellschaft, Banken und die eigene Partei zu sprechen, dann sorgt das Ereignis allemal für Aufmerksamkeit. Besonders wenn Helmut Schmidt, einst Bundeskanzler, mit Peer Steinbrück, Ex-Ministerpräsident und -Finanzminister, stundenlang plaudert. Dabei wird klar: Schmidt empfiehlt seinen Freund Steinbrück als den idealen Kanzler-Kandidaten der SPD.
Doch das allein wäre wohl nicht ausreichend, sich den Gedankenaustausch anzuhören. Es sind vielmehr Analysen, die die Unterhaltung zu einem interessanten Diskurs über den Zustand der Politik werden lassen. Zum Beispiel die Finanzkrise.
Schmidt: "Ich hatte eine Auseinandersetzung im Jahre 1998 mit einem Mann, der hieß Bill McDonough; er leitete die Zentralbank in New York."
Steinbrück: "Ja. Ich war bei ihm."
Schmidt: "Er und Greenspan, die beiden hatten damals die Rettung eines großen Hedgefonds beschlossen. Ich war der Meinung: ‚Lasst sie pleitegehen.’ Und diese beiden Herren waren der Meinung: ‚Die Konsequenzen sind zu schrecklich, denn der reißt soundso viele Leute, die ihm Geld geliehen haben, mit in den Konkurs.’ Mein Argument war: ‚Lasst sie in Konkurs gehen, das wird eine Lehre sein für all die übrigen.’ Durchgesetzt haben sich damals natürlich Greenspan und McDonough. Da fängt der Fehler an. Das war heute vor 13 Jahren."
Steinbrück: "Diesen Fehler habe ich letztlich auch gemacht. Vor dieser Frage stand ich exakt Ende Juli 2007 bei einer ganz kleinen Bank in Düsseldorf, die hieß IKB. Da hatte ich eine Telefonkonferenz, die ich mein Leben lang nicht vergessen werde; zugeschaltet waren der Bundesbankpräsident Weber, Herr Sanio von der BaFin, die Köpfe der drei großen Bankenverbände für die Öffentlich-Rechtlichen, für die Genossenschaften, der Bundesverband der Deutschen Banken. Und ich stellte als erstes die Frage: ‚Warum lassen wir die nicht pleitegehen?’ Und daraufhin lautete versammelte Auffassung aller Beteiligten: ‚Wenn Sie die pleitegehen lassen, Herr Steinbrück, dann haben Sie es mit Ansteckungsgefahren zu tun, die unabsehbar sind, weil eine Reihe von institutionellen Anlegern dort dann entsprechende Abschreibungen und Wertberichtigungen vornehmen müssen und damit Dominosteineffekte ausgelöst werden. Das Ergebnis war, dass wir die IKB gerettet haben."
Schmidt: "Das heißt, Sie haben damals so gehandelt, wie alle Staaten der Welt dann anschließend gehandelt haben. Und insgesamt stellt es sich heraus als ein Fehler."
Steinbrück: "Nur das Problem ist für politische Entscheider, dass sie das immer erst hinterher wissen. Sie müssen entscheiden in kürzester Zeit, bei unvollständigen Informationen. Und das ist der Unterschied zwischen Politikern und Journalisten."
Gerade in der Finanz- und Wirtschaftspolitik stellen die beiden Politiker ihrer eigenen Partei kein gutes Zeugnis aus. Es sei eine Schwäche der deutschen Sozialdemokratie, dass sie immer nur ausnahmsweise Personen hervorgebracht habe mit ausreichendem Sachverstand für das Amt, sagt Helmut Schmidt:
Schmidt: "Die deutsche Sozialdemokratie ist dadurch gekennzeichnet – und zum Teil müsste man sagen, sie krankt daran –, dass für sie die Sozialversicherung unendlich viel wichtiger ist als die Aufsicht über die geldgierigen Investmentbanker."
Steinbrück: "Man kann es noch schärfer formulieren: Man reüssiert in der SPD am besten mit sozialpolitischen Themen, aber nicht mit finanzpolitischen Themen. Es ist den konservativ-liberalen Parteien natürlich schon gelungen, die SPD durchgängig zu diskreditieren. Dass sie eigentlich irgendeine Variante des Sozialismus einführen will. Dass sie ein - im marktwirtschaftlichen Glaubensbekenntnis besehen - unsicherer Kantonist ist. Und es ist ihnen auch gelungen, in eine breite Bevölkerung den Verdacht immer hineinzuprojizieren, die Sozis könnten nicht mit Geld umgehen. Nach dem Motto: Wenn die Sozialdemokraten in der Wüste regieren, dann wird der Sand knapp. Mein Eindruck ist im Augenblick, das könnte kippen. Das könnte kippen. So, wie ich die derzeitige Wahrnehmung der Bundesregierung in diesen Kreisen wahrnehme, kann es gut sein, dass die als zukünftige Multiplikatoren einer Politik von CDU, CSU und FDP nicht mehr unbedingt dienlich sind."
Klare Worte, die überhaupt das gesamte Gespräch auszeichnen und es auch deswegen hörenswert machen. Typisch für den altersweisen Helmut Schmidt und den scharfen Denker Peer Steinbrück: Ironie und Witz, die immer wieder durchfunkeln und beiden offensichtlich Vergnügen bereiten:
Schmidt: "Die Deutschen lassen sich leichter ängstigen als ihre Nachbarn in Europa."
Steinbrück: "Die Bereitschaft der Deutschen, sich zu ängstigen, die ist sehr stark ausgeprägt. Ich wundere mich immer, wie häufig wir uns vergiften, aber das Durchschnittsalter unserer Bevölkerung immer weiter hochgeht."
Schmidt: "Ja, und die Riesengefahr des Nikotins! Sieht man an mir. Ich rauche jeden Tag zwei, drei Päckchen und lebe immer noch!"
Steinbrück: "Aber da sind Sie nun auch die absolute Ausnahme. (lacht) Im Übrigen hat Ihr Arzt gesagt, dass Ihr gesamter Stoffwechsel zusammenbricht, wenn Sie nicht mehr rauchen."
Schmidt: "Ja. Das brauchte er mir gar nicht zu sagen, das weiß ich sogar selber. (Beide lachen) Das ist auch so eine Hysteritis, allerdings nicht auf Deutschland beschränkt. Das ist genauso schlimm in Amerika, genauso schlimm in Kanada."
Steinbrück: "Stimmt es denn auch, dass Sie auf dem Capitol Hill in Washington geraucht haben?"
Schmidt: "Ja, selbstverständlich."
Steinbrück: "Dann sind Sie wahrscheinlich der einzige Deutsche, dem man das durchgehen lassen hat." (lacht)"
Schmidt: Ein bisschen Ansehen hatte ich. (Beide lachen)
Helmut Schmidt und Peer Steinbrück: Zug um Zug (MP3-Audio) Zug um Zug – ein Gespräch zwischen Helmut Schmidt und Peer Steinbrück, aufgezeichnet im Sommer 2011. Ein Hoffmann-und-Campe-Hörbuch mit 3 CDs.
Es gibt wohl keinen zweiten in Deutschland, der das literarische Leben der letzten Jahrzehnte so begleitet hat wie Heinz Ludwig Arnold. Sei es als Herausgeber etwa des Kritischen Lexikons zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, sei es als Autor, als Kritiker und Rezensent – oder als Gesprächspartner. Und was waren das für Gespräche! Arnold interviewt die vielen Nachkriegsautoren nicht einfach: Er ringt mit ihnen, oft zwei, drei Stunden lang. Um ihre Literatur, um Politik und um das Selbstverständnis einer ganzen Generation von Schriftstellern. Stets politisch, stets persönlich, und oft sehr grundsätzlich.
Mit Hans Magnus Enzensberger zum Beispiel, im September 1973. Die beiden Männer liegen entspannt auf dem Fußboden, auf einem flauschigen Teppich, das Mikrofon zwischen ihnen.
Enzensberger: ""Ich bin ja schon seit 15 Jahren berufstätig."
Arnold: "Als was?"
Enzensberger: "Als Schreiber."
Arnold: "Als freier Schriftsteller?"
Enzensberger: "Ja, als Produzent von Schriftstücken, die dann vervielfältigt und verkauft werden."
Arnold: "Als Literaturproduzent?"
Enzensberger: "Ich hab’ das Wort absichtlich vermieden. Das ist ja schon eine Einschränkung, deswegen. Man muss den neutralsten Ausdruck wählen. Einer, der vom Verkauf seiner Schriften lebt."
Arnold: "Ist Dichter eigentlich ein Beruf?"
Enzensberger: "Ich glaub’ nicht. Es steht auch nicht in meinem Pass."
Arnold: "Aber Sie sind einer."
Enzensberger: "Ja, ich hab’ auch… unter den Schriften, die ich angefertigt habe, haben sich auch Gedichte befunden."
Arnold: "Fertigt man denn Gedichte genauso an wie man etwa Gespräche zwischen Marx und Engels macht?"
Enzensberger: "Das könnte man schon. Also die Möglichkeit lässt sich doch nicht ausschließen. Schauen Sie, wenn ich zum Beispiel von Ihnen einen Auftrag bekommen würde, einen Sonettenkranz zu liefern – ich weiß nicht ob ich den Auftrag annehmen würde, aber wenn ich ihn annehmen würde, gäbe es nur eine Möglichkeit, den Auftrag auszuführen. Nämlich durch Ausfertigung."
Max Frisch, Peter Handke, Jurek Becker, Walter Kempowski, Martin Walser – die Liste der Gesprächspartner ist noch länger. Insgesamt umfassen die Aufnahmen rund 64 Stunden, die nun als Hörbuch erschienen sind. Weitgehend ungeschnitten, zum Glück: Im Hintergrund hören wir Familien, die das Abendessen zubereiten, im Hof die Kreissäge des Nachbarn, und direkt an unseren Ohren das Feuerzeug, mit dem all die Zigaretten, Pfeifen und Zigarren angezündet werden.
Heinrich Böll erklärte nach dem Gespräch im Jahr 1971, er habe noch nie so ausführlich über sein Leben gesprochen. Über Erfolg und Kritik.
Böll: "Ich glaube, dass zum Wesen der Autorschaft, drücken wir es ein bisschen pathetisch aus, die Fähigkeit, fürchterliche Knüppelschläge hinzunehmen, dazugehört."
Arnold: "Und die wächst ja auch mit der Zeit."
Böll: "Und das ist die einzige Ähnlichkeit, die zwischen einem Autor und einem Boxer besteht."
Arnold: "Nur dass beim Boxen zwei da sind und Sie zurückschlagen können."
Böll: "Ja, das kann man nicht. Das kann man nicht, und das ist vielleicht eine sadistische Komponente in dem Gewerbe."
Arnold: "Oder eine masochistische!"
Böll: "Ja. Ja. "
Arnold: "Würden Sie denn sagen, dass Sie von der Kritik im Laufe Ihrer schriftstellerischen Entwicklung prinzipiell… - dass die Kritik Ihnen gerecht geworden ist?"
Böll: "Nicht ungerecht, würde ich sagen."
Alle diese Gespräche sind sehr verbindlich – auch wenn Böll eine Frage dann doch zu persönlich ist.
Böll: "Über Religion rede ich nicht. Das ist mir zu peinlich. Das ist mir auch zu privat."
Heinz Ludwig Arnold respektiert solche Wünsche, er gibt seinen Gesprächspartnern Raum, aber er insistiert auch und diskutiert. Günter Grass trifft er gleich dreimal, immer im Abstand von drei bis vier Jahren. Das erste Gespräch, 1970, beginnt gleich mit einer Panne: Heinz Ludwig Arnold bemerkt erst nach einer Viertelstunde, dass das Aufnahmegerät nicht läuft. Er schaltet es ein.
Arnold: "Sollen wir das noch mal ganz kurz rekapitulieren? Oder die Fragen nur ganz…"
Grass: "…das läuft sicher in andere Geschichten hinein."
Arnold: "Sollen wir weitermachen einfach?"
Grass: "Ja."
Arnold: "Also diese provozierende Frage war das jedenfalls. Die war wirklich nur…"
Grass: "Ja stellen Sie die doch noch mal!"
Arnold: "Es gab und gibt Stimmen, die immer noch jeden Roman, jede zusammenhängende Fabel, es gibt andere, die Gedichte für reaktionär halten, vom herkömmlichen Theater ganz zu schweigen. Sind Sie also ein reaktionärer Schriftsteller?"
Wie politisch dürfen und müssen Kunst und Künstler sein? Diese Frage ist immer gegenwärtig. Auch 1974: Günter Grass hatte die SPD und Willy Brandt immer wieder unterstützt und zieht bitter sein Resümee.
Arnold: "Sind Sie denn nun, einmal ganz grob gesprochen, von Ihrem Einsatz für die Politik im Grunde doch ein bisschen enttäuscht?"
Grass: "Ja nicht nur ein bisschen. Ich bin ziemlich enttäuscht, selbstverständlich! Wenn jemand jahrelang sehr viel in das investiert, und er sich nicht selbst beschwindeln will, dann kann er sich auch mit den vorzeigbaren Ergebnissen dieser Arbeit, der Arbeit der Partei, die man unterstützt hat, und auch der eigenen Leistungen, die ich nicht kleinschreiben will, kann er sich dennoch damit nicht trösten. Denn wenn ich nicht mehr gewollt hätte, wäre ein so jahrelanges Engagement gar nicht durchzuhalten gewesen."
Arnold: "Ja."
Es waren die Jahre der politischen Literatur. Allzu enger Kontakt zu Parteien war aber auch unter Schriftstellern umstritten. Das macht Friedrich Dürrenmatt deutlich.
Dürrenmatt: "Ich glaube, ein Schriftsteller hat die Pflicht, - ich würde das jetzt grotesk ausdrücken - nicht in einer Partei zu sein. Weil seine Chance darin besteht, dass er keine Partei nötig hat. Das heißt nicht, dass er selbstverständlich als Stimmbürger eine bestimmte Partei unterstützen kann. Da ist er nun wie jeder Stimmbürger vor eine Wahl gestellt."
Arnold: "Würden Sie denn auch es für gut halten, was Günter Grass zum Beispiel macht, der seit vielen Jahren für die SPD außerhalb der SPD trommelt."
Dürrenmatt: "Ich würde jetzt das nicht als ‚Trommeln’ bezeichnen. Er ist kein Mitläufer, sondern ein Begleiter des Sozialismus. Und insofern bin ich ja auch ein Begleiter des Sozialismus – nicht, würde ich sagen, der Sozialistischen Partei der Schweiz, sondern des Sozialismus, der naturgemäß kommen muss, will diese Welt nicht in einer ungeheuren Willkür versinken."
Wir sitzen mit am Tisch, so der Eindruck. Wir hören all die Klassiker der Nachkriegsliteratur, wie sie langsam und sorgfältig ihre Gedanken entwickeln. Diese Gespräche, das kann man ohne Übertreibung sagen, sind selbst Literaturgeschichte. Und das verdanken wir Heinz Ludwig Arnold. Er ist am 1. November gestorben, im Alter von 71 Jahren. Kurz davor sind seine Gespräche als Hörbuch erschienen. Wie ein Vermächtnis.
Heinz Ludwig Arnold: Meine Gespräche mit Schriftstellern 1970 - 1999 (MP3-Audio) Heinz Ludwig Arnold: Meine Gespräche mit Schriftstellern 1970 bis 1999. Erschienen auf drei einzelnen CDs im mp3-Format. Quartino-Verlag.
Erstaunlich viele Bücher hat Rudolf Ditzen geschrieben… Sie kennen ihn nicht? Sicher aber Hans Fallada. Unter diesem Namen veröffentlichte er seine Werke, von denen einige weltbekannt und Klassiker wurden: "Kleiner Mann – was nun?" oder "Wer einmal aus dem Blechnapf frisst". Und: "Jeder stirbt für sich allein". Sein letztes Buch, lange vergessen und jetzt, über 60 Jahre nach seinem Tod, erstmals in der ursprünglichen Fassung neu veröffentlicht - auch als Hörbuch, allerdings gekürzt.
Basierend auf dem wahren Schicksal eines hingerichteten Ehepaares spiegelt Hans Fallada den Zustand der Berliner Gesellschaft wider. Er erzählt von den kleinen Leuten, von Otto und Anna Quangel, die mit Postkarten gegen "den Führer und die Partei, gegen den Krieg" aufrufen:
"Wir schreiben 1940, die Ausplünderung der überfallenen Völker hat begonnen, das deutsche Volk hat keine großen Entbehrungen zu tragen. Eigentlich ist noch fast alles zu haben, und noch nicht einmal übermäßig teuer. Und was den Krieg selbst angeht, so wird er in fremden Ländern fern von Berlin ausgetragen. Ja, es erscheinen schon dann und wann englische Flugzeuge über der Stadt. Dann fallen ein paar Bomben, und die Bevölkerung macht am nächsten Tage lange Wanderungen, um die Zerstörungen zu besichtigen. Die meisten lachen dann und sagen: "Wenn die uns so erledigen wollen, brauchen sie hundert Jahre dazu, und dann ist noch immer nicht viel davon zu merken. Unterdes radieren wir ihre Städte vom Erdboden aus!"
Die meisten Menschen laufen dem Erfolg nach. Ein Mann wie Otto Quangel, der mitten im Erfolg aus der Reihe tritt, ist eine Ausnahme. Er sitzt da. Er hat noch Zeit, noch muss er nicht in die Fabrik. Aber jetzt ist die Unruhe der letzten Tage von ihm abgefallen.
Dann, als seine Zeit gekommen ist, zahlt er und macht sich auf den Weg in die Fabrik. Obwohl es ein weiter Weg ist vom Alexanderplatz aus, geht er ihn zu Fuß. Trotzdem Quangel sich jetzt für ein ganz anderes Leben entschlossen hat, wird er an den bisherigen Gewohnheiten nichts ändern. Er wird weiter sparsam bleiben und sich die Menschen vom Leibe halten.
Schließlich steht er wieder in seiner Werkstatt, aufmerksam und wach, wortlos und abweisend, ganz wie immer. Ihm ist nichts anzusehen von dem, was in ihm vorgegangen ist. Niemand wird ihm etwas anmerken. Für alle steht sein Bild fest: ein alter Trottel, von einem schmutzigen Geiz besessen, nur für seine Arbeit interessiert. Das ist das Bild, und so soll es auch bleiben."
Ulrich Noethens Interpretation macht begreiflich, wie der Schauer des Alltäglichen und des Grausamen in Zeiten des Nationalsozialismus über die Gesellschaft kam.
Hans Fallada: Jeder stirbt für sich allein (MP3-Audio) Hans Fallada: Jeder stirbt für sich allein. 8 CDs. Ein Hörbuch von Osterwold-Audio.
Nach der fiktionalen Schilderung des Widerstands im Dritten Reich wenden wir uns zum Ende dieser Lesart einer fast protokollarischen Aufzeichnung aus dem Jahr 1933 zu. Wie man den Weihnachtsmorgen verbrachte. Genauer: Thomas Mann samt Familie.
"Stand halb neun Uhr auf. Frühstück an dem ausgezogenen Familientisch mit Kaviar und Stollen. Die Kinder, noch gestern Abend spät befragt, was von Weihnachten das Schönste gewesen sei, erklärten: "Als Herr Papale bei Tisch einen Juden nachmachte."
Die Tagebuchauszüge des Schriftstellers sind sehr genau. Thomas Mann führt die Gästelisten auf, wer wann zum Essen kam, erwähnt den Nebel und die eigene schlechte Laune. Dazwischen blitzt immer wieder die Politik auf. Sein Ärger über die Nazis, und darüber, dass die Kinder in der Schule das Horst-Wessel-Lied pauken müssen.
Jahr um Jahr vergeht, immer wieder hören wir das einsilbige Tagesbuch des sonst so wortreichen Thomas Mann - beeindruckend karg gelesen von Hanns Zischler.
"Missmut wegen nachteiliger Wirkung der Umarbeitung auf das Grammophon. Unleidliches Nadelgeräusch. Zum Protestieren. Regen."
Zwischen diesen lakonischen Einträgen: historische Einordnungen. Die weitläufige Familie verändert sich, neue Gäste kommen hinzu. Die Manns fliehen vor dem Dritten Reich ins Exil, feiern in Princeton, und bekommen eine Weihnachtsbotschaft vom Präsidenten.
"Vor der Bescherung Versammlung der Kinder im Arbeitszimmer und Gesang. Baum, mit dünnen Kerzen brennend, schöner englischer Shakespeare, Pyjama, Platten et cetera. Reiche Gaben überall. Blumentöpfe und Süßigkeiten. Abendessen mit Kerzenbeleuchtung, festlich angenehmes Bild. Champagner. Kaffee. Unterhaltung in der neuen Sitzecke bei Champagner und Baumkuchen bis ein Uhr. Den ganzen Tag die Seltsamkeit der Situation sehr lebhaft empfunden. Erstes Weihnachten in Amerika. Die Möglichkeiten der Zukunft immer wieder erörtert."
Dreieinhalb Jahrzehnte umfassen diese Weihnachtsprotokolle und reichen bis ins Jahr 1954. Da leben die Manns bereits in der Schweiz.
Eine politische Familiengeschichte in gerade mal einer Stunde: Thomas Mann: Weihnachten bei den Manns (MP3-Audio) Weihnachten bei den Manns. Der Hörverlag.
Diese Hörbücher gibt es auch als gedruckte Bücher:
Christiane Paul:
"Das Leben ist eine Öko-Baustelle. Mein Versuch, ökologisch bewusst zu leben"
Verlag: Ludwig, 288 Seiten, 19,99 Euro
Bascha Mika:
"Die Feigheit der Frauen. Rollen fallen und Geiselmentalität. Eine Streitschrift wider den Selbstbetrug"
Verlag: C. Bertelsmann, 256 Seiten, 14,99 Euro
Helmut Schmidt & Peer Steinbrück:
"Zug um Zug – Ein Gespräch"
Verlag: Hoffmann und Campe
320 Seiten, 24,99 Euro
Programmhinweis:
Die nächste Ausgabe der Lesart am Neujahrstag dreht sich um den Preußenkönig Friedrich II. und um dessen 300. Geburtstag im kommenden Jahr.
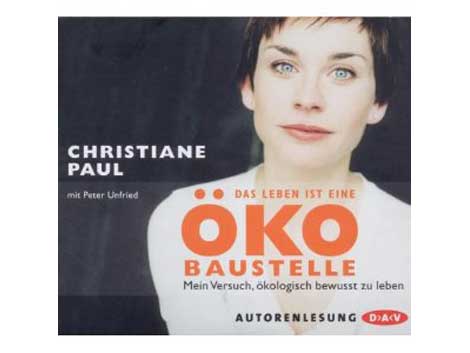
Cover Christiane Paul: "Das Leben ist eine Öko-Baustelle"© DAV
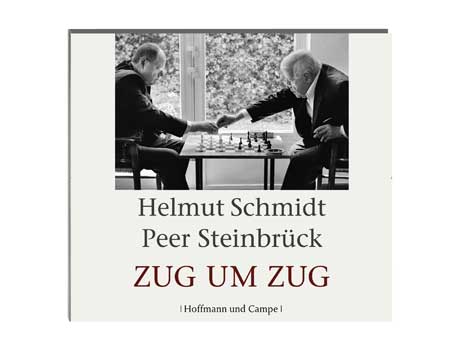
Cover Schmidt / Steinbrück: "Zug um Zug"© Hoffmann und Campe
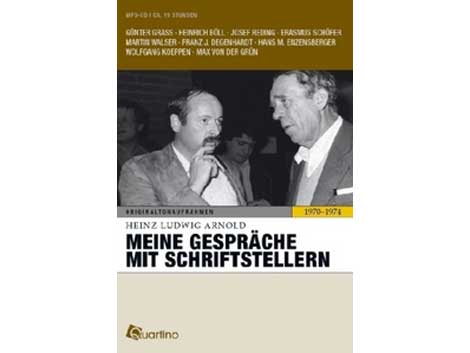
Cover Heinz Ludwig Arnold "Meine Gespräche mit Schriftstellern 1970-1974"© Quartino
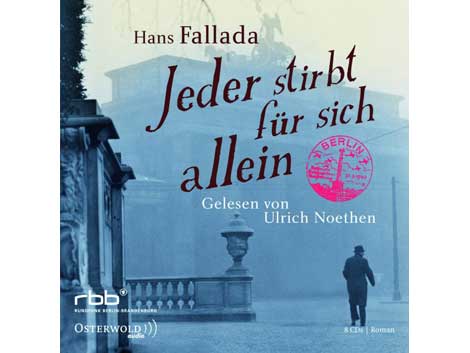
Cover Hans Fallada: "Jeder stirbt für sich allein"© rbb/Hörbuch Hamburg
