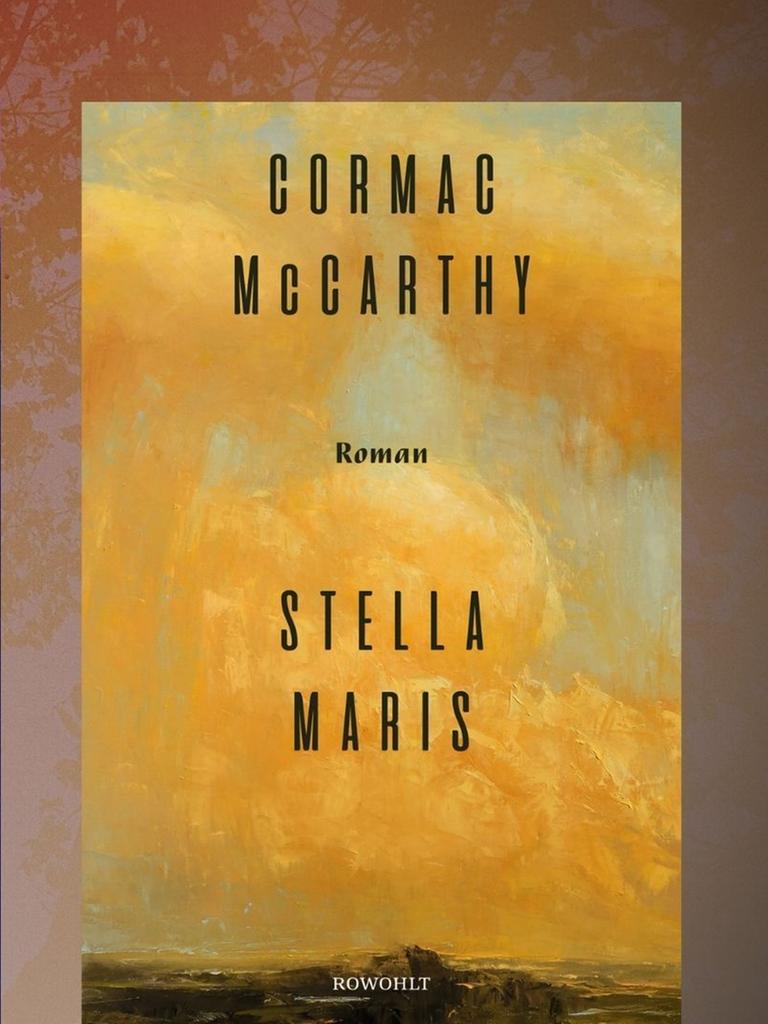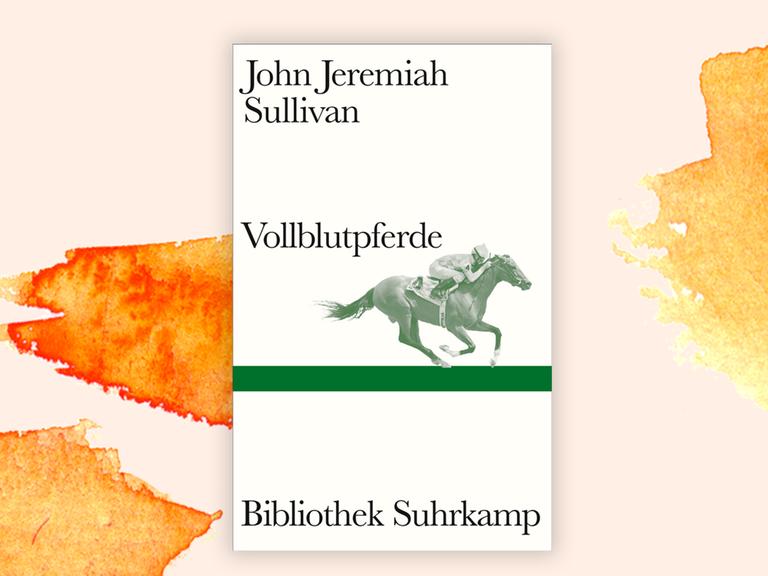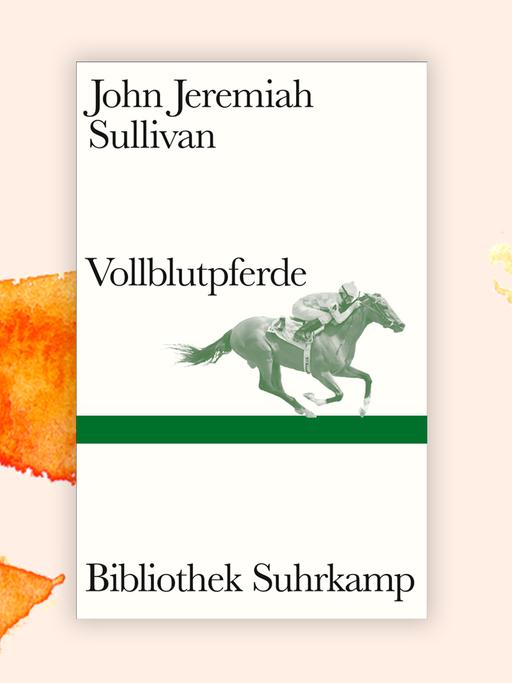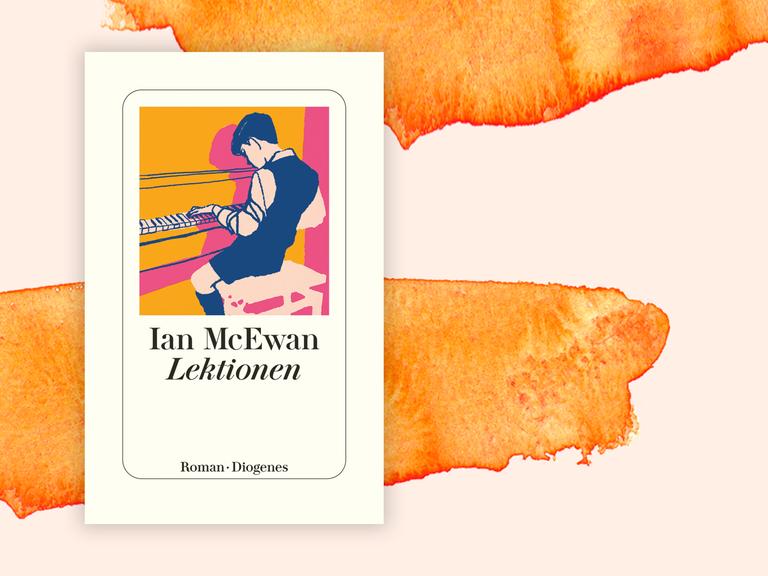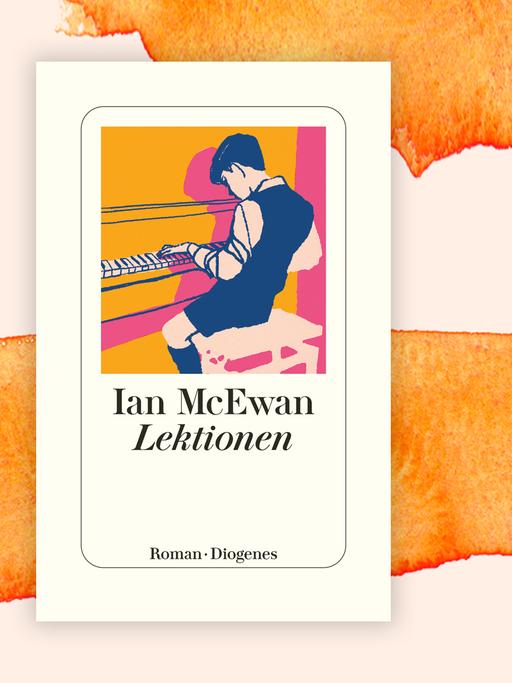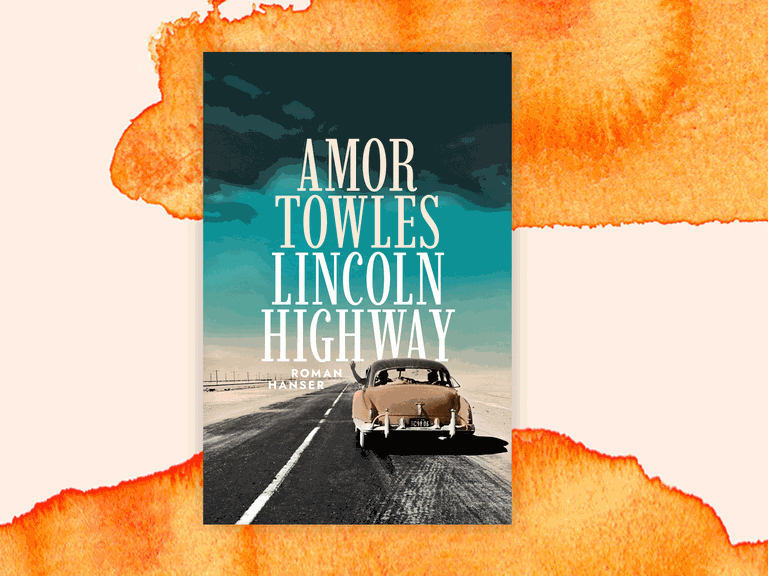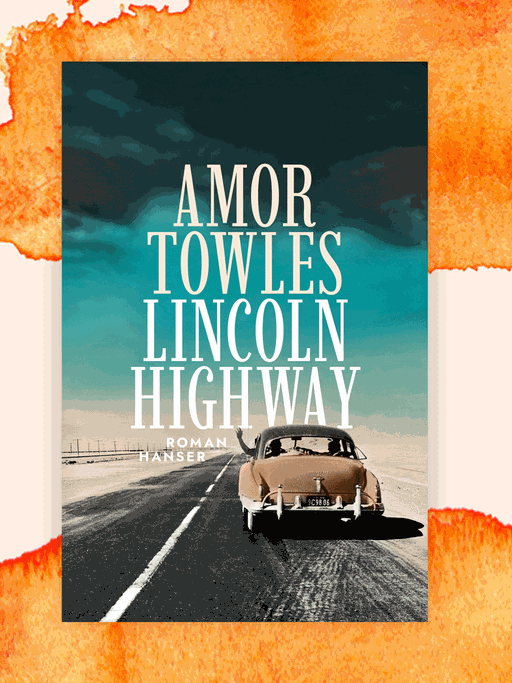Cormac McCarthy: "Der Passagier" und "Stella Maris"
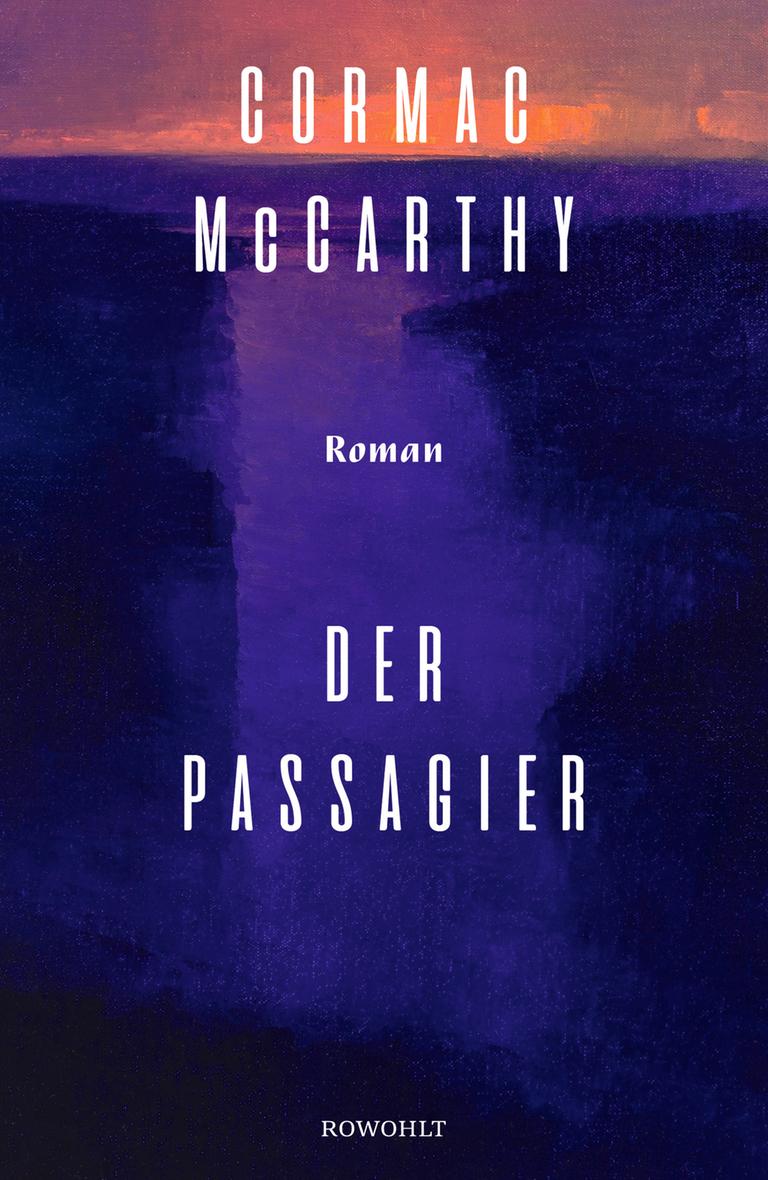
© Rowohlt Verlag
Spätwerk mit Rissen und Sprüngen
07:17 Minuten
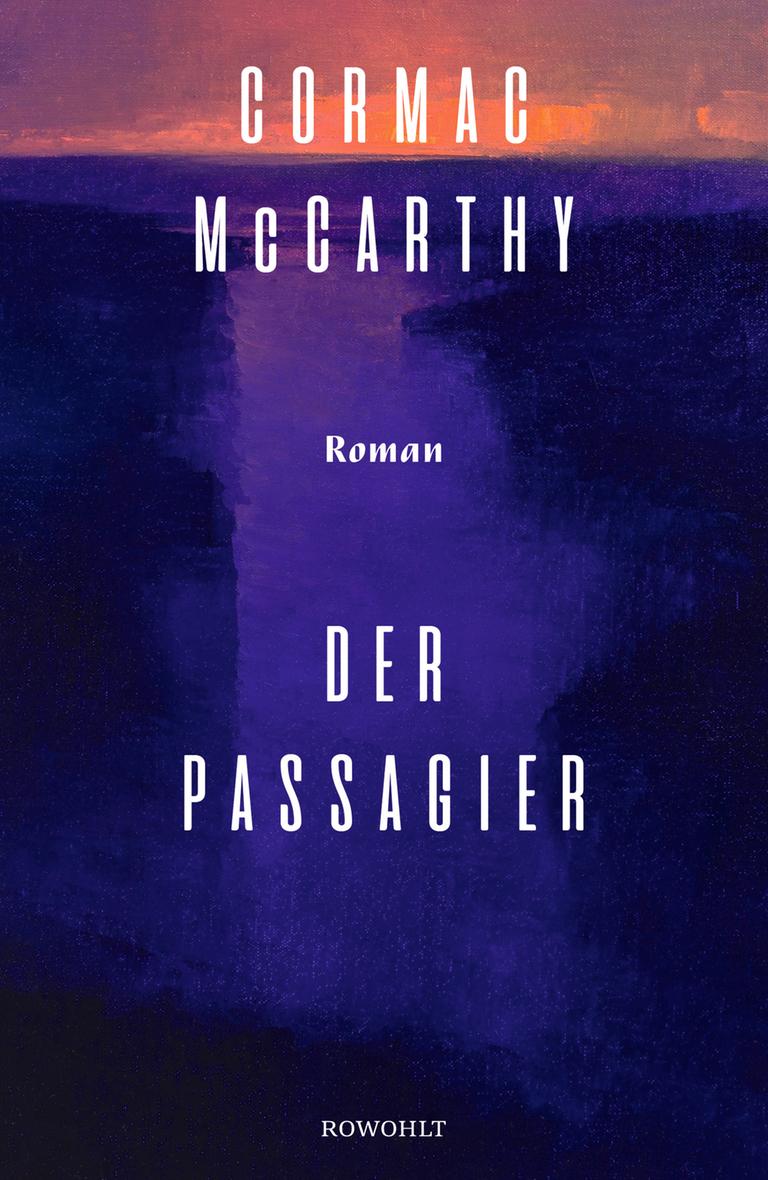
Cormac McCarthy
Aus dem Englischen von Nikolaus Stingl
Der PassagierRowohlt, Hamburg 2022526 Seiten
28,00 Euro
Endlich Neues vom einsamen Cowboy der US-Literatur: Cormac McCarthy veröffentlicht zwei Roman-Geschwister über unmögliche Liebe und Leben, über Tod und Mathematik. Sie sind apokalyptisch wie eh und je. Aber lange nicht seine besten Bücher.
Natürlich scheint der Untergang der Zivilisation schon am abendroten Horizont, und Bobby Western fühlt sich wie der letzte Mensch auf Erden. Der 37-jährige Held aus Cormac McCarthys aktueller Roman-Dilogie ist eine tragische Figur, wie ihn die negative Theologie des US-amerikanischen Bestsellerautors und Pulitzerpreisträgers diktiert.
Nach dem Erfolgstitel „Die Straße“ (2006) war ein neues Buch des öffentlichkeitsscheuen und von einer treuen Fangemeinde verehrten Autors lange erwartet und bereits so gut wie ausgeschlossen worden. Doch nach 16 Jahren legt der mittlerweile fast 90-jährige McCarthy gleich zwei neue Romane vor.
Ein Toter fehlt
Ein „geradezu lehrbuchmäßiger Narziss von der heimlichen Sorte“ ist Bobby Western. Nach einem abgebrochenen Physikstudium und einer Rennfahrer-Karriere in Europa jobbt er Anfang der 80er-Jahre als Bergungstaucher in New Orleans. Eine unter mysteriösen Umständen gesunkene Chartermaschine im Golf von Mexiko mit neun Toten an Bord weckt sein Misstrauen. Kurz nach dem Tauchgang stehen zwei Männer in Anzügen vor seiner Tür: Der Flugschreiber und ein Reisender aus der gesunkenen Maschine fehlten, was Bobby darüber wüsste.
Von seiner Unschuld werden sich die Staatsbehördler nicht überzeugen lassen. Sie durchwühlen sein Haus nach Beweisen, beschlagnahmen Bankkonto, Auto und Pass und treiben den Verfolgten schließlich als Einsiedler in die Wälder von Idaho.
Inzestuöses Verlangen
Doch die Verwicklung in den vermeintlichen Kriminalfall, der ohne Auflösung bleibt, ist nicht der einzige Grund für Bobbys ruheloses Schicksal. Eine Schuld lastet tatsächlich auf ihm: Er ist verliebt in seine genialische, musikalisch wie mathematisch hochbegabte Schwester. Doch Alicia war auch schizophren, erhängte sich im Wald. Mit ihrer schönen Leiche („ihr gefrorenes Haar war golden und kristallen, ihre Augen starr, kalt und hart wie Steine“) beginnt McCarthy seinen Roman. Und mit ihr lässt er seine düsteren Roman-Geschwister enden.
Formal sind beide Bücher verschieden. „Der Passagier“ hat keine stringente Storyline, wie sie noch einige von McCarthys vorherigen Romanen auszeichnete. Wie Adorno mit Blick auf den Stil von Beethovens Spätwerk bemerkte, „die meisterliche Hand" gebe "die Stoffmassen frei, die sie zuvor formte“ und „Risse und Sprünge“ seien ihr letztes Werk, so mag dies auch auf Cormac McCarthys Schreiben zutreffen.
Abkehr von jeder Gefälligkeit
Wortkarge Kneipengespräche („Mach zwei draus, sagte er. / Zwei was? / Hamburger. / Er hat einen Cheeseburger bestellt. / Okay. / Cheeseburger? / Klar. / Mit allem? / Ja. / Fritten? / Fritten.“), die vor allem ein Verstreichen der Zeit markieren und damit nur auf den ersten Blick im Kontrast stehen zur stiltypischen Detailtreue des Autors, und eine ganze Reihe von unvermittelt auftauchenden Nebenfiguren werden nur lose zusammengehalten. Zeigt sich in vielen Sentenzen McCarthys ganze Könnerschaft und Dialoggewandtheit, ist der Roman damit nichtsdestotrotz eine Lektüre-Herausforderung und eine Abkehr von jeder Gefälligkeit.
Cormac McCarthy: „Stella Maris“
Aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren
Rowohlt Verlag, Hamburg 2022
240 Seiten, 24 Euro
Im Kontrast dazu gestaltet der Autor den zweiten Teil „Stella Maris“ zwar nicht stringenter, aber formal ungleich simpler. Transkribiert lesen sich darin die Gespräche zwischen Alicia und ihrem Psychiater in der Heil- und Pflegeanstalt „Stella Maris“ in Wisconsin im Herbst 1972. Die ungewöhnlich real erscheinenden Halluzinationen der schizophrenen Patientin – eine Gruppe bizarrer Zirkuskünstler, angeführt von einem kahlköpfigen „Zwerg“ mit Flossen statt Händen – waren bereits Teil des „Passagiers“.
Naturwissenschaft und Pathos
Alicia und Bobby schultern neben der unmöglichen, sie verzehrenden inzestuösen Liebe auch eine Erblast: Ihr Vater arbeitete unter Robert Oppenheimer an der ersten Atombombe. Die rasanten Gespräche der zutiefst zynischen, seit dem Alter von zwölf Jahren mit dem Suizid liebäugelnden Alicia mit ihrem Therapeuten werden damit auch zu sokratischen Dialogen über Mathematik, Erkenntnis und Wirklichkeit sowie die Sinnhaftigkeit des menschlichen Daseins.
Warum ausgerechnet die Psychiatrie-Dialoge in einem eigenen Buch ausgelagert sind, erschließt sich nicht so recht. Doch fokussiert der zweite Teil so gesondert die metaphysischen Dimensionen der geschwisterlichen Leidenswege.
So häufig McCarthys neues naturwissenschaftliches Interesse bereits hervorgehoben und mit seinem Engagement am privaten, von Physiknobelpreisträger Murray Gell-Mann mitgegründeten Forschungsinstitut in Santa Fe begründet wurde, offenbart es doch zwei Schwächen in McCarthys Spätwerk: Wo der Autor tief in der Materie zu sein scheint, erschließen sich die mathematischen und physikalischen Theorien anhand weniger Stichwörter kaum. Und: Wenn die Atombombe über Nagasaki „wie ein böser Lotus in der Dämmerung“ aufblüht, und „der Regen die Steine für neue Tragödien bereitet“ scheinen sie McCarthys Alterswerk nicht vor Pathos zu bewahren.