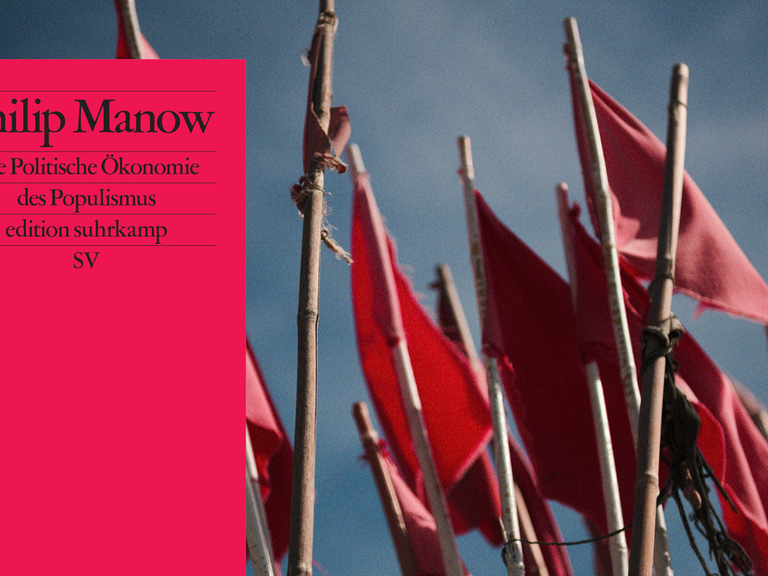Cornelia Koppetsch: "Die Gesellschaft des Zorns. Rechtspopulismus im globalen Zeitalter"
Transcript-Verlag 2019
288 Seiten, 20 Euro
Warum Rechtspopulisten so erfolgreich sind
13:45 Minuten

"Eine Globalisierung mit umwälzendem Charakter" habe die Rechtspopulisten stark gemacht, sagt die Soziologin Cornelia Koppetsch. Denn Rechtspopulisten versprächen: "Wir stellen den Zustand wieder her, den ihr verloren habt."
Joachim Scholl: Über den Rechtspopulismus, das Erstarken national-konservativer Kräfte ist schon viel geschrieben worden und wird permanent diskutiert. Eine Analyse hat nun die Darmstädter Soziologin Cornelia Koppetsch vorgelegt in einem umfangreichen Buch, es heißt "Die Gesellschaft des Zorns". Der Band hat es auf Anhieb auf den Platz eins unserer Sachbuch-Bestenliste geschafft. Die Autorin ist uns jetzt aus Darmstadt zugeschaltet. Guten Morgen, Frau Koppetsch!
Cornelia Koppetsch: Guten Morgen, Herr Scholl!
Scholl: Ihr Buch ist mit bald 300 Seiten eine wirklich umfassende Interpretation des Phänomens. Aus deutscher Sicht enden Sie mit der Frage: Wie mit der AfD umgehen? Der jüngste evangelische Kirchentag, der hat eine eigene entschiedene Antwort gefunden, die AfD war unerwünscht: "Bleibt fort!" Was denken Sie über diese Reaktion?
Koppetsch: Das ist mindestens mal merkwürdig, denn immerhin steht die Kirche ja eigentlich für Dialog. Insbesondere der Kirchentag hat sich den Dialog auf die Fahnen geschrieben, zwischen den Kulturen, sogar zwischen den Religionen – warum dann auch nicht zwischen den politischen Lagern?
Cornelia Koppetsch: Guten Morgen, Herr Scholl!
Scholl: Ihr Buch ist mit bald 300 Seiten eine wirklich umfassende Interpretation des Phänomens. Aus deutscher Sicht enden Sie mit der Frage: Wie mit der AfD umgehen? Der jüngste evangelische Kirchentag, der hat eine eigene entschiedene Antwort gefunden, die AfD war unerwünscht: "Bleibt fort!" Was denken Sie über diese Reaktion?
Koppetsch: Das ist mindestens mal merkwürdig, denn immerhin steht die Kirche ja eigentlich für Dialog. Insbesondere der Kirchentag hat sich den Dialog auf die Fahnen geschrieben, zwischen den Kulturen, sogar zwischen den Religionen – warum dann auch nicht zwischen den politischen Lagern?
Und es ist aber zweitens auch bedenklich, weil derzeit politische Konfliktstoffe existieren, die auf gesellschaftliche Tiefenströmungen verweisen. Was man damit unbedacht auch auslöst: Man bestärkt die AfD-Anhänger in ihrem Ressentiment und dem Glauben, sie seien von dem System abgehängt worden oder sie würden gar verfolgt und ausgegrenzt.
Und man übersieht auch die Tragweite der Themensetzungen der AfD-Anhänger. Man muss natürlich nicht die Antworten gut finden, die die AfD auf die derzeitigen globalen Verwerfungen, die derzeitigen politischen Verwerfungen innerhalb globaler Gesellschaften hat.
Aber man muss erkennen, dass sie Themen anspricht, die für uns alle relevant sind, nämlich die Fragen: Wie gehen wir mit Migration um, wie schützen wir uns vor den Folgen der Globalisierung? Also vieles, was die AfD vorschlägt, hat ja mit einer defensiven Schließung zu tun. Auch wenn das nicht die Lösung ist, so muss man doch die Frage anerkennen.
Epochaler Umbruch vor 30 Jahren
Scholl: Sie, Frau Koppetsch, sehen den Aufstieg des Rechtspopulismus als Folge eines bislang unbewältigten epochalen Aufbruchs, der mit den Umwälzungen vor 30 Jahren, mit Mauerfall, Auflösung der alten Ost-West-Struktur begonnen habe. Was sind denn für Sie die wesentlichen Momente dieses Umbruchs?
Koppetsch: Was man seit etwa 30 Jahren verstärkt sieht – angefangen hat es sicherlich auch begrenzt schon in den 70er-Jahren – was man sieht, ist eine Globalisierung mit umwälzendem Charakter, weil sich sehr viele Dinge verschränken.
Koppetsch: Was man seit etwa 30 Jahren verstärkt sieht – angefangen hat es sicherlich auch begrenzt schon in den 70er-Jahren – was man sieht, ist eine Globalisierung mit umwälzendem Charakter, weil sich sehr viele Dinge verschränken.
Zum Beispiel, dass sich Wirtschaftsbeziehungen zunehmend transnational verflechten; dass wir sehr, sehr große, mächtige Unternehmen haben, transnationale Unternehmen, die zunehmend der Politik die Bedingungen diktieren, unter denen sie sich in verschiedenen Ländern ansiedeln.
Sie sind Akteure, die der Politik vorschreiben, wie viel Steuern sie bereit sind zu zahlen, und nicht umgekehrt, die Politik, die eigentlich dafür da ist, diese Unternehmen zu kontrollieren und ihnen Regulative aufzuoktroyieren, auch im Hinblick darauf, wie man Lohnarbeiter schützt. Das sieht man also nicht, da hat sich das Kräfteverhältnis umgekehrt.
Das Zweite, was wir sehen, ist die Supranationalisierung des Politischen durch Regierungen wie Brüssel, die EU. Und auch hier hat sich also eine Verstärkung gezeigt seit etwa 30 Jahren: Wir haben mittlerweile 50 Prozent der Gesetze, die durch EU erlassen werden und die dann im nationalen Rahmen implementiert werden, also vorbei an den demokratischen Öffentlichkeiten, vorbei auch an den Parlamenten, die also einfach gesetzt werden.
Und wir haben als drittes Phänomen der Globalisierung die Migration, die auch seit 30 Jahren aus verschiedenen Gründen nach Europa, also in die reichen Länder, in den Westen zugenommen hat und die zu einer Veränderung der Kulturen, der gesellschaftlichen Kultur auch im Inneren geführt hat, also zu einer Vervielfältigung der Lebensformen und der Lebensstile.
Liberale Kultur der Eliten
Scholl: In Ihrem Blickpunkt steht auch die sogenannte liberale Kultur, vor allem mit dem Wahlsieg von Donald Trump ist diese Elitenkultur ja schon weidlich kritisiert worden. So, wie wir beide hier sitzen, Frau Koppetsch, mit unseren Berufen und unserem sozialen Status, gehören wir beide ja sicherlich dazu, zur liberalen Kultur, zu den Eliten. Von Ihnen lerne ich jetzt, dass mein Bewusstsein bislang völlig ausgeblendet hat, wie sehr ich damit zur herrschenden Klasse gehöre. Wie konnte ich denn das übersehen?
Koppetsch: Ja, das ist interessant. Wahrscheinlich würden Sie, wenn man Sie fragt, wo würden Sie sich einordnen, sagen, Sie sind in der Mittelschicht.
Scholl: Auf jeden Fall.
Koppetsch: Ja, und in gewisser Weise kann man das auch so sehen, aber was oft ausgeblendet wird, ist dabei, wie exklusiv der Lebensstil der, sagen wir mal, kulturschaffenden Intelligenz eigentlich ist, der sich ja oft in Großstädten abspielt und der sehr viele Menschen eben auch ausschließt: Also dass wir übersehen, wie sehr beispielsweise der Anstieg der Mieten dafür gesorgt hat, dass wir eigentlich in immer homogeneren Gemeinschaften in den städtischen Vierteln leben, die wir so lieben.
Koppetsch: Ja, das ist interessant. Wahrscheinlich würden Sie, wenn man Sie fragt, wo würden Sie sich einordnen, sagen, Sie sind in der Mittelschicht.
Scholl: Auf jeden Fall.
Koppetsch: Ja, und in gewisser Weise kann man das auch so sehen, aber was oft ausgeblendet wird, ist dabei, wie exklusiv der Lebensstil der, sagen wir mal, kulturschaffenden Intelligenz eigentlich ist, der sich ja oft in Großstädten abspielt und der sehr viele Menschen eben auch ausschließt: Also dass wir übersehen, wie sehr beispielsweise der Anstieg der Mieten dafür gesorgt hat, dass wir eigentlich in immer homogeneren Gemeinschaften in den städtischen Vierteln leben, die wir so lieben.

Die liberalen Eliten unterstellen, "dass andere Menschen eben unter ähnlichen Bedingungen leben wie sie selbst, und das ist eben nicht richtig."© imago stock&people
Und dass wir auch übersehen, wie sehr wir das Leben anderer vielleicht beeinflussen, weil wir an den Schaltstellen der Kulturvermittlung sitzen, was wir jetzt eben gerade tun, und unsere Ideen maßgeblich werden dadurch, dass wir sie überall ungehindert gesellschaftlich verbreiten können.
Also dass wir zum Beispiel, wie Hochschullehrer das eben tun, in der Universität auch Gatekeeper-Positionen innehaben und dass Rundfunkredakteure vielleicht nicht nur entscheiden können, welches Personal sie einstellen, sondern auch ihre Ideen über den Rundfunk verbreiten können.
Minderheiten und Mehrheiten
Scholl: Einen Satz habe ich mir hier aus Ihrem Buch raus- und hinter die Ohren geschrieben gewissermaßen: "Der Liberalismus verteidigt somit nicht mehr Minderheiten gegen Mehrheiten, vielmehr sind es Minderheiten, Politiker, Journalisten, Banker, Hochschullehrer, Gewerkschaftsführer, die Mehrheiten erklären, was das Beste für sie sei." Entsteht so der Groll, der Zorn?
Koppetsch: Das ist auf jeden Fall ein zentraler Grund. Und der Liberalismus oder diejenigen, die ihn vertreten, meinen das eigentlich auch gar nicht böse: Sie sind aufrichtig überzeugt, dass es für alle gut ist, sich vegetarisch zu ernähren, keine Dieselfahrzeuge zu fahren, die Umwelt nicht zu verschmutzen, an das Klima zu denken und andere Menschen nicht auszugrenzen – nur unterstellen sie, dass andere Menschen eben unter ähnlichen Bedingungen leben wie sie selbst, und das ist eben nicht richtig.
Koppetsch: Das ist auf jeden Fall ein zentraler Grund. Und der Liberalismus oder diejenigen, die ihn vertreten, meinen das eigentlich auch gar nicht böse: Sie sind aufrichtig überzeugt, dass es für alle gut ist, sich vegetarisch zu ernähren, keine Dieselfahrzeuge zu fahren, die Umwelt nicht zu verschmutzen, an das Klima zu denken und andere Menschen nicht auszugrenzen – nur unterstellen sie, dass andere Menschen eben unter ähnlichen Bedingungen leben wie sie selbst, und das ist eben nicht richtig.
Wir haben eben in anderen Milieus wie beispielsweise in ländlichen Regionen, im Ruhrgebiet oder in Ostdeutschland ganz andere gesellschaftliche Bedingungen, da brauchen wir eben ein Fahrzeug, und das kann vielleicht ein Diesel-Mercedes sein, der ist aber unabdingbar.
Oft sind es Menschen, die eben nicht mehr so eine weite Zukunft haben, dass sie die Klimaverschmutzung als das Hauptproblem betrachten. Und sie sind auch darüber erbost, dass man ihnen jetzt vorschreiben soll, dass sie kein Fleisch mehr essen sollen und dass sie sich gesundheitsbewusst ernähren. Das ist für sie eine Bevormundung.
"Transnationales Unten"
Scholl: In dem Zusammenhang, da bringen Sie auch einen Begriff vom "Transnationalen Unten", was ist damit gemeint und welche Bedeutung hat dieses Unten?
Koppetsch: Unten bedeutet erst mal, wir haben eine Klassengesellschaft, und diese Klassengesellschaft hat sich auch in den letzten 30 Jahren neu formiert. Wir können sehen, dass das Unten größer geworden ist, das umfasst etwa 25 bis 30 Prozent, es ist also sehr groß.
Koppetsch: Unten bedeutet erst mal, wir haben eine Klassengesellschaft, und diese Klassengesellschaft hat sich auch in den letzten 30 Jahren neu formiert. Wir können sehen, dass das Unten größer geworden ist, das umfasst etwa 25 bis 30 Prozent, es ist also sehr groß.
Das Zweite, was man über dieses Unten sagen kann, ist, dass es auch sehr heterogen ist: Wir haben also einerseits Wanderarbeiter, legale Bauarbeiter aus Osteuropa, alleinerziehende Mütter, Hartz-IV-Empfänger, Niedriglöhner, Paketzusteller, Wachschützer, Köche etc. – also Personen, die oft Niedriglöhne empfangen oder eben von ihren Einkommen nicht leben können; die aber auch nicht ohne Weiteres eine homogene Klassenlage darstellen, wie das früher die Arbeiter waren, sondern die sehr, sehr vermischt sind und deswegen auch nicht mehr einfach durch die SPD oder durch irgendeine Volkspartei als Ganze vertreten werden können.
Vielmehr zeigt sich, dass in diesem transnationalen Unten selber sehr starke Verwerfungen zwischen Autochthonen, also zwischen einheimischer Bevölkerung und migrantischer Bevölkerung auftauchen.
Scholl: Sie bezeichnen den Rechtspopulismus, Cornelia Koppetsch, auch als politische Therapie. Was ist das denn für eine Behandlung?
Koppetsch: Das ist also keine Behandlung, wie wir sie kennen, wenn wir zum Therapeuten gehen und dann gesagt kriegen, wir müssen selbst Verantwortung übernehmen und uns optimieren, sondern es ist eigentlich eine Reaktion auf eine kollektive Entwertung. Also es muss eine Entwertung sein, die ich nicht als Individuum erfahre, sonst nützt die politische Therapie nicht, sondern es ist typischerweise eine Deklassierung einer ganzen Gruppe, die früher vielleicht maßgeblich war in einer Gesellschaft, jetzt aber an den Rand gedrängt worden ist.
Scholl: Sie bezeichnen den Rechtspopulismus, Cornelia Koppetsch, auch als politische Therapie. Was ist das denn für eine Behandlung?
Koppetsch: Das ist also keine Behandlung, wie wir sie kennen, wenn wir zum Therapeuten gehen und dann gesagt kriegen, wir müssen selbst Verantwortung übernehmen und uns optimieren, sondern es ist eigentlich eine Reaktion auf eine kollektive Entwertung. Also es muss eine Entwertung sein, die ich nicht als Individuum erfahre, sonst nützt die politische Therapie nicht, sondern es ist typischerweise eine Deklassierung einer ganzen Gruppe, die früher vielleicht maßgeblich war in einer Gesellschaft, jetzt aber an den Rand gedrängt worden ist.
Und das Politische oder Therapeutisch-Politische besteht jetzt darin, dass man dieser Gruppe verspricht: "Ihr bekommt die Gesellschaft zurück, in der ihr erfolgreich und einflussreich wart, wir stellen den Zustand wieder her, den ihr verloren habt, wir restaurieren die alte Ordnung."
Fantasiepanzer
Scholl: Hier verwenden Sie auch eine Formulierung, die auf Norbert Elias, den großen Soziologen zurückgeht, er hat von einem Fantasiepanzer gesprochen. Interessantes Bild, wie sieht denn dieser Fantasiepanzer auf unsere Zeiten jetzt gemünzt aus?
Koppetsch: Also der Fantasiepanzer soll uns eben schützen vor der Erkenntnis, dass wir unsere Machtposition oder unseren Einfluss, unsere Bedeutung eingebüßt haben – und das gibt es jetzt nicht nur bei den AfDlern, sondern wir sehen es auch in bestimmten Milieus.
Koppetsch: Also der Fantasiepanzer soll uns eben schützen vor der Erkenntnis, dass wir unsere Machtposition oder unseren Einfluss, unsere Bedeutung eingebüßt haben – und das gibt es jetzt nicht nur bei den AfDlern, sondern wir sehen es auch in bestimmten Milieus.
Wenn zum Beispiel Eltern sagen, "Ja, mein Kind ist hochbegabt und deswegen kommt es in der Schule nicht mit", dann ist das genauso ein Fantasiepanzer, der die Eltern vor der Erkenntnis schützen soll, dass ihr Kind die Leistungen nicht erbringen kann und vielleicht überhaupt nicht so ganz doll begabt ist, wie sie sich das erhofft haben.
Und so ähnlich ist auch zum Beispiel der Ausspruch von Trump "Make America great again" so etwas wie ein Fantasiepanzer, weil das, was Trump im Moment tut, nämlich Amerika abzuschotten von der internationalen Wirtschaft, oder aus politischen Abkommen auszusteigen, sicherlich nicht dazu beitragen wird, Amerika groß zu machen, aber eine Fantasie von Größe für seine Anhänger heraufbeschwört.
Symbolischer Klassenkampf
Scholl: Nach den letzten Wahlerfolgen der AfD in Ostdeutschland habe ich in einer Talkshow einen bemerkenswerten Satz gehört. Ich weiß nicht mehr, von wem er stammt, er ging so ungefähr: Die hohen Prozentzahlen in Sachsen, die machen mir weniger Sorgen als die 15 Prozent, die die AfD in Baden-Württemberg bekommen hat, einem der ja reichsten Bundesländer. Hier haben Bürger die AfD gewählt, die einen Mercedes vor dem Eigenheim stehen haben. Haben Sie, Frau Koppetsch, auch dafür eine Erklärung?
Koppetsch: Ja, das habe ich versucht, in meinem Buch darzustellen. Oftmals gibt es ja die Ansicht, bei den AfD-Wählern handelt es sich entweder um Nazis oder Verrückte oder aber auch um abgehängte Globalisierungsverlierer, und damit meint man in der Regel, das sind Leute, die also ökonomisch abgehängt worden sind, die keinen Mercedes vor der Haustür haben.
Koppetsch: Ja, das habe ich versucht, in meinem Buch darzustellen. Oftmals gibt es ja die Ansicht, bei den AfD-Wählern handelt es sich entweder um Nazis oder Verrückte oder aber auch um abgehängte Globalisierungsverlierer, und damit meint man in der Regel, das sind Leute, die also ökonomisch abgehängt worden sind, die keinen Mercedes vor der Haustür haben.
Aber ich habe versucht, in meinem Buch darzustellen, dass es sich um einen symbolischen Klassenkampf, also um einen Kulturkonflikt, wenn man so will, handelt, wobei das Wort Kultur jetzt nicht verniedlicht werden darf.
Manche stellen sich ja vor, bei Kulturkonflikten ginge es um Folklore und um Döner und wir können uns ja auch alle in einer multikulturellen Gesellschaft zurechtfinden und jeder kann den anderen akzeptieren.
Aber das verkennt, dass Kultur eigentlich ein konstitutives Element von Gesellschaften darstellt, um das man sich streitet, wenn es darum geht, dass die eine Kultur sich als maßgeblich erlebt oder als maßgeblich durchsetzen will und die andere auch, das heißt, es gibt einen Konflikt zwischen Normen und damit auch einen Konflikt über die Frage, welche Gruppen überhaupt Einfluss nehmen sollen in dieser Gesellschaft, also wer die Norm definieren darf.
Angst demobilisiert eher
Scholl: Hat es auch mit einer Angstgeschichte zu tun? Das ist auch ein wesentliches Kapitel in Ihrem Buch, dass Sie also dieses Erstarken des Rechtspopulismus auch durchaus mit so einer grundsätzlichen Angst, die das traditionelle Bürgertum in den Knochen habe, irgendwie zu tun hat.
Koppetsch: Angst spielt sicherlich auch eine Rolle, allerdings ist Angst nicht der Faktor, der dann tatsächlich mobilisiert werden kann, weil Angst demobilisiert. Jemand, der Angst hat, der verarbeitet das in der Regel so, dass er sich eher kontrahiert, also dass er vielleicht rigider wird oder starrer wird, etwas ausgrenzt, also abgrenzt und nicht unbedingt, indem er sich zornig macht.
Koppetsch: Angst spielt sicherlich auch eine Rolle, allerdings ist Angst nicht der Faktor, der dann tatsächlich mobilisiert werden kann, weil Angst demobilisiert. Jemand, der Angst hat, der verarbeitet das in der Regel so, dass er sich eher kontrahiert, also dass er vielleicht rigider wird oder starrer wird, etwas ausgrenzt, also abgrenzt und nicht unbedingt, indem er sich zornig macht.
Aber Angst spielt natürlich insofern eine Rolle, als das, was die AfD-Anhänger tun, mit Ausgrenzung zu tun hat, also letztlich mit dem Ziehen von Mauern und mit dem Nicht-mehr-Reinlassen des Außens.
Scholl: Sie haben eingangs unseres Gespräches schon eine erste Einschätzung gegeben vom Umgang mit den neuen Rechten. Ihr Buch endet mit dieser Frage. Haben Sie noch eine Antwort für uns, Frau Koppetsch?
Koppetsch: Ja, man kann vielleicht sagen, es gibt nicht die eine Antwort. Wir müssen, glaube ich, bei der Debatte um die AfD immer auch differenzieren zwischen dem, was die Agenda der AfD beinhaltet, also ihren politischen Inhalten, die wir nicht teilen müssen, aber wir müssen gleichzeitig sehen, dass diese Partei eine Reaktion auf Veränderungen in unserer Gesellschaft darstellt, also auf Veränderungen in den Tiefenstrukturen dieser Gesellschaft, die durch Globalisierung entstanden sind. Also das heißt, wir müssen uns mit den Ursachen beschäftigen, warum diese Partei so erfolgreich werden konnte.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandfunk Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.
Scholl: Sie haben eingangs unseres Gespräches schon eine erste Einschätzung gegeben vom Umgang mit den neuen Rechten. Ihr Buch endet mit dieser Frage. Haben Sie noch eine Antwort für uns, Frau Koppetsch?
Koppetsch: Ja, man kann vielleicht sagen, es gibt nicht die eine Antwort. Wir müssen, glaube ich, bei der Debatte um die AfD immer auch differenzieren zwischen dem, was die Agenda der AfD beinhaltet, also ihren politischen Inhalten, die wir nicht teilen müssen, aber wir müssen gleichzeitig sehen, dass diese Partei eine Reaktion auf Veränderungen in unserer Gesellschaft darstellt, also auf Veränderungen in den Tiefenstrukturen dieser Gesellschaft, die durch Globalisierung entstanden sind. Also das heißt, wir müssen uns mit den Ursachen beschäftigen, warum diese Partei so erfolgreich werden konnte.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandfunk Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.