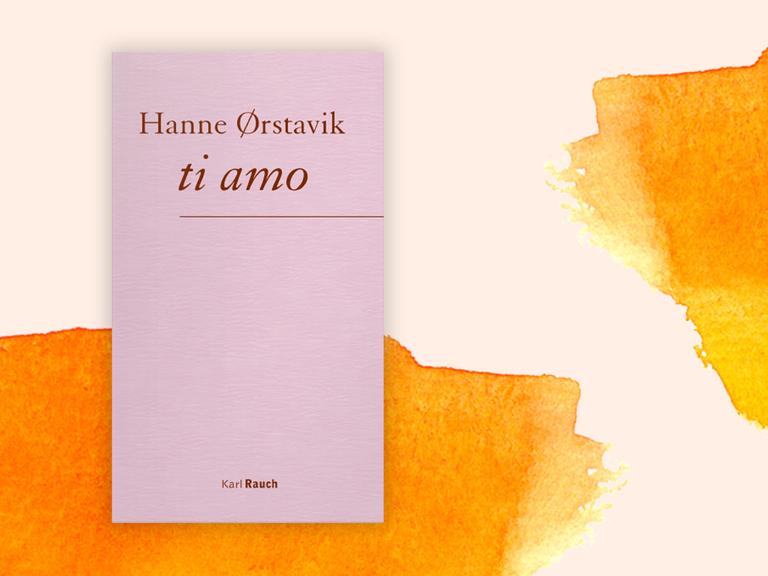Daniel Schreiber: "Allein"
Hanser, Berlin 2021
160 Seiten, 20 Euro
Ein reiches Leben und trotzdem Angst
05:55 Minuten
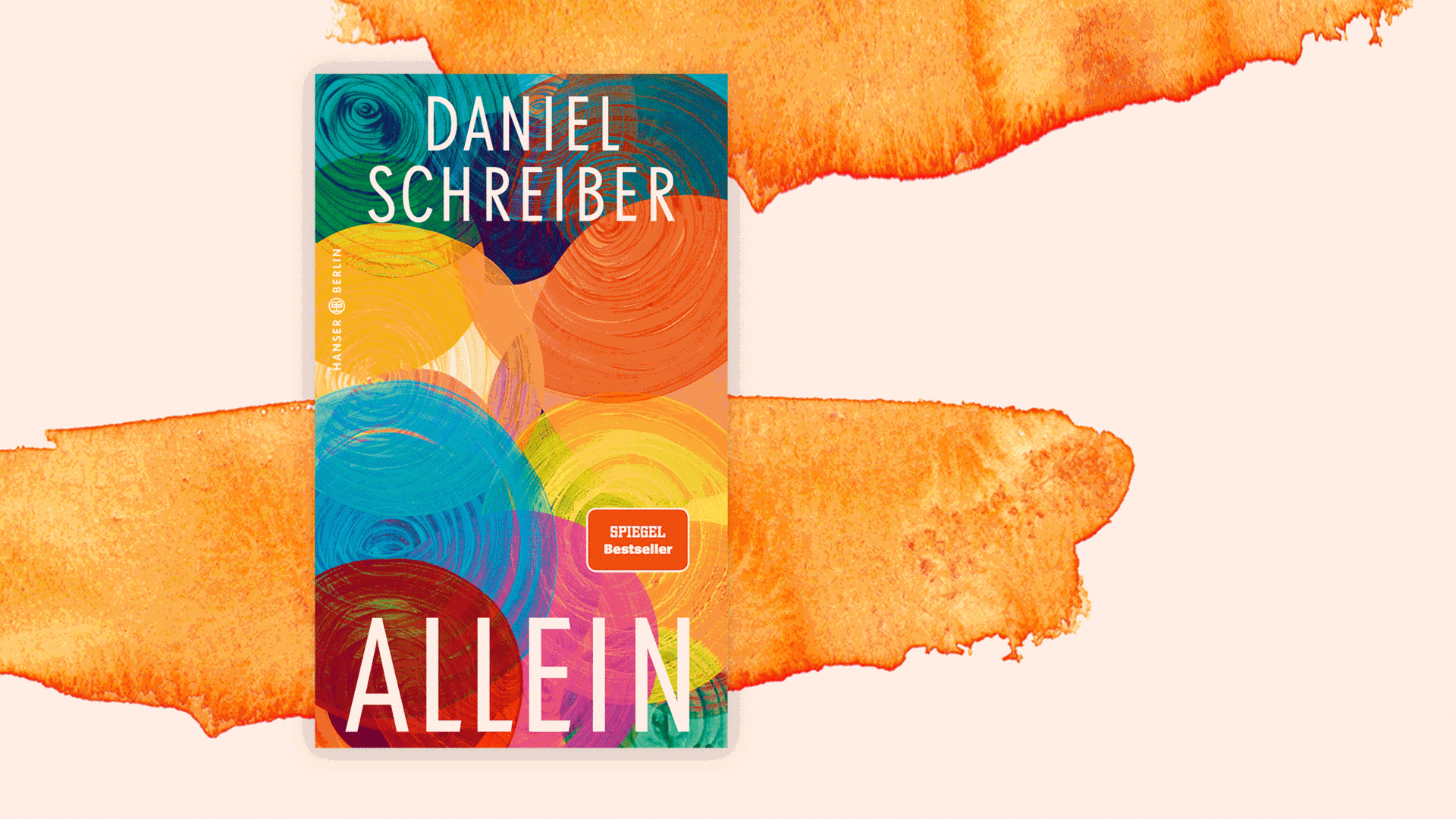
Was hilft, wenn man allein lebt, gegen Einsamkeit? Freundinnen und Freunde? Spazierengehen, stricken, kochen? Braucht man jemanden, mit dem man alt wird? Der Berliner Essayist Daniel Schreiber nimmt uns mit auf eine sehr persönliche Spurensuche.
"Ich habe nie die bewusste Entscheidung getroffen, allein zu leben. Im Gegenteil, ich bin davon ausgegangen, dass ich mit jemandem mein Leben teilen und zusammen alt werden würde", notiert Daniel Schreiber gleich zu Beginn.
Und es ist der Kernsatz seines Buches, in dem er zu ergründen sucht: Kann man ohne feste Partnerin, ohne Partner leben, ohne einsam zu werden? In einer Gesellschaft, in der zwar immer mehr Menschen allein leben, die aber trotzdem immer noch Ehe, Familie und Kinder als höchstes Lebensziel preist? Und das als schwuler mittelalter Mann?
Daniel Schreiber nähert sich diesem wichtigen Thema auf vielfältige Weise und immer auch sehr persönlich. Er nimmt uns mit in die Gärten seiner Freunde, an deren Abendbrottisch, ins Studierzimmer, in den Park, in die Küche und auf Reisen. Erzählt, wer warum wichtig für ihn ist. Seit wann er sie kennt. Was sie gemeinsam unternehmen.
Über allem schwebt eine Art Angst
Seite für Seite entsteht so das Bild eines reichen, erfüllten Lebens. Über dem aber auch eine Art Angst schwebt, an den eigenen Ansprüchen und den der anderen zu scheitern. Denn darf man sich als privilegierter weißer Mann überhaupt unglücklich fühlen?
Oder gilt für ihn als Schwulen, dass seine "Andersartigkeit für ein Leben sorgen würde", dass er "allein, ohne Liebe, verbringen würde"? Und überhaupt: Wo beginnt das eigene Scheitern?
Als Corona die Welt zum Stillstand zwingt und Menschen in ihr Zuhause verbannt, werden diese Fragen immer dringender für den Autor. Die Außenkontakte werden stetig weniger. Auch weil Schreiber sich selbst immer mehr zurückzieht. "Ich hatte den Eindruck, noch niemals so einsam gewesen zu sein."
Scham, Schuld, Verzweiflung
Wie aber umgehen mit diesem "ernstzunehmenden seelischen Schmerz, der mit einem eklatanten Bedeutungs- und Selbstwertverlust einhergeht, mit Scham, Schuld und Verzweiflung"? Ohne dann doch wieder die "Magie der Familie" zu beschwören?
Mäandernd nähert sich Daniel Schreiber diesen Fragen. Zitiert aus philosophischen, soziologischen und literarischen Texten. Schreibt schließlich über Gärten, Existenzangst, Unglück, Nähe, Stolz, Freundschaft, Essstörungen, übers Stricken und Häkeln, über Hoffnungslosigkeit, Aids und "queere" Scham, Selbstoptimierung, Self Care und Yoga, über digital vermittelte Beziehungen und die Impfung gegen Corona.
Ein unglaublicher Wust, dem man sich aber wie einem Gedankenlauf gerne anschließt. Selbst dann, wenn man erstaunt ist, welche Bezüge Schreiber dabei scheinbar willkürlich herstellt. Erweitert er doch so kontinuierlich den Blickwinkel, um am Ende immer wieder bei sich selbst und der eigenen Wahrnehmung zu landen.
Das eigene Erleben gilt es ernst zu nehmen
Das könnte eitel sein, ist aber ein kluger Schachzug, denn durch die Anteilnahme wird der Lesende letztendlich auf sich selbst zurückgeworfen. Hinterfragt, gleicht ab und lernt so: Das eigene Erleben gilt es ernst zu nehmen. Denn wir Menschen sind und bleiben gefühlsgelenkte Wesen. Immer und überall.
Der eine mag sich dieser Tatsache mehr bewusst sein als der andere. Auch mehr daran leiden. Für Daniel Schreiber gilt beides bestimmt. Mehr noch: Er macht daraus verdammt gute Texte – schreibt gegen Stigmatisierung und falsche Scham an.
Am Ende der 160 Seiten ist man berührt von so viel Offenheit, schlauer wegen der zahlreichen Exkurse und versteht: "Einsamkeit hat immer auch etwas Positives. Erst durch sie lernen wir, dass wir trotz der geliebten Menschen in unserem Leben in einem grundlegenden Sinn allein sind."
Eine Einsicht, die, so schreibt Schreiber weiter, "ein gutes und verantwortungsvolles Leben erst möglich macht". Und zwar, "indem wir Verantwortung für uns und unser Leben übernehmen".