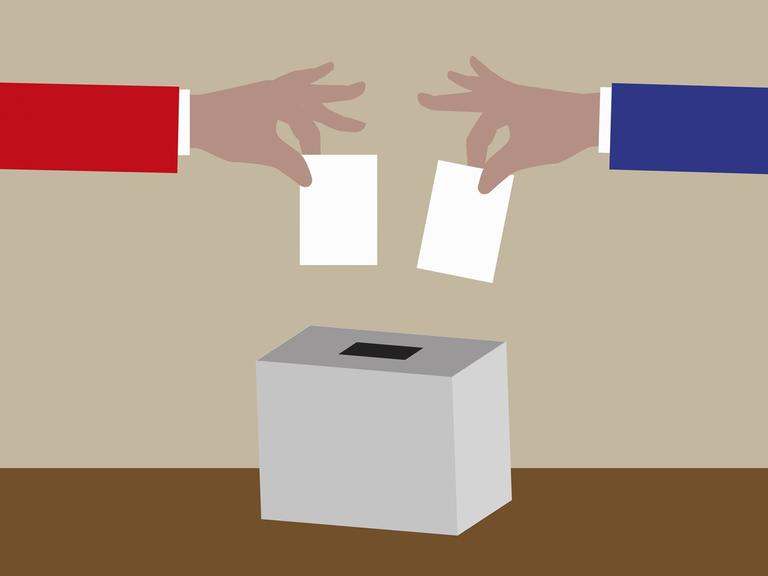Hören Sie hier das Interview mit Danielle Allen in der englischen Origialfassung:
Audio Player
Warum alle mitbestimmen müssen
36:06 Minuten

Wie frei können wir unsere eigenen Lebensverhältnisse mitgestalten? Daran misst die Politologin Danielle Allen, wie gerecht eine Gesellschaft ist. In ihrem neuen Buch weist die preisgekrönte Harvard-Professorin Wege zu demokratischer Teilhabe.
Leben wir in gerechten Gesellschaften? Lösen zumindest die westlich orientierten Demokratien diesen Anspruch ein? Für die Idee der Gerechtigkeit gebe es im Westen ein hohes Bewusstsein, gesteht Danielle Allen zu. "Aber wir schaffen es nicht, sie umzusetzen."
Grundbedingung eines guten Lebens
Dabei bestünden zwischen den einzelnen Staaten gravierende Unterschiede. So werde etwa das Gesundheitssystem in Deutschland der Aufgabe einer fairen Versorgung der Bevölkerung "auf einem weitaus höheren Niveau gerecht als die USA", sagt Allen, die an der Harvard-Universität zu politischer Theorie forscht.
Entscheidend für eine gerechte Gesellschaft sei eine möglichst breite Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger: "Menschen entwickeln sich am besten in Kontexten, in denen sie an der politischen Entscheidungsfindung beteiligt sind", so Allen. Demokratische Teilhabe zählt aus ihrer Sicht zu den Grundbedingungen eines guten Lebens.
In ihrem Buch "Politische Gleichheit" zeigt Allen deshalb Strategien auf, mit denen Demokratien sicherstellen sollen, dass möglichst niemandem der Weg zur Mitwirkung versperrt wird. Und nicht nur das. Allen argumentiert, dass Demokratien alle Gesellschaftsmitglieder zur aktiven Mitgestaltung ermächtigen müssten. In der Praxis jedoch scheitere das oft daran, dass Macht und Ressourcen sehr ungleich verteilt seien.
Drei Voraussetzungen für politische Autonomie
Um dennoch möglichst viele Menschen zu befähigen, ihre politischen Interessen zu vertreten, setzt Allen auf drei Felder: erstens starke demokratische Institutionen, die bereits auf Beteiligung angelegt sind, zweitens eine entsprechende Kultur und politische Bildung sowie drittens eine stark vernetzte Zivilgesellschaft.
In der Fachwelt sorgt Danielle Allen mit ihrem Ansatz bereits für Aufsehen. Für ihr Werk wurde sie soeben mit dem Kluge-Award der Library of Congress ausgezeichnet. Die mit 500.000 Dollar dotierte Ehrung würdigt herausragende Arbeiten und Lebenswerke in den Sozial- und Geisteswissenschaften und soll damit einen blinden Fleck der Nobelpreise ausgleichen. Zu den früheren Preisträgern zählt auch der deutsche Sozialphilosoph Jürgen Habermas.
Gerechtigkeit und Krisenkompetenz
Aber gäbe es angesichts vieler aktueller Krisen, von der Coronapandemie und Klimaerwärmung über Rassismus bis hin zur zunehmenden ökonomischen und politischen Spaltung unserer Gesellschaften, derzeit nicht viele dringendere Fragen auf der politischen Agenda als die Auseinandersetzung mit Gerechtigkeit?
"Ich denke, dass Themen der Gerechtigkeit eng mit unserer Fähigkeit verbunden sind, erfolgreiche Lösungen für unsere Krisen zu finden", erwidert Allen. "Wenn wir also versuchen, uns Problemen wie dem Klimawandel zu widmen, der Coronapandemie oder Bemühungen gegen Rassismus, dann brauchen wir effektive Regierungen, die in starken Systemen konstitutioneller Demokratie verankert sind." Solche Systeme dienen Gerechtigkeit und Allgemeinwohl und fördern Krisenkompetenz, so Allen, indem sie Bürgerinnen und Bürger zu politischer Mitwirkung ermutigen.
Nicht alle Unterschiede sind auch unfair
Nicht alle gesellschaftlichen Unterschiede seien zugleich Anzeichen für Ungerechtigkeit, sagt Allen. Es komme darauf an, "unsere institutionelle Landschaft routinemäßig nach Mustern zu untersuchen, in denen sich Ungleichheiten zeigen und herauszufinden, ob es sich dabei um Herrschaftsstrukturen handelt oder nicht." Zu diesem Zweck hat sie ein Prinzip entwickelt, das als Kontrollinstrument dienen soll, um zu sehen, ob in einem gesellschaftlichen Bereich nachgesteuert werden müsste oder nicht. Dieses Prinzip nennt sie: "Differenz ohne Herrschaft".
So zeigten sich etwa in Statistiken zum Strafvollzug in den USA zwei markante Unregelmäßigkeiten, erläutert Allen: "Es gibt die extreme Überrepräsentanz afroamerikanischer und lateinamerikanisch-stämmiger Menschen in den Gefängnissen der USA im Vergleich zu weißen Amerikanern. Außerdem gibt es eine auffallende Ungleichheit im Verhältnis von männlichen und weiblichen Inhaftierten."
Dass viel mehr schwarze und lateinamerikanisch-stämmige Bürger in den Gefängnissen einsitzen, dafür könnten eine Reihe von gesellschaftlichen Ursachen ausgemacht werden, so Allen, "angefangen von der Art und Weise, wie die Polizei arbeitet, bis zur Verteilung von Bildungsmöglichkeiten und wirtschaftlichen Chancen." Eine klare Aufforderung an die Politik, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, "um diese Ungleichheit zu verringern oder abzuschaffen." Der unterschiedliche Anteil männlicher und weiblicher Inhaftierter beruhe jedoch "nicht auf der gleichen Art von Herrschaftsmustern" und müsse daher "nicht zur gleichen Reaktion führen".
Mitsprache nicht nur für Mächtige
Auf das Problemfeld Klimawandel angewendet, rege das Prinzip "Differenz ohne Herrschaft" etwa dazu an, neue Formen der demokratischen Beratung und Entscheidungsfindung einzusetzen, in denen das Wissen von Klimaforschern und die Perspektiven unterschiedlicher Gesellschaftsgruppen besser zueinander ins Verhältnis gesetzt werden können, sagt Allen. In diesen neuen Beratungsstrukturen müsse sichergestellt sein, dass die Stimmen derjenigen, die von der Erderwärmung stärker betroffen sind, wie etwa die Bevölkerung küstennaher Gebiete, in Verhandlungen über politische Aktionspläne auch ein entsprechendes Gewicht erhalten.
Dass über politischen Einfluss nicht allein die Macht gesellschaftlicher Player entscheiden dürfe, ist ein wesentlicher Teil von Allens Vision einer "vernetzten Gesellschaft". Dazu könnten nicht nur Gesetze und Regulierungen gegen die Konzentration von Macht beitragen, so Allen, sondern auch soziale Ethiken und Normen.
"Im Bereich der Wirtschaft bin ich beispielsweise beeindruckt von Denkern wie Colin Mayer aus Großbritannien oder Rebecca Henderson hier in Harvard", sagt Allen. "Sie versuchen, mit den bedeutendsten Unternehmensführern – also letztlich mit einem sehr kleinen Club – darüber zu sprechen, worum es in einem Unternehmen eigentlich gehen sollte: Ist ein Unternehmen nur für seine Aktionäre, die Shareholder, da? Oder geht es um Interessensvertreter oder Stakeholder: um alle Gemeinschaften also, auf die die Handlungen des Unternehmens Einfluss haben?"
Bildung für Brückenbauer
Danielle Allen selbst steht seit Langem im Austausch mit politischen Entscheidungsträgern, vor allem aus den Bereichen Gesundheit, Strafrecht und Bildung. Gerade in der politischen Bildung sieht sie einen enormen Nachholbedarf, zumal in den USA, wo gesellschaftswissenschaftliche Inhalte in der Ausbildung von Lehrkräften "in den letzten drei Jahrzehnten komplett vom Radar verschwunden" seien, zugunsten einseitiger Investitionen in Mathematik und Naturwissenschaften, Technik- und Ingenieursstudiengänge.
"Die Bildung, wie wir sie derzeit praktizieren, verringert die Wahrscheinlichkeit, dass junge Menschen wählen, dass sie mit Amtsinhabern ins Gespräch kommen oder selbst für öffentliche Ämter kandidieren", so Allen. Für eine vernetzte Gesellschaft, wie sie ihr vorschwebt, eine Gesellschaft, in der Leute Brücken bauen zwischen verschiedenen Gruppen, sodass deren unterschiedliche Interessen und Kompetenzen in politische Richtungsentscheidungen mit einfließen – für eine solche Gesellschaft, sagt Danielle Allen, müssten die Menschen viel konsequenter und engagierter vorbereitet werden.
(fka)
Danielle Allen: "Politische Gleichheit"
Aus dem amerikanischen Englisch von Christine Pries
Suhrkamp, Berlin 2020
240 Seiten, 28 Euro
Außerdem in dieser Ausgabe von Sein und Streit:
Kommentar zu verrohter Gesprächskultur: Der Wille zum Missverständnis
Aufbauschen, skandalisieren, beschimpfen: Unsere Gesprächskultur verkommt immer öfter zu strategischer Kommunikation. Das funktioniert, indem gezieltes Falschverstehen zur Taktik wird, meint Arnd Pollmann.