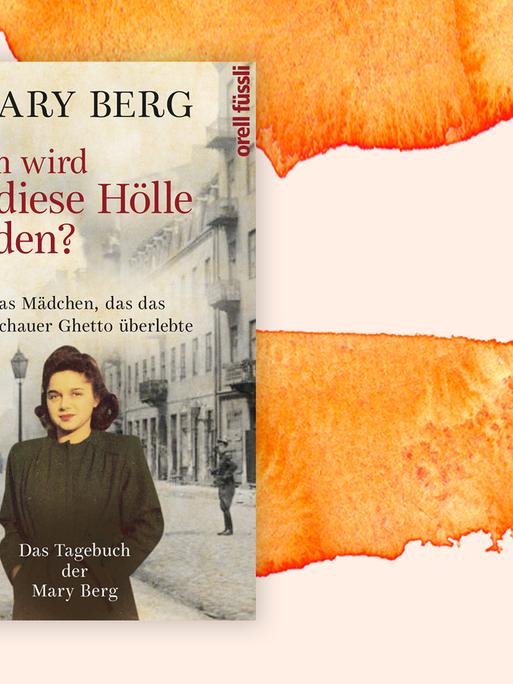Danilo Kiš: "Psalm 44"
Aus dem Serbokroatischen von Katharina Wolf-Grießhaber
Hanser Verlag, München 2019
135 Seiten, 20 Euro
Anleitung für einen Holocaust-Roman
06:22 Minuten
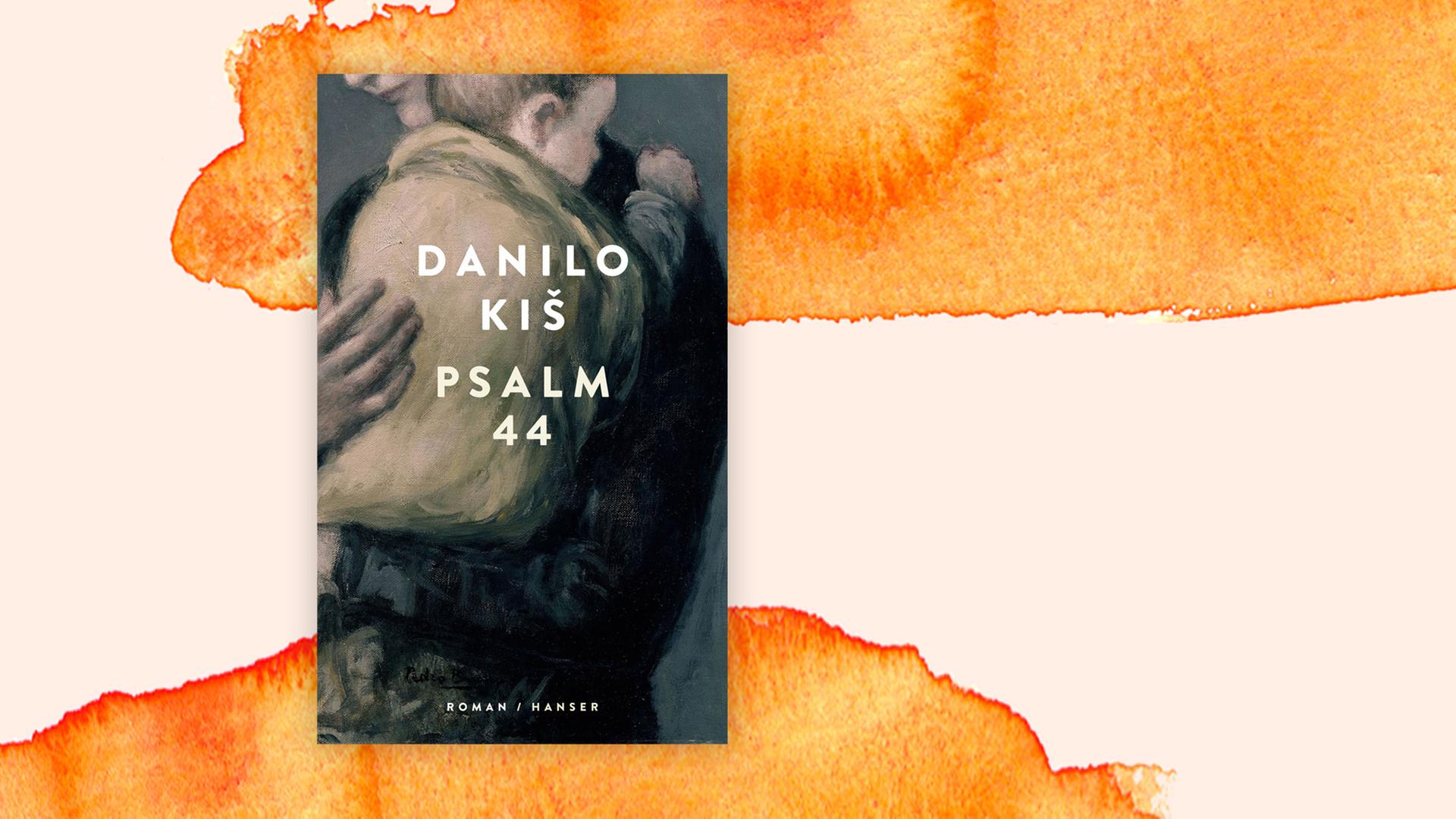
Danilo Kiš erzählt in "Psalm 44" von einer Flucht aus dem KZ Auschwitz. Obwohl nicht frei von Pathos, überzeugt
das Frühwerk des jugoslawischen Autors mit eindringlichen Bildern.
"Dies alles ist über uns gekommen; und wir haben doch dich nicht vergessen", heißt es im Psalm 44, der Not und Leid einer Gemeinschaft beschreibt, zugleich aber auch deren unverbrüchliches Vertrauen in Gott. Er stellt eine Art jüdisches Glaubensbekenntnis dar.
"Psalm 44" ist der Titel eines frühen Romans des in der Vojvodina geborenen, später in Belgrad, Novi Sad und Paris lebenden Autors Danilo Kiš, zu dessen Bewunderern unter anderem Susan Sontag und Joseph Brodsky gehörten.
Dieses nun erstmals in deutscher Übersetzung vorliegende Frühwerk des 1989 verstorbenen Autors verweist bereits auf jene Bücher, die Kis weit über Europas Grenzen hinaus bekanntgemacht haben. Er selbst stand ihm kritisch gegenüber, verfasst hat er es in wenigen Wochen für einen Wettbewerb der jüdischen Gemeinde in Belgrad 1960.
Flucht aus dem KZ
Erzählt wird eine Episode aus dem Holocaust, die Geschichte von Unheil und Überleben: In einer Nacht, in einer Baracke des Konzentrationslagers Auschwitz, planen zwei Frauen einen Fluchtversuch. Jeanne ist die aktivere, Maria, die sich um ihren Säugling kümmert, versucht noch einmal Schlaf zu finden. Neben ihr liegt eine Tote, in der Ferne ist der Kanonendonner der anrückenden Roten Armee zu vernehmen. Die beiden Frauen wechseln wenige Worte, doch immer wieder wird die äußere Realität durchbrochen von Erinnerungen und Fantasien Marias.
Diese Form der Verschränkung, der Wechsel der Zeitebenen, die sperrige, gleichwohl äußerst akribische Erzählweise macht den Roman interessant und zu einer Art Gesellenstück des damals 25-jährigen Autors. Maria, das stellt sich am Ende heraus, ist eine Überlebende, mit ihrem inzwischen sechsjährigen Sohn Jan und dessen Vater Jacob, einem Arzt, der ebenfalls das KZ überlebt hat, besucht sie im letzten Kapitel den Ort des Schreckens, der inzwischen Gedenkstätte geworden ist.
Historisch ungenau, trotzdem ein Dokument
Man kann dem Roman ein gewisses Pathos vorwerfen, das Fehlen (ironischer) Distanz, die unausgegorene Verknüpfung von christlicher Ikonographie und jüdischer Leidensgeschichte, auch historische Ungenauigkeit. Der "Jahrestag der Befreiung" war kein schwüler Sommertag, die Lebensverhältnisse im Lager entsprachen nicht denen, von denen Maria berichtet.
Dennoch ist diese Figur Zeugin und Erinnernde. Die Schilderung ihres Vaters erinnert an Kiš' eigenen Vater, die Beschreibung eines Massakers an das von Novi Sad. Und so wird dieses kleine Stück Literatur zu einem Dokument.
Kiš, dessen Vater in Auschwitz umgebracht wurde, findet hier zum ersten Mal zu den Themen, die ihn als Schriftsteller fortan beschäftigen sollten: die Lebendigkeit erinnerter Zeit, die ästhetische Auseinandersetzung mit Antisemitismus und Anderssein, die Dualität von Hoffnung und Resignation, das Schreiben über Opfer von Totalitarismus und Nationalismus.
Bilder, die man nicht mehr vergisst
Seine Erzählhaltung ist getragen von schriftstellerischer Furchtlosigkeit und moralischem Empfinden gegenüber der Sprache und gegenüber dem Menschen – ungeachtet seiner Nationalität oder gesellschaftlichen Stellung. Dieses rare Empfinden lässt Kiš Bilder finden, die man nicht mehr vergisst: Die Ermordeten, die zersägt werden, um ihre Leichen besser durch ein Eisloch in die Donau zu zwängen; die Verfolgte, die Zuflucht in einer Sargtischlerei gefunden hat und bis Kriegsende ihren Sarg nicht mehr verlassen will.
Die Drastik von Gewalt und Terror in diesem Roman schockiert. Aber eben deshalb, weil sie kühl beschrieben ist und nicht auf eine Wirkung hin. Gerade in Zeiten, in denen sich Nachgeborene oftmals spekulativ oder naiv des Holocausts als Hintergrund ihrer Geschichten bedienen, ist dieser Kurzroman von Danilo Kiš eine Anleitung, wie man es besser machen kann.