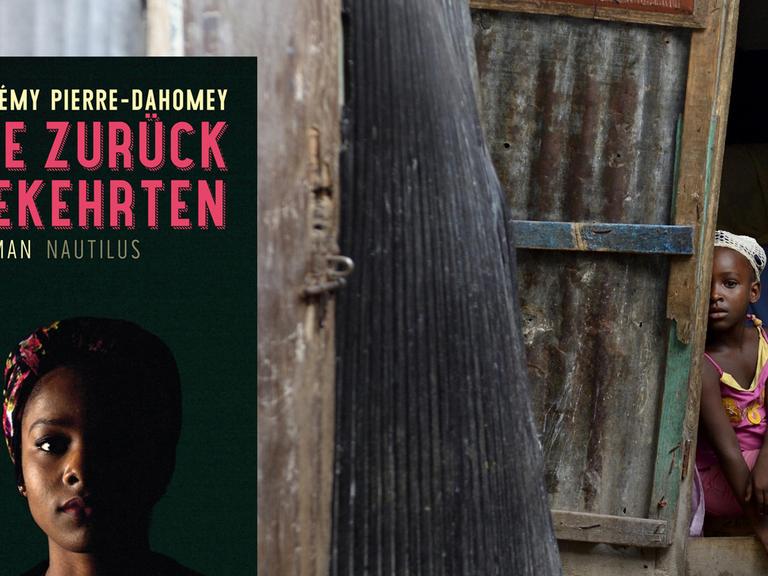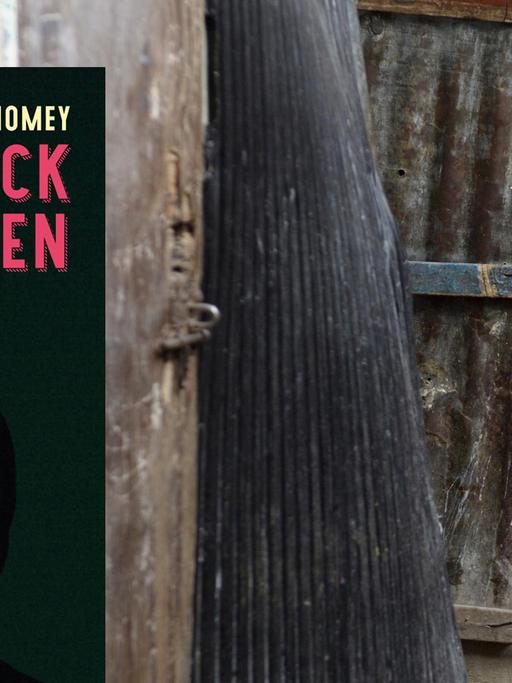Dany Lafferrière: "Ich bin ein japanischer Schriftsteller"
Aus dem Französischen von Beate Thill
Verlag Das Wunderhorn, Heidelberg 2020
200 Seiten, 22 Euro
Gegen den Kult um "Identität"
05:58 Minuten
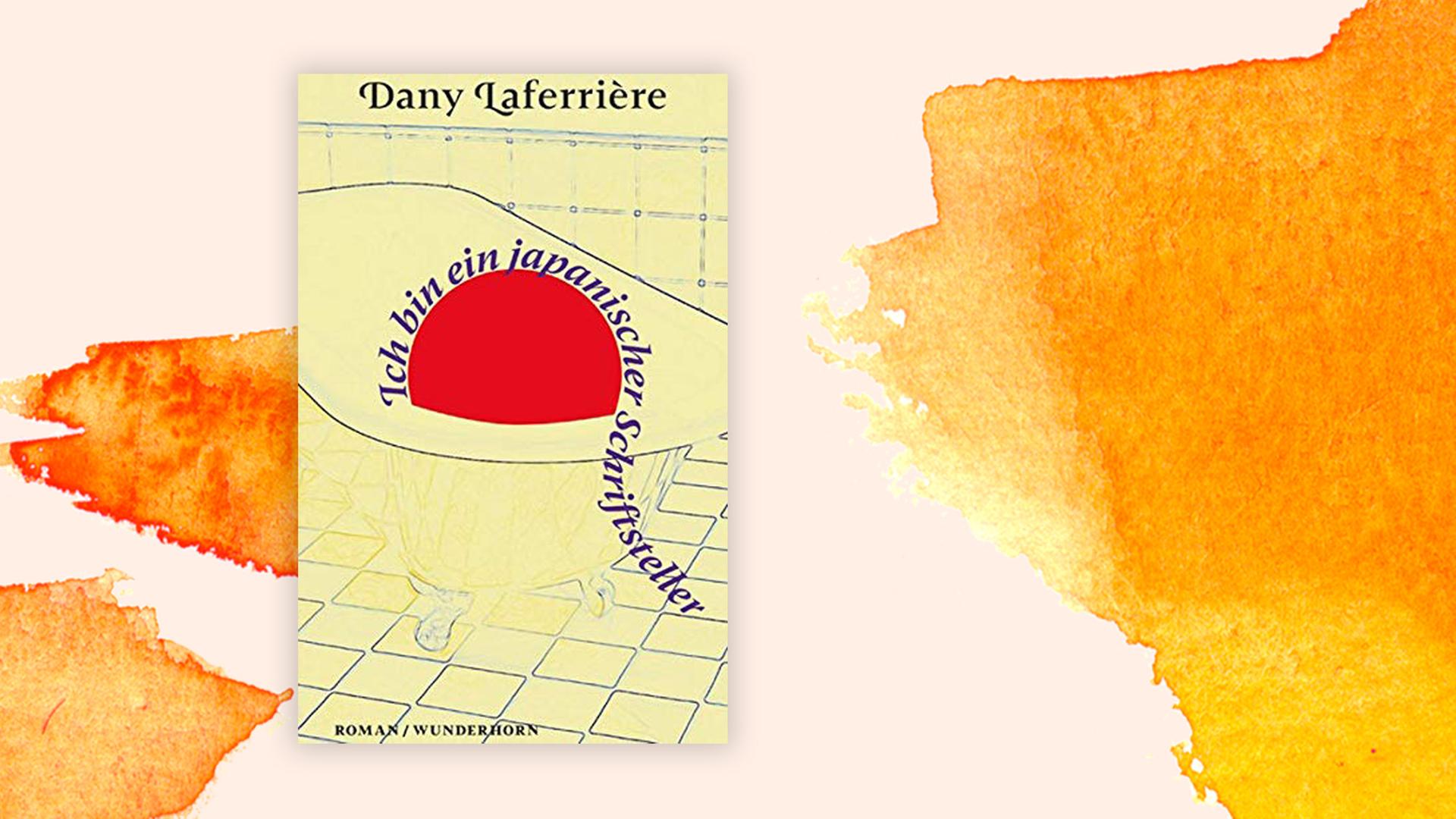
Dany Laferrière führt in seinem neuen Roman die Idee des Identitären auf charmante Weise ad absurdum: Weshalb sollte ein in der Karibik geborener und heute in Kanada lebender Autor nicht zumindest temporär "japanisch" werden?
"Auch das kann ich überhaupt nicht leiden: Authentizität." Worum andere Autoren ihr Leben lang kreisen – Dany Laferrière scheint es mit einer Handbewegung wegzuwischen. Der 1953 in der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince geborene Schriftsteller hatte sich unter dem Druck der diktatorischen Verhältnisse einst mit 23 Jahren dafür entschieden, seine Karibikinsel zu verlassen und nach Montreal überzusiedeln. Heute ist er einer der weltweit bekanntesten frankophonen Autoren, für seinen rhapsodischen Roman "Das Rätsel der Rückkehr" auch in Deutschland preisgekrönt und seit 2014 Mitglied der legendären Académie française – als zweiter "Dunkelhäutiger", der in die Reihen der sogenannten "Unsterblichen" gewählt wurde.
Dany Laferrière, der inzwischen auf ein umfangreiches Prosa- und Essaywerk blicken kann, zeigte allerdings nie die geringste Neigung, sich zur Repräsentativ-Figur für was auch immer machen zu lassen. Und doch – oder gerade deshalb – ist sein erzkomischer Roman "Ich bin ein japanischer Schriftsteller" weit mehr als ein gutgelauntes Vexier- und Versteckspiel mit nationalen und kulturellen Stereotypen, sondern vor allem ein denkbar kraftvoller Einspruch gegen jenen Kult um die "Identität", der inzwischen von links bis rechts seine giftigen Sumpfblüten treibt.
Haruki Murakami ruft spätnachts an
Weshalb nämlich sollte ein auf Haiti geborener Romancier zurückschrecken, nachdem er in einem ersten Impuls seinem nach einem neuen Buch fragenden Verleger geradezu flapsig einen Titel zugeworfen hatte, der ihm just in den Kopf gekommen war: "Ich bin ein japanischer Schriftsteller". Noch während er, der nie zuvor in Japan gewesen ist und sich auch nicht dorthin sehnt, an dem Buch schreibt, spricht sich sein Projekt herum und ruft schließlich sogar das japanische Konsulat in Montreal auf den Plan, wo man fürchtet, die japanische Ultrarechte könne sich beleidigt fühlen – und gleichzeitig hofft, dass ausgerechnet ein "karibischer Schwarzer" den asiatischen Inselstaat von seiner identitären Selbstverkapselung erlösen möge.
Währenddessen beginnen auch die vom Erzähler erfundenen Figuren – japanische Modegirls, deren Fotos er in einer Frauenzeitschrift gefunden hatte – ein quirliges Eigenleben zu führen. Nicht genug damit: Ein Mann namens Haruki Murakami ruft spätnachts an, um zu gestehen, dass ihn schwarze Haut sexuell errege.
Gekonntes Spiel mit Metaebenen und Subtexten
Wir wollen an dieser Stelle nicht nacherzählend weiter ins Detail gehen, nur so viel: Dany Laferrière, der brummig-illusionslose Menschenfreund, verweigert sich zum Vergnügen des Lesers auch jener hoch-artifiziellen Artistik, die ob ihres gekonnten Spiels mit Metaebenen und Subtexten vor allem mit sich selbst beschäftigt bleibt. Er hingegen erzählt mit sympathischer Beiläufigkeit, ist dabei jedoch voller Aufmerksamkeit und hört nicht auf, sich zu wundern: Zufällig trifft er einen verschollen geglaubten haitianischen Jugendfreund wieder, der inzwischen in der Québecer Geschäftswelt reüssiert hat und mit einer halb spanischen, halb japanischen Frau zusammenlebt. Diese wiederum erhofft sich vom vermeintlich "japanischen Schriftsteller" emotionale Auskunft über ihren Lebenspartner und dessen karibische Vergangenheit.
Szenen, die in ihrer kristallinen Rätselhaftigkeit dann durchaus "japanisch" wirken – und wohl auch eine dezente Hommage an Meister Murakami sind. Ansonsten ist Laferrières Cicerone eher der spätmittelalterliche Haiku-Dichter Bashô, dessen konzentrierte Reise-Notate ihn über die Jahrhunderte hinweg berühren, während ihn der faschistoid-identitäre Reinheitsfimmel des 1970 durch Harakiri gestorbenen Yukio Mishima eher entsetzt.
Roman voll befreienden Gelächters
Und in Japan selbst? Wird der Autor dieses (noch) nicht geschriebenen Buchs plötzlich zum Star – und macht Schule in der humanen Kunst selbstironischer Aneignung. Ein dortiger Autor schreibt plötzlich ein Buch mit dem Titel "Ich bin ein madagassischer Schriftsteller", und ein tätowierter Macho-Trucker findet gar den Mut zu einem Bekenntnis-Rap, der alsdann von den Teeangern in der U-Bahn begeistert mitgesungen wird: "Ich bin eine japanische Geisha".
Kulturelle Übergriffigkeit? Aber ja doch und gern mehr davon, sofern man/frau sich den Klauen der Identitären derart elegant entwindet wie Dany Laferrière in diesem wundersamen Roman voll befreiendem Gelächter.