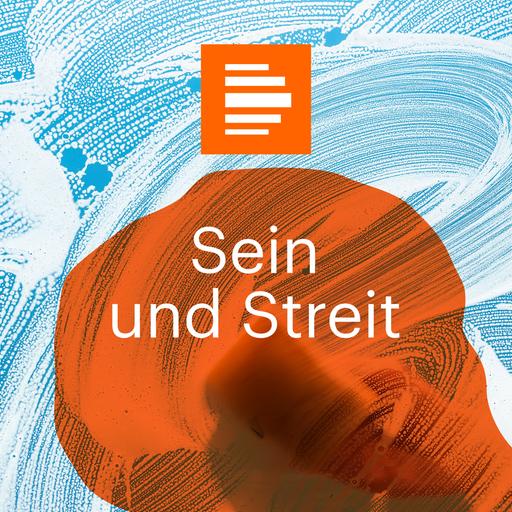Bad Aibling und die Gedankenlosigkeit eines Fahrdienstleiters

3,5 Jahre Haft wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung. So lautete das Urteil des Traunsteiner Landgerichts gegen Michael P. Als Fahrdienstleiter hatte er am 9. Februar ein schweres Zugunglück bei Bad Aibling verursacht, weil er während der Arbeitszeit in das Computerspiel Dungeon Hunter 5 versunken war: zwölf Menschen starben, 85 wurden verletzt.
Anstatt die Züge in die richtigen Gleise zu lenken, manövrierte Michael P. seinen schwerbewaffneten Helden durch eine virtuelle Mittelalterwelt. Doch so schrecklich der Unfall war, und so gerecht die Strafe sein mag: Großen Teilen der Bevölkerung fällt es schwer, Michael P. moralisch zu verurteilen. Lediglich vier Züge pro Stunde musste der Mann abfertigen, ansonsten: Gähnende Leere. Zeit, die sich dehnt wie ein Kaugummi. Wer hätte bei einer solch grandiosen Unterforderung nicht digitale Zerstreuung gesucht? Wer driftet nicht im Netz ab, wenn er haarscharf am Boreout operiert? Wie könnte man einem zu Tode gelangweilten Bahnbeamten ernsthaft zum Vorwurf machen, dass "Dungeon Hunter 5" nun einmal spannender ist, als vier Mal in der Stunde ein paar Knöpfe zu drücken?
Tatsächlich ist die Gedankenlosigkeit des Fahrdienstleiters ein überaus weit verbreitetes Phänomen unserer Zeit. So groß ist die Verführung des Smartphones, dass wir über seine Oberfläche streichen, sobald Prozesse einigermaßen routiniert ablaufen – und zwar, wie man aus eigener Erfahrung weiß, auch in brenzligen Situationen. Beim Überqueren einer Straße flugs schauen, was die Freunde so posten. Im Auto vor der roten Ampel kurz nachsehen, von wem die Whatsapp-Nachricht stammt und sie beim Anfahren schnell noch zu Ende lesen. Obwohl verboten, gehört der Griff zum Mobiltelefon während des Autofahrens längst zur Normalität. Was einer der Hauptgründe dafür ist, dass die Unfallhäufigkeit wieder stetig steigt.
Doch: Gedankenlos etwas versäumen vs. gedankenlos etwas vollziehen
Womit wir es hier zu tun haben, ist eine Gedankenlosigkeit 2.0. Ursprünglich in die Philosophie eingeführt hat den Begriff der Gedankenlosigkeit Hannah Arendt. Und zwar in ihrer Theorie des "banalen Bösen", die Arendt Anfang der 1960er Jahre mit Blick auf den Nationalsozialismus entwickelte. Banal böse ist ein Mensch, so die Philosophin, wenn er gedankenlos Befehle befolgt. Wenn er seine Pflicht erfüllt, ohne sie zu hinterfragen. Die Gedankenlosigkeit 2.0 nun funktioniert gerade umgekehrt: Sie steht nicht im Dienste der Pflicht, sondern agiert gegen sie. Der gedankenlose Befehlsempfänger verfolgt seine Ziele in der realen Welt bar jeden moralischen Bewusstseins. Der gedankenlose Daddelmensch hingegen flüchtet sich ins Digitale und vernachlässigt seine Pflicht auf mitunter tödliche Weise. Die Wirklichkeit, das ist für ihn: das banale Öde.
Doch eine Handlungsverpflichtung gibt es auch für uns
Vor diesem Hintergrund liegt nahe, die fortschreitenden Automatisierungsprozesse als nahendes Heil zu deuten. So wird das selbstfahrende Auto die Unfallgefahr durch Ablenkung auf Null reduzieren. Sehr wahrscheinlich gehören auch fehlbare Fahrdienstleiter früher oder später der Vergangenheit an. Und dass mit der Abschaffung stupider Tätigkeiten ohnehin ein hohes Ziel der Menschheitsgeschichte erreicht wäre, wird niemand ernsthaft bestreiten. Dass aber auch Langeweile und Überdruss verschwinden, wenn Maschinen uns in einem immer größeren Ausmaß die Arbeit abnehmen, ist keineswegs sicher. Es ist an uns, die Wirklichkeit, um es wiederum mit Arendt zu sagen, handelnd zu gestalten. Als politische Wesen, nicht als Digitalzombies. Unsere Zukunft der Technik zu überlassen, wäre gedankenlos.