Das bereichernde Erbe der Vertriebenen
Mehr noch als Mohnkuchen und Königsberger Klopse zählt der Autor Andreas Kossert Fleiß und Anpassungsfähigkeit zum bereichernden Erbe der Vertriebenen. Sein Buch "Kalte Heimat" ist mit Leidenschaft geschrieben. Möglicherweise kann nur ein vergleichsweise junger deutscher Historiker ein solches Thema so mitreißend erschließen.
"Die politische Linke hat in der Vergangenheit, das lässt sich leider nicht bestreiten, zeitweise über die Vertreibungsverbrechen, über das millionenfache Leid, das den Vertriebenen zugefügt wurde, hinweggesehen, sei es aus Desinteresse, sei es aus Ängstlichkeit vor dem Vorwurf, als Revanchist gescholten zu werden, oder sei es in dem Irrglauben, durch Verschweigen und Verdrängen eher den Weg zu einem Ausgleich mit unseren Nachbarn im Osten zu erreichen. Dieses Verhalten war Ausdruck von Mutlosigkeit und Zaghaftigkeit."
Nicht nur das. Aggressive Mitleidlosigkeit paarte sich mit massiver Verdrängung und verblüffender Borniertheit, was die völkerrechtliche Legitimität von Vertreibung betrifft. Doch immerhin: da bekennt einer wenigstens, was er sich vorzuwerfen hat, wenn auch ziemlich spät: also sprach Bundesinnenminister Otto Schily auf einer Veranstaltung des Bundes der Vertriebenen 1999. Der Bekennermut der Ungarn und Slowaken war ihm übrigens längst zuvorgekommen.
Doch Schily und die politische Linke sind nicht die Einzigen gewesen, die sich für das Schicksal der 14 Millionen Deutschen wenig interessierten, die während oder nach dem Krieg aus ehemals deutschen Landen, aber auch aus alten deutschen Siedlungsgebieten überall im osteuropäischen Raum in die Besatzungszonen der Westalliierten strömten. Vielen Nachgeborenen war die Mohnkuchenseligkeit dicker schlesischer Omas peinlich, der ganze Trachtenrummel, die ewigen Egerländer, das dauernde Geflenne, der revanchistische Mist. Man flüchtete sich in die Kollektivschuldthese: Waren das damals nicht alles Nazis gewesen? Hatten sie Flucht, Vertreibung, Totschlag und Vergewaltigung nicht irgendwie verdient?
"Für die Deutschen aus dem Osten schien es nur zwei Alternativen zu geben: entweder waren sie reuig und akzeptierten die Vertreibung als Strafe für die Verbrechen des Hitler-Regimes. Oder sie waren Ewiggestrige, die das Leiden der Nachkriegszeit vor sich hertrugen, um über die Schuld der Kriegszeit nicht reden zu müssen. Schuld waren sie auf jeden Fall."
Welche Entlastungsstrategien hier wirksam werden und welche tief sitzenden Traumata sie hinterließen, erzählt Andreas Kossert mit Empathie und Leidenschaft. Diese Vergangenheit ist nicht nur nicht vergangen, sie hat ihre Spuren auch bei den scheinbar nicht beteiligten Nachkriegsgeborenen hinterlassen – und wer dieses ungemein spannende Buch gelesen hat, wird die Spuren an sich selbst entdecken.
Nie hätten meine Eltern zugegeben, dass sie, wenn auch nicht Vertriebene, so doch Flüchtlinge waren. Nie wurde darüber gesprochen, warum wir nicht dazuzugehören schienen dort, wo ja wohl meine Heimat war, bin ich doch dort geboren. Warum die Einheimischen bei uns Kindern Verwahrlosung witterten und die berufstätige Mutter für pflichtvergessen hielten. Warum es uns auch in späteren Jahren immer noch schwerfiel, die Zeichen zu deuten, die Eingeweihte von Außenstehenden unterschieden. Warum wir aufzutrumpfen versuchten mit besonderen Leistungen und außer einem sauberen Hochdeutsch, das keinerlei Klangfärbung erkennen ließ, bald perfekt Englisch sprachen.
Auch solchen Nachgeborenen entging, dass ihre Abwehr der eigenen Familiengeschichte ein Vorbild hatte. Das Argument, die Vertriebenen hätten sich ihr Schicksal selbst zuzuschreiben, seien sie doch alle Nazis gewesen – in der Mehrheit waren sie Frauen, Kinder und alte Männer – dieser Gedankengang war nicht auf ihrem Mist gewachsen.
Andreas Kossert zeigt, dass man so im Westen dachte, in den ländlichen Gebieten, in die man die Ströme entwurzelter Menschen lenkte, Menschen, die fremdartig sprachen, aßen, aussahen: die Einheimischen, überfordert, wähnten sich als Opfer von Polacken und "tolopen Pack", also dahergelaufenem Gesindel.
Auf nichts war Westdeutschland lange Zeit stolzer als auf die Integration der 14 Millionen aus den verlorenen Ostgebieten. Das Verdienst der einheimischen Westdeutschen aber war das nicht, die gerne an die eigenen gewaltigen Anstrengungen von Mitmenschlichkeit und Solidarität glauben wollten. Es waren die Vertriebenen selbst, die "durch ihre Leistungs- und Anpassungsbereitschaft, ihre Arbeits- und bald auch ihre Kaufkraft das Wirtschaftswunder ganz entscheidend mittrugen." Zur Belohnung durften sie noch nicht einmal über das Verlorene trauern, ohne als Revanchisten verschrien zu werden.
"Dass die Aufnahme der 14 Millionen nicht zur politischen Dauermalaise wurde und die befürchtete Radikalisierung ausblieb, dafür zahlten die Vertriebenen mit Verleugnung ihres Schmerzes und kultureller Selbstaufgabe. Schlesier, Ostpreußen, Pommern, Deutschböhmen und Banater Schwaben, die über Jahrhunderte beigetragen haben zur Vielfalt der deutschen Identität, hatten in der Heimat nichts mehr zu melden. Sie mussten sich anpassen im Westen ihres Vaterlandes, das ihnen zur kalten Heimat werden sollte."
Kosserts Buch gibt ihnen die Würde zurück. Das ist das eine. Viel wichtiger aber ist vielleicht, endlich anzuerkennen, was die Vertriebenen für Deutschland geleistet haben: Nicht nur, was Musik und Königsberger Klopse, Mohnkuchen und Religiosität betrifft – multikulturell war Deutschland schon vor dem ersten italienischen Gastarbeiter. Ihr wichtigstes Kapital zahlt sich erst heute aus, noch immer fast unbemerkt von der deutschen Öffentlichkeit - gute, ja vielfach beste Beziehungen zu der alten Heimat und den dort Lebenden. Das ist seit dem Fall des Eisernen Vorhangs ein Pfund, mit dem Deutschland wuchern kann.
Die andere Mitgift der Vertriebenen ist das Gegenteil jener spießigen Heimatidolatrie, die man ihnen unterstellt - eine bis dato nicht gekannte Weltläufigkeit. Denn viele machten aus dem Leid eine Tugend und erfanden sich kosmopolitisch neu. Wer junge und mittelalte Deutsche mit Franzosen oder Briten vergleicht, dem fällt schnell auf, wie vergleichsweise entspannt die einen, wie provinziell die anderen sind. Wir haben gelernt, dass Heimat verdammt hinderlich sein kann.
"Ich nahm mir vor, mich in meinem Leben auf gar keinen Fall mit einer HEIMAT zu belasten. Ich würde um das Ruhrgebiet garantiert nicht weinen. (...) Ich wollte überall leben können. Und nie Heimweh haben."
Das schreibt Petra Reski im Jahr 2002, eine mit Jahrgang 1958 jüngere Nachgeborene von Vertriebenen, die irgendwann diese Tatsache zuließ und in ihr den Grund für Verhaltensmuster fand, die zuvor Ergebnis eigener freier Entscheidung zu sein schienen. Andreas Kossert rechnet auch das unter das bereichernde Erbe der Vertriebenen: nicht nur Fleiß und enorme Anpassungsfähigkeit, auch die Bereitschaft, sich der Moderne mit ihren Mobilisierungsgeboten zu öffnen.
Das ebenso faktenreiche wie leidenschaftliche Buch, souverän geschrieben, ein Lesegenuss, nimmt einem stellenweise den Atem. Vielleicht kann nur ein vergleichsweise junger deutscher Historiker ein solches Thema so mitreißend erschließen – dessen ruhiges Selbstbewusstsein keinen Vorwurf des "Revanchismus" fürchten muss, hat er doch längst und zudem von seinen polnischen und britischen Kollegen gelernt, dass die Wahrheit allen Menschen gleich welcher Nationalität zuzumuten ist.
Kossert, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Historischen Institut in Warschau, weiß, dass man in Polen erheblich weiter ist mit der "Vergangenheitsbewältigung", als das ‚Regiment der Zwillinge’ erahnen ließ. In Breslau etwa nimmt man die deutsche Vergangenheit der Stadt mit Stolz an und in der Weltstadt Warschau weiß man um die Chancen, Drehscheibe im neuen Europa, Vermittler zwischen Ost und West zu sein. Demgegenüber kommt einem das deutsche Minderwertigkeitsgefühl, das den Westdeutschen die Freude noch an der Wiedervereinigung verbot, kleinkariert und rückständig vor.
Kossert hat sein Buch auch im Blick auf die Zukunft geschrieben, für die das Wissen um die Vergangenheit bedeutsam ist: das Wissen um den kulturellen Reichtum in der Mitte Europas.
"Die Transformation Nachkriegsdeutschlands dürfte erst abgeschlossen sein, wenn die geistige Aneignung der verlorenen kulturellen Provinzen vollzogen ist."
Ein erster Schritt: hinfahren. Masuren ist auch nicht weiter als die Toskana.
Andreas Kossert: Kalte Heimat. Die Geschichte der deutschen Vertriebenen nach 1945
Siedler Verlag, München 2008
Nicht nur das. Aggressive Mitleidlosigkeit paarte sich mit massiver Verdrängung und verblüffender Borniertheit, was die völkerrechtliche Legitimität von Vertreibung betrifft. Doch immerhin: da bekennt einer wenigstens, was er sich vorzuwerfen hat, wenn auch ziemlich spät: also sprach Bundesinnenminister Otto Schily auf einer Veranstaltung des Bundes der Vertriebenen 1999. Der Bekennermut der Ungarn und Slowaken war ihm übrigens längst zuvorgekommen.
Doch Schily und die politische Linke sind nicht die Einzigen gewesen, die sich für das Schicksal der 14 Millionen Deutschen wenig interessierten, die während oder nach dem Krieg aus ehemals deutschen Landen, aber auch aus alten deutschen Siedlungsgebieten überall im osteuropäischen Raum in die Besatzungszonen der Westalliierten strömten. Vielen Nachgeborenen war die Mohnkuchenseligkeit dicker schlesischer Omas peinlich, der ganze Trachtenrummel, die ewigen Egerländer, das dauernde Geflenne, der revanchistische Mist. Man flüchtete sich in die Kollektivschuldthese: Waren das damals nicht alles Nazis gewesen? Hatten sie Flucht, Vertreibung, Totschlag und Vergewaltigung nicht irgendwie verdient?
"Für die Deutschen aus dem Osten schien es nur zwei Alternativen zu geben: entweder waren sie reuig und akzeptierten die Vertreibung als Strafe für die Verbrechen des Hitler-Regimes. Oder sie waren Ewiggestrige, die das Leiden der Nachkriegszeit vor sich hertrugen, um über die Schuld der Kriegszeit nicht reden zu müssen. Schuld waren sie auf jeden Fall."
Welche Entlastungsstrategien hier wirksam werden und welche tief sitzenden Traumata sie hinterließen, erzählt Andreas Kossert mit Empathie und Leidenschaft. Diese Vergangenheit ist nicht nur nicht vergangen, sie hat ihre Spuren auch bei den scheinbar nicht beteiligten Nachkriegsgeborenen hinterlassen – und wer dieses ungemein spannende Buch gelesen hat, wird die Spuren an sich selbst entdecken.
Nie hätten meine Eltern zugegeben, dass sie, wenn auch nicht Vertriebene, so doch Flüchtlinge waren. Nie wurde darüber gesprochen, warum wir nicht dazuzugehören schienen dort, wo ja wohl meine Heimat war, bin ich doch dort geboren. Warum die Einheimischen bei uns Kindern Verwahrlosung witterten und die berufstätige Mutter für pflichtvergessen hielten. Warum es uns auch in späteren Jahren immer noch schwerfiel, die Zeichen zu deuten, die Eingeweihte von Außenstehenden unterschieden. Warum wir aufzutrumpfen versuchten mit besonderen Leistungen und außer einem sauberen Hochdeutsch, das keinerlei Klangfärbung erkennen ließ, bald perfekt Englisch sprachen.
Auch solchen Nachgeborenen entging, dass ihre Abwehr der eigenen Familiengeschichte ein Vorbild hatte. Das Argument, die Vertriebenen hätten sich ihr Schicksal selbst zuzuschreiben, seien sie doch alle Nazis gewesen – in der Mehrheit waren sie Frauen, Kinder und alte Männer – dieser Gedankengang war nicht auf ihrem Mist gewachsen.
Andreas Kossert zeigt, dass man so im Westen dachte, in den ländlichen Gebieten, in die man die Ströme entwurzelter Menschen lenkte, Menschen, die fremdartig sprachen, aßen, aussahen: die Einheimischen, überfordert, wähnten sich als Opfer von Polacken und "tolopen Pack", also dahergelaufenem Gesindel.
Auf nichts war Westdeutschland lange Zeit stolzer als auf die Integration der 14 Millionen aus den verlorenen Ostgebieten. Das Verdienst der einheimischen Westdeutschen aber war das nicht, die gerne an die eigenen gewaltigen Anstrengungen von Mitmenschlichkeit und Solidarität glauben wollten. Es waren die Vertriebenen selbst, die "durch ihre Leistungs- und Anpassungsbereitschaft, ihre Arbeits- und bald auch ihre Kaufkraft das Wirtschaftswunder ganz entscheidend mittrugen." Zur Belohnung durften sie noch nicht einmal über das Verlorene trauern, ohne als Revanchisten verschrien zu werden.
"Dass die Aufnahme der 14 Millionen nicht zur politischen Dauermalaise wurde und die befürchtete Radikalisierung ausblieb, dafür zahlten die Vertriebenen mit Verleugnung ihres Schmerzes und kultureller Selbstaufgabe. Schlesier, Ostpreußen, Pommern, Deutschböhmen und Banater Schwaben, die über Jahrhunderte beigetragen haben zur Vielfalt der deutschen Identität, hatten in der Heimat nichts mehr zu melden. Sie mussten sich anpassen im Westen ihres Vaterlandes, das ihnen zur kalten Heimat werden sollte."
Kosserts Buch gibt ihnen die Würde zurück. Das ist das eine. Viel wichtiger aber ist vielleicht, endlich anzuerkennen, was die Vertriebenen für Deutschland geleistet haben: Nicht nur, was Musik und Königsberger Klopse, Mohnkuchen und Religiosität betrifft – multikulturell war Deutschland schon vor dem ersten italienischen Gastarbeiter. Ihr wichtigstes Kapital zahlt sich erst heute aus, noch immer fast unbemerkt von der deutschen Öffentlichkeit - gute, ja vielfach beste Beziehungen zu der alten Heimat und den dort Lebenden. Das ist seit dem Fall des Eisernen Vorhangs ein Pfund, mit dem Deutschland wuchern kann.
Die andere Mitgift der Vertriebenen ist das Gegenteil jener spießigen Heimatidolatrie, die man ihnen unterstellt - eine bis dato nicht gekannte Weltläufigkeit. Denn viele machten aus dem Leid eine Tugend und erfanden sich kosmopolitisch neu. Wer junge und mittelalte Deutsche mit Franzosen oder Briten vergleicht, dem fällt schnell auf, wie vergleichsweise entspannt die einen, wie provinziell die anderen sind. Wir haben gelernt, dass Heimat verdammt hinderlich sein kann.
"Ich nahm mir vor, mich in meinem Leben auf gar keinen Fall mit einer HEIMAT zu belasten. Ich würde um das Ruhrgebiet garantiert nicht weinen. (...) Ich wollte überall leben können. Und nie Heimweh haben."
Das schreibt Petra Reski im Jahr 2002, eine mit Jahrgang 1958 jüngere Nachgeborene von Vertriebenen, die irgendwann diese Tatsache zuließ und in ihr den Grund für Verhaltensmuster fand, die zuvor Ergebnis eigener freier Entscheidung zu sein schienen. Andreas Kossert rechnet auch das unter das bereichernde Erbe der Vertriebenen: nicht nur Fleiß und enorme Anpassungsfähigkeit, auch die Bereitschaft, sich der Moderne mit ihren Mobilisierungsgeboten zu öffnen.
Das ebenso faktenreiche wie leidenschaftliche Buch, souverän geschrieben, ein Lesegenuss, nimmt einem stellenweise den Atem. Vielleicht kann nur ein vergleichsweise junger deutscher Historiker ein solches Thema so mitreißend erschließen – dessen ruhiges Selbstbewusstsein keinen Vorwurf des "Revanchismus" fürchten muss, hat er doch längst und zudem von seinen polnischen und britischen Kollegen gelernt, dass die Wahrheit allen Menschen gleich welcher Nationalität zuzumuten ist.
Kossert, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Historischen Institut in Warschau, weiß, dass man in Polen erheblich weiter ist mit der "Vergangenheitsbewältigung", als das ‚Regiment der Zwillinge’ erahnen ließ. In Breslau etwa nimmt man die deutsche Vergangenheit der Stadt mit Stolz an und in der Weltstadt Warschau weiß man um die Chancen, Drehscheibe im neuen Europa, Vermittler zwischen Ost und West zu sein. Demgegenüber kommt einem das deutsche Minderwertigkeitsgefühl, das den Westdeutschen die Freude noch an der Wiedervereinigung verbot, kleinkariert und rückständig vor.
Kossert hat sein Buch auch im Blick auf die Zukunft geschrieben, für die das Wissen um die Vergangenheit bedeutsam ist: das Wissen um den kulturellen Reichtum in der Mitte Europas.
"Die Transformation Nachkriegsdeutschlands dürfte erst abgeschlossen sein, wenn die geistige Aneignung der verlorenen kulturellen Provinzen vollzogen ist."
Ein erster Schritt: hinfahren. Masuren ist auch nicht weiter als die Toskana.
Andreas Kossert: Kalte Heimat. Die Geschichte der deutschen Vertriebenen nach 1945
Siedler Verlag, München 2008
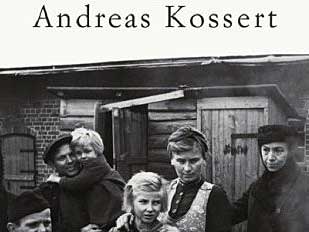
Andreas Kossert: "Kalte Heimat" (Coverausschnitt)© Siedler Verlag
